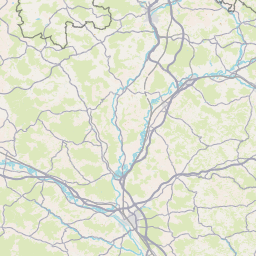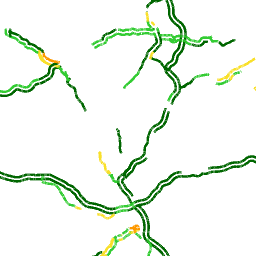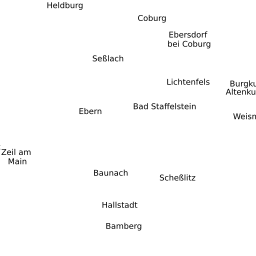Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "A"
Ursprünglich das Kopieren von Gemälden mittels Kupferstichen. Nachdem im späten 18. und vor allem im frühen 19. Jh. vermehrt Musterbücher mit Stichvorlagen als Anregung für Kunsthandwerker erschienen, wurde der Ausdruck auch für das Übernehmen solcher Vorbilder angewandt. Inzwischen versteht man darunter jegliche Art des Kopierens.
Dieser Begriff ist mit dem Begriff "Druck" gleichzusetzen, den Walter Koschatzky folgendermaßen beschreibt: "Druck heißt ganz allgemein, die dafür in Druckfarbe auf einer Platte (Druckform) mit geeigneten Mitteln aufgebrachten linearen oder flächigen Gebilde durch Aufpressen auf Papier oder ein anderes als Druckträger geeignetes Material wiederholbar zu übertragen."
Dekore können durch Tiefenätzung oder Hochätzung mit Flusssäure angebracht werden. Daneben kann auch nur die Oberfläche matt geätzt oder blank geätzt werden.
siehe Tiefdruck.
Dekorationstechnik, die eine Arbeitserleichterung und kostengünstige Alternative zum Glasschnitt darstellt. Sie wurde häufig von Jugendstilglaskünstlern angewendet.
Die Bezeichnung stammt aus dem Französischen "agrafe" für Haken, Klammer. Beim Schmuck eine Spange, in der Architektur ein oft figürlich gestalteter Abschlusstein. Allgemein: ein durch eine Stütze oder Ähnliches hervorstehendes dekoratives Element.
Haarschmuck des 18. Jhs., bei dem federartig oder floral gestaltete, mit Steinen oder Perlen verzierte Metallteile über die Frisur hinausragen und oft beweglich montiert sind.
Schneckenlinie bzw. Spirale, die in Form eines Akanthusblattes gestaltet ist. Akanthus ist ein gezacktes Blatt, benannt nach der Bärenklaupflanze der Mittelmeerländer.
Eine japanische Zuchtperle.
Aus dem Griechischen, zu deutsch Leistenvers oder Leistengedicht. Die Anfangsbuchstaben einer Wortfolge ergeben ein neues Wort, einen Namen oder einen Satz.
Reliquentafeln als Altarschmuck, meist in Dreiecksform.
Brillantschliff des 19. Jhs., der bis ca. 1940 im Schmuck verarbeitet wurde. Bei dieser Ausführung sind die Proportionen der Steine noch nicht so angelegt, dass ein Optimum an Brillanz und Feuer entstünde.
Eine der berühmtesten Familien von Geigenbauern in Cremona, Oberitalien. Andrea A. (geb. vor 1511, gest. vor 1580) wird zu den frühesten Geigenbauern überhaupt gezählt und mit der "Erfindung" der Geigen in Verbindung gebracht. Von ihm sind nur wenige Instrumenten erhalten. Seine beiden Söhne, Antonio A. (ca. 1540) und Girolamo (= Hieronymus) A. (1561-1630) übernahmen 1580 das Geschäft ihres Vaters. Nicola A. (1596-1684) wurde zum Lehrer von Antonius Stradivarius. Alle Mitglieder der Familie Amati gelten als herausragende Instrumentenmacher, deren Violinen, Bratschen und Violoncelli mit höchsten Summen bezahlt werden. Entsprechend oft wird ihr Name fälschlich in einfachen Serienprodukten und anspruchsvollen Kopien oder gar in Fälschungen verwendet.
Franz. allgemein = alte Regierungsform; im speziellen das absolutistische System in Frankreich vor der Revolution von 1789.
Der persönlichen Andacht dienendes, kleinformatiges Gemälde oder Schnitzwerk, seit dem Spätmittelalter gebräuchlich. So genannte "Kleine Andachtsbilder" bezeichnen die Gebetbuchbildchen.
Angarnieren oder Bossieren nennt man das An- oder Zusammensetzen von separat hergestellten keramischen Formteilen (Geschirrhenkel oder Figurenteilen) mittels Schlicker.
Um 1670 von William Clement entwickelt, sie löste die Spindelhemmung ab und verbesserte die Ganggenauigkeit der Uhr.
Der Reparaturvorgang, beispielsweise bei einer Geige, bei der ein Hals erneuert wird. Klassische Aufgabe einer Meisterprüfung.
Modell wie z.B. eine Mühle, ein Springbrunnen, ein Schmiedehammer oder eine Säge, das durch eine Dampfmaschine in Betrieb gesetzt wird.
Aus dem Griechischen für dunkel, verborgen. Eine apokryphe Geschichte oder Szene ist eine Szene, die nicht in die Bibel zu finden ist (sondern in den sogenannten apokryphen Schriften) und deren Herkunft ungeklärt ist.
siehe Tiefdruck.
"Geheimnis" der Zusammensetzung der Porzellanmasse. Im 18. Jh. wurden die Porzellankeramiker auch Arkanisten genannt.
Die vor Einführung der Feuerwaffen gefährlichste Schusswaffe. Die Armbrust besteht aus einer Säule, auf der ein Bogen befestigt ist, der mit einer speziellen Haltevorrichtung schussbereit gehalten wird, bis der Schütze den Abzug betätigt. Die Armbrust wurde bis ins frühe 16. Jh. im Krieg benutzt, später nur noch bei Jagd oder für sportliche Zwecke.
Beim Brand des Porzellans entstehender Holzaschenflug, der sich auf die Glasur aufsetzt und einbrennt.
Von lateinisch "assistere" = (da)beistehen, helfen. Gemeint sind Nebenfiguren, die dem Hauptgeschehen beistehen, wie z.B. Maria und Johannes unter dem Kreuz Christi sowie Engelsfiguren.
Edelzinnteller in Reliefguss mit der Darstellung der Auferstehung. Dieses Sujet findet sich auf Nürnberger Relief-Zinntellern von Steffan Christan (vor 1605), von Caspar Enderlein (Guß Hans Spatz I., nach 1600), Paulus Öham d.J. (2. Drittel des 17. Jh.) und Hans Spatz II (2. Viertel des 17. Jh.). Für die Beliebtheit derartiger Relief-Zinnteller im allgemeinen, wie für diese Thematik im besonderen, spricht die Aufzählung von 52 Beispielen bei E. Hintze "Nürnberger Zinngießer".
Diese Technik, bei der die Farben nach dem 2. Brand aufgetragen werden, ermöglicht ein unbegrenztes Farbspektrum, sofern die verwendeten Farben die Brenntemperaturen des zum Einbrennen erforderlichen 3. Brandes tolerieren, dessen Höhe allerdings deutlich niedriger als beim 2. Brand liegt. Bei den Aufglasur-Farben (= Muffelfarben) handelt es sich wie bei den Scharffeuerfarben ebenfalls um anorganische Verbindungen mit teilweise komplizierter chemischer Struktur. Letztlich ist es immer noch so, dass viele dieser alten Farbmischungen nur annäherungsweise bekannt sind, nicht analytisch untersucht und damit nicht reproduzierbar sind. Bis heute erkennt der Fachmann einzelne Manufakturen an ihrem Farbspektrum.
Eine reiche Palette an keramischen Schmelzfarben, die, im Gegensatz zu den Scharffeuerfarben, auf die bereits gebrannte Glasur gemalt und bei Temperaturen von 600 - 800°C im Muffelofen gebrannt werden.
Autos, Eisenbahnen oder Figuren, die durch Aufziehen eines Federwerkes in Bewegung gebracht werden.
Verblassung durch Sonneneinstrahlung.