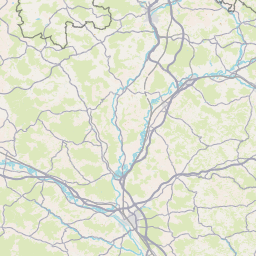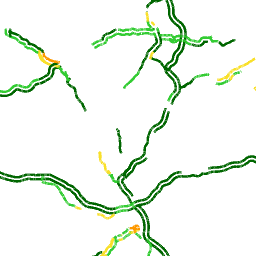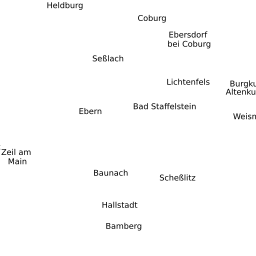Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "C"
Edelsteinschliff mit flacher Unterseite und stark gewölbter Oberfläche. Der Cabochon-Schliff wird meist bei farbigen Steinen angewendet, die dadurch ein eigenartiges Schillern erhalten.
Altdeutsch "Napf" = Topf. Die Bezeichnung wird auch anstelle von Kaffee-Hafen, d.h. Kaffee-Tasse verwendet.
Mit malen "en camaieu" bezeichnete man das Malen von Ton in Ton, vorzugsweise in Purpurtönen. Die Grau-in-Grau-Malerei wird Grisaille genannt.
Erhabene Darstellung, die durch das teilweise Wegschneiden der oberen Schicht eines Lagensteines, einer Glaspaste oder einer Muschel entsteht.
Feine Goldarbeit aus gleich oder unterschiedlich starken Drähten, die wie verwoben oder versponnen wirken.
Gelblich bis blutrote Variante des Chalcedon (kristalline Abart des Quarz).
Wanduhr mit einem geschnitzten oder in Bronze gegossenen Rahmen. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts lag der Schwerpunkt auf Uhren aus vergoldeter Bronze, in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz entstanden Gehäuse, die aus Holz geschnitzt und vergoldet waren.
Schmales Pergamentzettelchen auf Reliquienverpackungen in sogenannten Klosterarbeiten mit dem Namen der entsprechenden Heiligen oder Materialien von heiligen Stätten.
siehe Violoncello.
Auch Zellhorn genannt, ist ein von den Brüdern Hyatt 1869 in den USA entdeckter früher Kunststoff hornähnlichen Aussehens. Wegen seiner Zusammensetzung (Papierfasern, Schwefel- und Salpetersäure sowie Kampfer) der Schießbaumwolle (Nitrozellulose) sehr ähnlich, war auch Celluloid höchst feuergefährlich und eignete sich erst nach vielen Verbesserungen zur Herstellung von Spielzeug. Bedeutendster Produzent auf diesem Gebiet waren die Schildkröt-Werke, die ab 1895 Celluloidspielwaren erzeugten und auch Firmen wie König & Wernicke, Kämmer & Reinhardt, J.D. Kestner und andere mit Puppen-Rohlingen belieferten.
Wurden ab 1895 bis ca. 1950 hergestellt, dann wurde das feuergefährliche Celluloid durch weniger brennbare Kunststoffe wie Tortulan, Cellit, Cellidor etc. ersetzt.
Körniges Leder aus dem Rückenstück von Pferde- oder Eselshaut; im 18. Jh. meist grün eingefärbtes Leder aus Haifischhaut zum Beziehen von Dosen und Futteralen.
Grubenschmelztechnik, bei der das Emaille in, mit einem Stichel ausgehobene Vertiefungen der zu verzierenden Metalloberfläche z.B. dem Deckel einer Uhr, eingeschmolzen wird.
Puppen mit realistischen, kindlichen oder babyhaften Gesichtern. Bedeutende Hersteller waren u.a. Kämmer & Reinhardt, Kestner und die Gebrüder Heubach.
Bezeichnet einen "Jäger zu Fuß" (französischer Soldat).
An fernöstlichen, besonders chinesischen Vorbildern orientierte Dekore und Verzierungen. Durch den Einfluss der Importe aus Ostasien wurden seit der 2. Hälfte des 17. Jhs. vor allem chinesische Motive und Szenerien für die Bemalung von europäischem Kunstgewerbe immer beliebter. Neben der Innendekoration fanden Chinoiserien besonders als Schmuck und Ornamentik bei Fayencen und Porzellanen des 18. Jhs. Anwendung.
Dekore, Darstellungen, Formen nach echten oder imitierenden chinesischen Vorlagen.
Durch Chromoxyd erzeugte tiefgrüne Farbe. Ab 1817 in Meissen verwendet (Weinlaubmuster).
Präzisionsuhren, deren Ganggenauigkeit von einer offiziellen Prüfstelle überprüft wurde und den Anforderungen entsprechen, werden mit einem offiziellen Gangschein ausgezeichnet.
Gottheit der griechisch/römischen Mythologie. Einer der Titanen, der meist als alter Mann dargestellt ist mit Sichel, Stundenglas und Flügeln, als Allegorie der Zeit.
Der Clavisbalken liegt in der Drehorgel über der Walze und tastet sie beim Drehen mit seinen Clavisstiften ab. Dabei wird über die sogenannten Stecher die Information zu den Ventilklappen geleitet, die sich dann öffnen oder schließen.
Zusammenstellung aus verschiedenen Stücken oder Materialien.
Auch kurz "Masse" genannt; besteht im wesentlichen aus Knochenleim, Zellulose, Kreide und Sand. Sie war leicht formbar und wurde zur Herstellung von Puppenkörpern und -köpfen, sowie für Tiere und Figuren verwendet.
Sprünge oder feine Risse in der polychromen Fassung von Figuren oder auf der Farbschicht von Gemälden. Sie entstehen beim Zusammenziehen der Farbe durch Austrocknen (zu niedrige Luftfeuchtigkeit) und durch die Unterschiedlichkeit der Dehnung von Farbe und Holz.