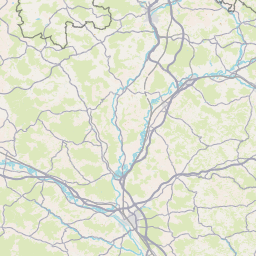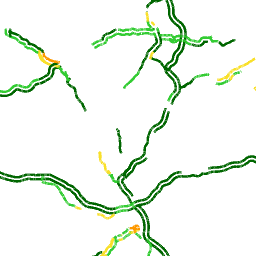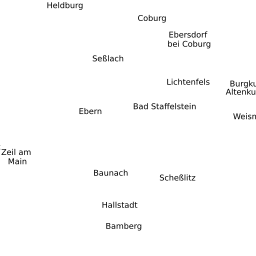Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "D"
Schichtweise verschmiedeter Stahl unterschiedlicher Härteklassen, der die früher höchst mögliche Elastizität des Werkstückes erreichte. Durch Verwinden und erneutes Zusammenschmieden, anschließende Politur und Ätzung konnten an der Oberfläche des Metalls dekorative Muster erzeugt werden.
In der ersten Hälfte des 20. Jhs. Werbefigur – mit Schlafmütze, Nachthemd und tragbarem Kerzenhalter – für ein Abführmittel.
Geböttcherter Krug mit Zinnmontierung. Seit der 2. Hälfte des 17. Jh. wurden aus Holzdauben gefertigte Bierkrüge mit Zinn montiert, d.h. die Dauben wurden durch Zinnreifen fixiert und die Deckel mit Zinn befestigt. Vor allem in Kulmbach wurden im 18. Jh. solche Krüge außerdem noch ornamental und figural intarsiert.
Leichterer Nachfahre des Schwertes. Im Gegensatz zum Säbel besitzt der Degen eine gerade, oft zweischneidige Klinge. Im 19./20. Jh. wurden aber auch leicht gebogene Blankwaffen der Offiziere und Unteroffiziere als Degen bezeichnet.
Wissenschaft von der variierenden Breite der Jahresringe in Hölzern, die zur Datierung benutzt werden können. Die unterschiedlichen Breiten sind eine Folge unterschiedlicher klimatischer Bedingungen von Jahr zu Jahr. Die meisten Nadelhölzer und einige wenige Laubhölzer können auf diese Weise datiert werden. Bestimmt werden kann immer nur das Alter des Holzes, nicht aber das Herstellungsjahr des daraus hergestellten Gegenstandes.
Schießgestell eines Geschützes, bei dem, im Gegensatz zu Feldgeschützen, das Rohr stark nach unten gerichtet werden konnte (speziell zur Verwendung in Wehrbauten).
Andachtsgegenstand, meist geweiht und daher als Sakramentalie anzusprechen. Der Begriff ist erst gute hundert Jahre alt und wird meist verächtlich für billige religiöse Andenkenware gebraucht.
Nachbildungen von Gnadenbildern, die nicht genaue Reproduktionen zu sein brauchen.
Kurze Stichwaffe mit gerader, meist zweischneidiger Klinge und symmetrischem Gefäß (Griff).
Industriell hergestellt erst seit der Jahrhundertwende. Grundlage ist ein Unedelmetall (meist Tombak), auf das eine dünne Schicht aus Edelmetall aufplattiert wird.
Werkzeug der Zinngießer. Damit wurden runde Gußstücke auf der Drehlade gefertigt.
siehe Drehscheibe.
Eine Art Drehbank, auf welcher runde Rohgußstücke mit verschiedenen Dreheisen geglättet wurden. Die Drehlade wurde durch ein großes Antriebsrad in Funktion gesetzt. (Siehe Werkstattabbildung im Artikel "Zinn").
(franz. Vielle) Ein Musikinstrument, dessen Saiten durch ein hölzernes, mit Kolophonium bestrichenes Rad zum Klingen gebracht werden. Der Korpus kann verschiedene Formen aufweisen: Gitarren- oder Lautenform. Auf mittelalterlichen Darstellungen findet sich das Instrument in den Händen von Engeln oder biblischen Figuren. In der Folge zur "Bauernleier" abgestiegen, kommt es in den Schäferidyllen des Rokoko zu neuen Ehren und hält sich bis heute in Frankreich als Volksmusikinstrument.
Kleines Orgelwerk, dessen mit der Hand bewegte Kurbel einen Blasebalg betätigt und eine Walze dreht. Auf dieser Walze finden sich Stifte, die entsprechend ihrer Anordnung den Pfeifen Wind zuführen. Die Walzen und damit die Musikstücke sind häufig austauschbar. Das Instrument wurde im 18. Jh. zu kirchenmusikalischen Zwecken, später dann vor allem von Straßenmusikanten verwendet. Bekannte Hersteller in Deutschland waren u.a. die Firmen 'Bacigaluppo' in Berlin und 'Bruder' im Schwarzwald. Größere, zumeist spätere Instrumente benutzen gelochte Papierstreifen zur Steuerung der Ventile für die Pfeifen. Sie weisen dann mehrere Register (Sätze von Pfeifen gleicher Klangfarbe) auf und werden z.B. durch einen Elektromotor angetrieben.
Zum Formen runder Geschirre eignete sich am besten das Drehen auf Töpferscheiben. Gießverfahren spielen erst in der Spätzeit, etwa ab der 2. Hälfte des 19. Jhs. eine zunehmende Rolle.
Kleeblattartiger Grundriss aus Chor- und Querhausarmen mit Zentralraumwirkung.
Ein Kreuz, an das Christus mit drei Nägeln angenagelt ist. Hierbei sind die Füße übereinander gelegt und mit nur einem Nagel ans Kreuz geschlagen.
siehe Platine.
Bei ihr durchschnitten geschickte Arbeiterinnen die weiche Tonmasse vor dem Brand mit feinen Messern, so dass fragile Geschirre von dekorativer Wirkung entstanden.
siehe Serigraphie oder Siebdruck.