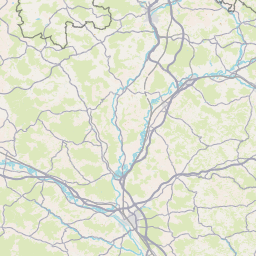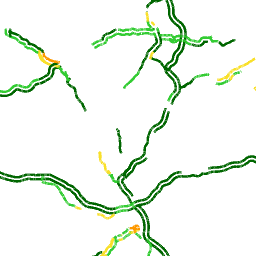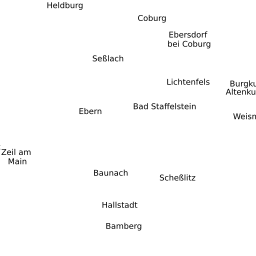Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "F"
Er erhält seinen Charakter durch eine Vielzahl kleiner Flächen, die Facetten. Er wird vornehmlich bei durchsichtigen Edel- und Schmucksteinen angewendet.
Holzblasinstrument tiefer Stimmlage. Die Tonerzeugung geschieht mittels eines Doppelrohrblattes, das der Spieler in den Mund nimmt und durch Blasen einen Kang erzeugt. Die Tonhöhen werden durch Klappen reguliert. Verwendet wird das Fagott in der Kammer- und Orchestermusik. Man unterschiedet das französische und das deutsche Modell. Letzteres hat sich weitestgehend durchgesetzt. Entscheidend dazu beigetragen haben die hervorragenden Instrumente der Fa. Heckel in Biebrich bei Wiesbaden.
Fotomechanisch hergestellter, einem Originalabzug täuschend ähnlicher Bildnachdruck.
Eine naturwissenschaftlichen Methode zur Analyse der chemischen Zusammensetzung von Farben. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die Entstehungszeit der Farben und damit des Gemäldes machen. Da früher die Farben von Künstlern oft (nach geheimgehaltenen Rezepturen) selbst hergestellt wurden, können mit der Farbanalyse sogar einzelne Maler identifiziert werden.
Der Farbauftrag auf das Gefäß oder die Figur erfolgt bei der Fayence und beim Porzellan üblicherweise mit dem Pinsel. Die Farben werden mit Wasser und gelegentlich mit Bindemitteln angerieben und aufgemalt. Beim Schmelzen sinken die Farben bei der Inglasur-Technik in die Glasur ein. Bei der Aufglasur-Technik sind Anreibungen der Farbstoffe mit einem flüchtigen Öl üblich, häufig Terpentin, die das Haften der ungebrannten Malerei auf der wasserabstoßenden Glasuroberfläche begünstigen. Beim Brand verglühen die organischen Bindemittel und es kommt unter leichten Versinterungserscheinungen zur Bindung der Farbkörper an die eigentliche Glasur. Die Haftung ist geringer als bei der Inglasur-Technik und die Malschicht ist durch Abrieb, Kratzen etc. deutlich gefährdet. Die Motive können mit dem Malhorn (Irdenware) oder dem Pinsel entweder freihand gemalt werden. Oder sie werden mit Hilfe von fein gelochten Schablonenmustern (Pergament, Papier, Zinn- und Bleifolien), aufgestäubtem Holzkohlepulver und dem Ausmalen der Konturen ausgeführt. In der Spätzeit setzen sich grobe, wenig strukturierte Schablonendekore durch, die in einfacher Weise mit dem Pinsel gefüllt werden. Eine flächige Färbung ist oberflächlich mit dem Pinsel oder Schwamm oder durch Spritzen mit einem Pinsel (Jaspieren) möglich.
Ein vom Bildhauer beauftragter Handwerker, der die Figuren "fasst", d.h. farbig behandelt oder vergoldet.
Behandlung der Oberfläche einer Holzfigur mit Farbe und/oder Vergoldung. Dabei wird das Holz vor der Bemalung oder Vergoldung mit einem Kreide- oder Gipsgrund (oder an besonderen Stellen auch mit Leinwand) überzogen, damit sich eine möglichst glatte Oberfläche ergibt.
Kurze, kleine Feuerwaffe mit geringer Reichweite, die mit einer Hand bedient wird.
Gehärtetes Stahlband, das aufgewunden (aufgezogen) wird und die Antriebsenergie für die Uhr liefert.
siehe Uhrwerkantrieb.
Wird nach der Beschaffenheit seines Scherbens zwischen Steinzeug und Porzellan eingeordnet. Die Masse weist einen hohen Quarzanteil auf; der weiße Scherben ist durch Sinterung dicht, aber nicht transparent.
Meist mit Silber- oder Goldfäden gewebter Gürtel der Offiziersuniform.
Siehe Goldamalgam. Wird zum Verdampfen des Quecksilbers im oder über dem Feuer hoch erwärmt, zurück bleibt eine Schicht reinen Goldes. Heute nicht mehr üblich, wegen der enormen gesundheitlichen Belastungen des Vergolders. Ältestes Verfahren zur Oberflächenveredelung metallischer Gegenstände mit Gold. Bereits die alten Ägypter, aber auch die Etrusker benutzten diese Technik, bei welcher der zu vergoldende Gegenstand in eine Schmelze von einem Teil Gold auf zwei Teile Quecksilber getaucht und nach dem Abtropfen erhitzt wird. Bei der Erhitzung verdampft das Quecksilber. Durch mehrmalige Wiederholung bildet sich eine gut haftende und immer stärker werdende Goldauflage.
Ölgemälde werden nach ihrer Vollendung mit einem luftabschließenden durchsichtigen Firnis (Lösung von Weichharzen wie Dammar, Mastix oder dgl. in rektifiziertem Terpentinöl) überzogen. Er schützt die Farben und verleiht dem Bild seine abschließende optische Wirkung. Firnis verändert sich im Laufe der Zeit, er kann z.B. vergilben.
In das Holz eines Waffengriffes eingeschnittenes Rautenmuster. Es ermöglichte den sicheren Halt der Waffe.
Lithographie oder Steindruck; heute auch Anwendung von Offsetdruckverfahren mit zum Teil photomechanischen Übertragungen, wenn dies in der künstlerischen Absicht des Urhebers der Graphik liegt.
Auch "Wackeln" genannt, war eine weitverbreitete Art des Zinn-Gravierens. Dabei wird das Motiv mit dem Grabstichel nicht geradlinig, sondern in einer Zick-Zack-Linie ausgeführt und erzielt so eine dekorativere Wirkung.
Lange Feuerwaffe mit glattem Lauf, meist zum Verschießen von Schrot.
Ein kleines orgelähnliches Musikinstrument mit hölzernen Pfeifen. Diese bekommen ihren Wind über Ventile, die zumeist durch eine Walze mit Stiften betätigt werden. Angetrieben werden Flötenwerke durch Federwerke (Uhrwerke) oder Gewichte in einem Gehäuse. In manchen Fällen sind Flötenwerke Teile einer Uhr und werden von dieser zu bestimmten Stunden zum Klingen gebracht. Beliebt im ausgehenden 18. Jh. und im Biedermeier. Vgl. auch Drehorgel und Vogelorgel.
Gotisches Schreinretabel mit auf- und zuklappbaren Seitenteilen.
Zusatzstoff, der die Schmelztemperatur eines Gemischs herabsetzt. Für die Herstellung von Glasuren auf Keramiken wurden bis weit in das 19. Jh. fast nur Bleierze und Bleioxide verwendet.
Um den Glanz der Steine zu steigern, um farbliche Effekte zu erreichen oder um eine schlechte Farbe zu verbessern, hinterlegte man die geschlossenen Fassungen mit Silber bzw. Farbfolien und fasste darüber die Diamanten. Im 17. Jh. war die Folie oft schwarz, im 18. Jh. silbern, rot, rosa oder grün.
Farbige, deckende Untergründe auf Porzellan, aus denen häufig weiße Reserven mit Malereien ausgespart sind.
Die Herstellung von keramischen Gefäßen oder Plastiken ist mit vielen Techniken möglich. Das freie Aufbauen aus Tonplatten und -wülsten war bis zum 12./13. Jh. weithin üblich und wird bei figürlichen Formen bis heute bevorzugt. Viele Objekte wurden aber auch völlig frei und nur mit Hilfe der "kleinen" Werkzeuge hergestellt. Nach dem "lederhart" Trocknen wurden weitere Teile, z.B. Ausgüsse, Henkel, Füße und Verzierungen mit aufgeschlämmtem, feinem Ton (= Schlicker) angeklebt. Neben den Geräten für das Grobe, z.B. Walzen, Pochen, Glasurmühlen oder Trockengestellen, sind unverzichtbare kleinere Werkzeugen zu erwähnen: die "Töpferschienen" als wichtigstes Handwerkszeug beim Drehen selbst, Modellierwerkzeug für plastische Ausformungen und Abschneidedrähte, um fertige Gefäße vom Drehscheibenkopf zu trennen. Vgl. auch Vervielfältigen und Matrizen.
Ein präparierter Metallgrund wird belichtet, die belichteten Stellen werden weggeätzt. Wird auf dem Grund eine Signatur belichtet, ist nur unter einer starken Lupe erkennbar, dass Konturen bei der Ätzung nicht so scharf sind wie bei einer Gravur.
Entfernung von späteren Fassungen, so dass das ursprüngliche Erscheinungsbild der Figuren wieder zutage tritt, entweder in Gestalt der ersten, originalen Fassung oder in Form einer holzsichtigen Oberfläche.
Hier wird die Malerei auf den frischen (ital. = a fresco), noch feuchten Kalkanstrich an der Wand ausgeführt.
Unechtes Porzellan ohne erdige (Kaolin) Bestandteile. Quarzsand, Salpeter, Seesalz, Soda, Alaun und Gips werden gebrannt, zerstoßen und mit grüner Seife und kochendem Wasser zu einer Masse verarbeitet, die der Porzellanmasse ähnelt und ebenso gebrannt wird.
Verkleidung eines Möbelstückes aus einfachem Holz (Weichholz) durch ca. 3. mm starke Holzplatten aus Edelhölzern. Die Furnierblätter werden aufgeleimt und anschließend poliert. Dekorative Effekte entstehen durch regelmäßige Anordnung der aufgeleimten Blätter und spezielle Schnittführung durch den Baumstamm beim Zuschneiden der Furniere.