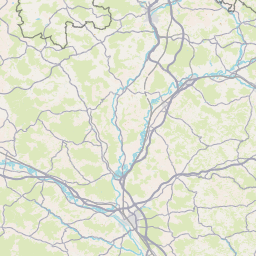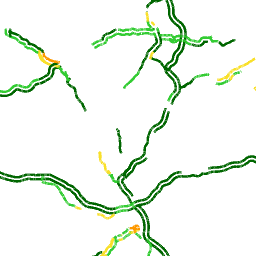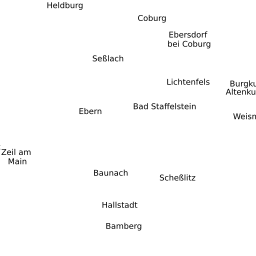Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "G"
Überziehen eines Gegenstandes mit einer Silber- oder Goldschicht mittels Elektrolyse. Patent 1840 von G. Richards und H. Elkington in Birmingham. Nutzung auch für Kopien von alten Meisterwerken.
Die Zeiger einer Uhr waren häufig auch Zierde, aus Stahl ausgeschnitten, manchmal graviert und gelegentlich sogar mit einem Diamanten besetzt. Das Bläuen bzw. Anlassen des Stahls geschieht durch seine Erhitzung auf ca. 300°C und durch anschließendes Abschrecken in Lein- oder Rapsöl, wobei eine dünne Oxidschicht gebildet wird.
Der Griff von Blankwaffen (vom Wort "fassen").
siehe Violine.
Harze heimischer Nadelbäume, denen durch Erhitzen und/oder Destillation die flüchtigen Bestandteile weitestgehend entzogen wurden. Das Harz wird auf die Haare des Bogens von Streichinstrumenten aufgestrichen und bewirkt durch seine Klebrigkeit, dass die Saite mit der Bewegung des Bogens mitgeführt wird, dann den Kontakt verliert, erneut mitgeführt wird usw. Die entstehenden periodischen Schwingungen werden als Ton wahrgenommen.
Dies ist eine Mixtur aus Facetten- und Glattschliff.
Schnitztechnik, bei der auf eine Glättung der Oberfläche verzichtet wird und statt dessen die schnelle Arbeit des Schnitzmessers mit zahllosen kleinen, konkav-sphärisch gekrümmten, sich zu einem dichten Netz zusammenschließenden Flächen verdeutlicht wird.
Auch Sittenmalerei genannt, zeigt typische Szenen des alltäglichen Lebens. Dabei ist zu unterscheiden zwischen bäuerlichen, bürgerlichen und höfischen Genres, mitunter mit religiösen und historischen Inhalten (z.B. Soldatengenre).
Feuerwaffenläufe, die innen leicht schraubenartig ausgebohrt sind, wodurch das Geschoss sich nach Verlassen des Laufes um seine Längsachse dreht. Erhöht die Treffgenauigkeit.
Gieß- bzw. Malhorn.
Kleiner, mehrarmiger Kandelaber. Der Schaft mit Fuß konnte – nach Abnehmen der mehrflammigen Krone – auch als Kerzenhalter für nur eine Kerze verwendet werden.
Gegen 1830 in Meißen erfunden, enthält die Glanzvergoldung nur 10-15% Gold und ist einfacher und billiger in der Verarbeitung.
Glasgefäße werden mittels rotierender Scheiben oder Räder unter Zusatz eines körnigen Schleifmittels veredelt. Im Anschluss an den Schliff werden die Gläser poliert. Für den Schliff gibt es ein reiches Repertoire an verschiedenen Mustern.
Glasgefäße werden ähnlich wie Edelsteine mit Kupferrad und Schmirgel bearbeitet. Man unterscheidet zwischen Tief- und Hochschnitt. Die höchste Vollendung des Glasschnittes wurde in der Barockzeit erreicht.
Glasartiger Überzug, der Keramiken eine glänzende Oberfläche verleiht und das Eindringen von Flüssigkeit in poröse Scherben verhindert. Es gibt durchsichtig transparente, sowie undurchsichtig opake Glasuren. Durch Farbzusätze erhält man Farbglasuren. Generell kann man bei den malerischen Dekorverfahren auf Fayence und Porzellan zwischen Unterglasur, Inglasur und Aufglasur unterscheiden. Vereinzelt tritt außerdem die Technik der weniger haltbaren Kaltbemalung auf (z.B. im mittelfränkischen Schrezheim: Gold und Rot gemalte Motive auf gelbem oder taubenblauem Grund).
Zweiter Brand bei Irdenware, Fayencen und Steingut nach dem Schrühbrand.
Man unterscheidet zwischen der Veredelung des Glases im viskosen Zustand und der bei bereits erkaltetem Glas. Zur ersten Variante zählen die reine Formgebung, die plastische Fadenauflage, gekämmte Dekore, Fadengläser, Marmorierungen, Überfanggläser sowie Eisgläser. Bei der zweiten Variante handelt es sich entweder um abtragende Verfahren (Glasschliff, Glasschnitt, Ätzen) oder um auftragende Verfahren (Emaillebemalung, Edelmetallmalerei, mechanische Farbaufträge, Irisierung, Kaltmalerei, Zwischengoldtechnik).
siehe Glasurbrand.
Der Glattschliff kann plan (eben) oder "mugelig" (gewölbt) als sog. Cabochon oder als Kugel ausgeführt werden. Keine Facetten unterbrechen die gleichmäßige Steinfläche. Er wird meist bei undurchsichtigen Edel- und Schmucksteinen angewendet.
Legierung (Mischung) aus Kupfer und Zinn (heute allgemein als Bronze bezeichnet), bei der für Glocken durch ein unterschiedliches Mischungsverhältnis der Klang mitbestimmt werden konnte. Messing hingegen ist eine Legierung aus Kupfer und Zink.
Kessel- oder kugelförmiger Kochtopf auf drei Beinen, der aus Glockenbronze gefertigt wurde.
Auch Wallfahrtsbild genannt. Ein Bild oder Bildwerk, das Christus oder Maria darstellt und das wegen einer ihm zugeschriebenen Wirkung an Wallfahrtsorten besonders verehrt wird.
Verzieren von Metallgefäßen (Silber, Zinn u.ä.) durch Austreiben geschweifter Kanneluren. Dieses so genannte Repoussieren von Zinn war im 18. Jh. in Süddeutschland besonders beliebt.
Legierung aus Gold und Quecksilber. Wurde gerne als Rohmaterial zur einfachen Herstellung von Vergoldungen verwendet (Feuervergoldung).
Mittelalterliche Hintergrundgestaltung der Tafelmalerei von Heiligendarstellungen.
Zartrosa bis dunkelrotes Glas, das mit kolloidalem Gold gefärbt wurde: Hierbei wird die Glasmasse mit Pudergold versehen.
Ähnlich der Pastellmalerei. Deckende Wasserfarben werden mit Weiß, z.B. Kreide, vermischt und mit einem harzigen Bindemittel (Gummi arabicum) versetzt. Diese Technik wurde häufig für die Porträtmalerei verwendet.
siehe Gouache.
Auch Hakengang genannt, von George Graham (1673 London - 1751) erfunden, die die Ganggenauigkeit der Uhren verbesserte.
Verzierungstechnik durch Aufschmelzen von Metallkügelchen auf eine Metallunterlage.
Eine Darstellung wird in Metall, Stein oder Elfenbein eingetieft.
Familie von italienischen Geigenbauern in Cremona, Mantua und Venedig. Die bekanntesten sind Andrea G. (Cremona 1626 -1698), Pietro Giovanni G. (geb. Cremona 1655, gest. Mantua 1720), Giuseppe Giovanni Battista G. (Cremona 1666-1739/40), Pietro G. (geb. Cremona 1695, gest. Venedig 1762) und Giuseppe G. ("del Gesù", Cremona 1698 - 1744). Zusammen mit den Instrumenten der Familien Amati und Stradivari gehören sie zu den gesuchtesten Violinen überhaupt. Sie erzielen heute teilweise Preise von bis zu einer Million Euro. Zahlreich sind Nachahmungen von teils hervorragender Qualität oder Fälschungen der Etiketten bei schlichten Serienprodukten.
Maschinelles Gravieren von regelmäßigen, verschlungenen Linien (franz. Guillochen).
Nahtwülste, die sich beim Gießen von Metall, Masse, Porzellan, Papiermaché etc. an den Verbindungsstellen mehrteiliger Gussformen bilden und vor der weiteren Verarbeitung durch Abschleifen entfernt werden müssen.