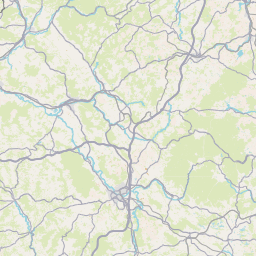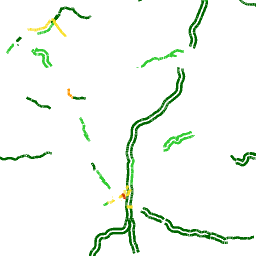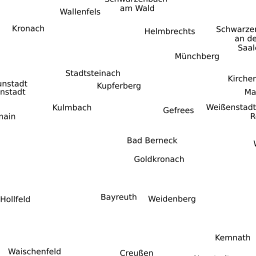Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "H"
Bis ins 17. Jh. bestehende, meist von zwei Mann zu bedienende Feuerwaffenklasse zwischen den Geschützen und den Handfeuerwaffen (Gewehr und Pistole). Der Name stammt von dem an der Laufunterseite angebrachten Haken, der notwendig war, um den sehr starken Rückstoß der, von einer Mauer oder einem Holzgestell gehaltenen, Waffe aufzufangen.
Feuerwaffenklasse unter den Geschützen. Waffe, die von einem Schützen alleine zu bedienen ist.
Alte Fachbezeichnung für Halte- oder Bedienungsgriffe an Waffen und Geräten.
Rahmenartiges Zupfinstrument, erstmals verwendet durch die Troubadoure und häufig in der Volksmusik. Noch heute wird sie in der alpenländischen Volksmusik eingesetzt. Mit der Erfindung von Pedalen zur Verstimmung der Saiten um einen bzw. zwei Halbtöne findet die Harfe im 18. Jh. Eingang in die konzertante Musik.
Der Namensgeber dieser Truppe waren die "Archibusiere" des 16. Jh., also ursprüngliche Bogenschützen (ital. "Arciere" = Bogenschütze, auch Leibwächter). Die mundartlich gewachsene Bezeichnung "Hartschiere" geht auf diesen Ursprung zurück.
Eine kleine, für die Hauskapelle oder den Herrgottswinkel bestimmte Figur der Hl. Muttergottes (mit/ohne Kind, verschiedene Darstellungen möglich).
Selbständige Kunsthandwerker, die zunächst Gläser, Emaille und Fayencen bemalten, seit dem späten 17. Jh. auch Chinaporzellan und nach seiner Erfindung auch europäisches Porzellan. Dazu bezogen die Fayence- und Porzellan-Hausmaler so genannte Weißware, also unbemaltes Porzellan von den Manufakturen. Neben Erzeugnissen mit einfacher und naiver Malerei – was zu Bezeichnungen wie „Pfuscher“, Stümpfer oder „Stimpler“ führte – vollbrachten bekannte Hausmaler künstlerische Meisterleistungen.
Funktionsbegriff für religiösen Wandschmuck des späten 19. Jhs. mit frommen Wünschen oder Schutzpatronen.
Familie von Holzblasinstrumentenmachern in Biebrich bei Wiesbaden. Zusammen mit dem Fagottisten Almenraeder (gest. 1843) entwickelte Johann Adam H. das Deutsche Fagott, das in der Folge weitere Verbesserungen durch die Firma Heckel erfuhr. Heckelfagotte sind gesuchte Orchester- und Kammermusikinstrumente.
Dargestellt ist die Heilige Familie, die aus Jerusalem zurückkehrt. Die Eltern Maria und Josef halten Jesus an den Händen bzw. Handgelenken fest. Über dieser Gruppe erscheint Gottvater mit dem Hl. Geist (Taube). Vereinzelt findet sich dieses Motiv im 18. Jh. Im 19. Jh. hingegen wird es sehr häufig dargestellt. Dieses Thema läßt sich auch vertikal lesen: als himmlische Dreifaltigkeit mit Jesus, Gottvater und dem Hl. Geist oder in der horizontalen Ebene als irdische Dreifaltigkeit mit Josef, Jesus und Maria.
Lange Stangenwaffe, die eine Beilklinge, eine Lanzenspitze und eine Art Enterhaken vereinigte. Seit dem 14. Jh. ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung von bäuerlichen und städtischen Heeren, bis fast ins 19. Jh. als Rangabzeichen für Unteroffiziere verwendet. Das Wort bezeichnet ursprünglich ein Beil (Barte), das sich auf einem Stab (Halm, vgl. Grashalm) befindet.
Schutzbedeckung für den Kopf. Früher teilweise so reich verziert, dass die Schutzfunktion zugunsten der reinen Repräsentation zurücktrat.
siehe Hellebarde.
Hinterglasbilder haben eine sehr alte Tradition. Es entwickelten sich im späten 18. Jh. von Augsburg ausgehend richtige Industrien, speziell in den Gegenden um die großen Glashütten wie Böhmen und z.B. Sandl (Oberösterreich). Die Hinterglasbilder wurden über sogenannte Wanderhändler vertrieben, so dass diese sogar nachweislich bis in den Balkan kamen. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn man in diesen Gegenden noch heute kostbare Originale des 18. u. 19. Jh. vorfindet. Bei den Hinterglasbildern muss seitenverkehrt gearbeitet werden. Die Glanzfarben werden vor den Mattfarben aufgetragen. Durch Vergolden und Versilbern sowie durch Hinterlegen mit Metallfolie wird die irisierende Wirkung noch gesteigert.
Entsteht durch Farbauftrag direkt auf die Rückseite einer Glasscheibe.
Feuerwaffe, bei der das Geschoss und die Treibladung von hinten in den Lauf geführt wird, um die Schussfolge zu beschleunigen. Obschon bereits seit dem 15. Jh. immer wieder Versuche gemacht wurden, Hinterlader zu konstruieren, gelang dies in technisch befriedigender Form erst im 19. Jh.
Blankwaffe, die bei der Jagd u.a. dazu diente, dem getroffenen Wild den Gnadenstoß zu versetzen.
siehe Holzschnitt.
Darstellungen auf der Gefäßwandung entstehen durch Abarbeiten der sie umgebenden Flächen. Sie stehen dann erhaben auf der Glaswandung.
Malereien von Johann Gregor Hörold (1696 Jena - 1775 Meissen) oder in seinem Stil. Er schuf einen besonderen Typ von Chinoiserien, außerdem Hafen- und Kampfszenen sowie Landschaften auf Meissner Porzellan.
Hochdruckverfahren. Für den Holzschnitt werden Holzbretter oder Platten verwendet, auf die die Zeichnung übertragen wird. Das Verfahren ist mit dem Linolschnitt identisch. Die Stellen, die in der fertigen Graphik nicht aufscheinen sollen, werden weggeschnitten. Von den stehengebliebenen, erhöhten Partien der Darstellung, auf die Druckfarbe aufgetragen wird, erfolgen dann die meist von Hand vorgenommenen Abzüge.
Eigenwillig naive Kinderfiguren von Bertha Hummel, in den dreißiger Jahren entworfen und von der Porzellanfabrik W. Goebel in Porzellan ausgeführt. Frühe Erzeugnisse sind heute beliebte und vor allem in den USA hochbezahlte Sammelobjekte.
Völlig undurchsichtiges farbiges Glas, meist in den Farben Schwarz und Rot. Es wird häufig mit Goldmalerei dekoriert oder zu Lithyalinglas weiterverarbeitet.