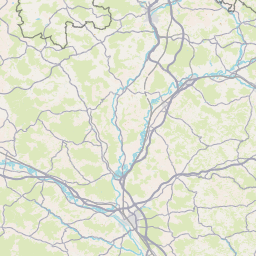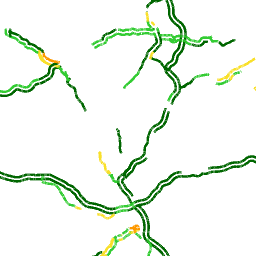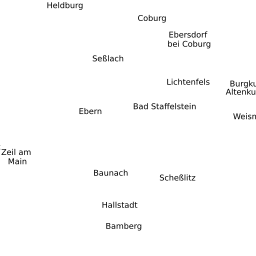Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "K"
Zierschrank, der zur Aufbewahrung von Kostbarkeiten und Schreibgerät diente. Entwickelt hat sich dieser Möbeltypus im 16. Jahrhundert.
siehe Kaltmalerei.
Streng genommen ist die kalte Bemalung keine keramische Maltechnik, sondern erfolgt mittels Lackfarben auf das keramische Endprodukt.
Zum Unterschied von der Ätzradierung wird bei der Kaltnadelradierung direkt mit einem Stichel in die Platte gezeichnet. Entlang der gezeichneten Linien entsteht ein Grat (im Prinzip mit einer Furche im Acker vergleichbar), der sich bei nichtverstählten Platten von Druck zu Druck abschwächt. Das Verfahren ist analog zu oben. Die eingeritzten Partien nehmen die Farbe auf, die unbezeichneten, flächigen Stellen werden mit einem Tuch ausgewischt, so dass anschließend der Druck erfolgen kann.
Senkrechte Auskehlungen an Säulen und Pfeilern, aneinanderstoßend oder durch Stege getrennt.
Das Ausfassen eines größeren Mittelsteines mit umgebenden kleineren Steinen, meist Brillanten oder Perlen.
Ein Schmuckelement in der Architektur und im Möbelbau. Das Karnies zeigt ein s-förmiges Profil, bestehend aus konvexem Stab und konkaver Kehle. Es wird auch als Glockenleiste bezeichnet.
Schildartige Umrahmung für Inschriften, Wappen oder bildliche Szenen.
Krippe in einem Gehäuse. Fest installiertes und darum meist wie ein Bauchladen transportier- und vorführbares Krippenarrangement.
Haubenartig mit Griff oder langem Stiel zum Löschen von Kerzen bei Kandelabern, Lüstern oder Altarleuchtern. Gehört zusammen mit einer Dochtschere zum Zubehör bei speziellen, vorwiegend englischen Tellerleuchtern.
Winzige Perlchen, auch Mohnsamenperlen genannt. Sie sind ein Zufallsprodukt, das bei der Salzwasserzucht mit gebildet werden kann.
Holzblasinstrument mit einfachem Rohrblatt. Hervorgegangen aus dem Chalumeau, wurde sie erstmalig von Johann Christoph Denner in Nürnberg im frühen 18. Jh. konstruiert. Seither in der Kunst-, Volks- und Militärmusik vielfach verwendet. Die Klarinette ist ein transponierendes Instrument: wird beispielsweise die Note C gegriffen und geblasen, so erklingt der Ton B ("B-Klarinette"). Es gibt A-, B-, C- und Es-Klarinetten sowie tiefere Klarinetten (Basset-, Bassklarinette); die meistverwendete Größe ist die der B-Klarinette. Zum Nürnberger Instrumentenbau vgl. Blockflöte.
Nach dem Rauhschleifen, meist an Eisenscheiben mit nassem Quarzsand, erfolgt das Klarschleifen ("Doucieren") mittels einer Steinscheibe, wozu man nassen Sand, Schmirgel oder Bimsstein benutzt. Anschließend wird das Glas an speziellen Scheiben mit entsprechenden Poliermitteln bearbeitet.
Der Klavierbalken liegt in der Drehorgel über der Walze und tastet sie beim Drehen mit seinen Clavisstiften ab. Dabei wird über die sogenannten Stecher die Information zu den Ventilklappen geleitet, die sich infolgedessen öffnen oder schließen.
Form der Gestaltung von Kreuzbalkenden in drei Rundungen.
Der zum Schneiden, Hauen oder Stechen vorgesehene Teil der Blankwaffe.
Eine prägende Erscheinung religiöser Volkskunst in Österreich, Süddeutschland und Schweiz stellt die Klosterarbeit dar. Die Erscheinungsformen sind sehr unterschiedlich und reichen von gefassten Miniaturen oder Kastenreliquien bis hin zu "Agnus-Dei"-Fassungen. Typisch für Klosterarbeiten ist die Materialvielfalt, aus denen sie gefertigt werden: Draht, vor allem aus Gold- und Silberdraht, Stoff, Papier, Wachs und Pergament. Zu diesen Grundstoffen werden gerne Pailletten (Goldplättchen), Glassteine, Perlen (im 18. Jh. waren es in der Regel sogar echte Flußperlen), Spiegel, Stroh und vieles andere verarbeitet. Ihre Wurzeln hat die Klosterarbeit im Mittelalter, als Reliquienbesitz Macht und Schutz bedeutete. So wurden Reliquien, wie etwa Amulette, in Beuteln oder Kapseln am Leib getragen.
Ein Halbfigurenporträt, das den Dargestellten bis zu den Oberschenkeln zeigt.
Bestimmter ockerbrauner Farbton bei Steinzeug aus dem Rheinland.
Ursprünglich aus mehrfarbigem Band zusammengebundene Rosette, die später auch aus Blech oder Leder hergestellt wurde und die nationalen Farben zeigte. Wurde am Helm oder der Mütze getragen.
Aus Holz oder Metall bestehender, hinterer Teil des Schaftes einer Handfeuerwaffe, der zu deren Handhabung dient.
Geigenharz.
Dankbrief des Konfirmanden für den Paten.
Trageglied aus Holz oder Eisen, das an der Wand befestigt wird. Podest für Figuren, Uhren oder dgl. In Kirchen ist auch ein aus der Mauer vortretender Tragestein gebräuchlich.
Das größte und tiefste Mitglied der Violinfamilie, entwicklungsgeschichtlich allerdings eher aus der Familie der Viola da gamba hervorgegangen. Zumeist vierseitig (Stimmung EE-AA-D-G), auch mit drei oder vier Saiten. Verwendung findet der Kontrabass zur Unterstützung der Bassgruppe in der Kunstmusik, aber auch - zumeist gezupft - in der Volks- und Tanzmusik sowie im Jazz.
Henkellose, niedrige Tasse nach chinesischem Vorbild. Als so genanntes "Türkenkoppchen" oder "Türkenbecher" im 18. Jh. zu Tausenden von deutschen Fayence- und Porzellanmanufakturen in die Türkei geliefert.
Zur Uniform getragener Gürtel der Unteroffiziere und Mannschaften.
Ital. Anrichte; in Österreich übliche Bezeichnung für einen Küchen- oder Esszimmerschrank, der mit einem Glastüren-Aufsatz versehen ist und der Aufbewahrung von Geschirr und Gläsern dient.
Deckelknäufe für Zinnkrüge.
Kindlich-realistisch wirkende Puppen, die nach von Bildhauern gestalteten Modellen gefertigt wurden und im frühen 20. Jh. die bis dahin üblichen, stereotyp damenhaft wirkenden Puppen stark in den Hintergrund drängten. Bekannteste Vertreter dieses Genres waren Käthe Kruse, Marion Kaulitz, Lotte Pritzel, Elena (LENCI) König etc. sowie die Bildhauer Josef Wackerle, A. Lewin Funcke, P. Vogelsanger.
Oberkörperschutz des schweren Reiters, ursprünglich als Rest des ganzen Harnisch nur noch aus Brust- und Rückenstück bestehend, später teilweise nur noch das Bruststück verwendet. In Europa letztmalig im Krieg von 1870/71 eingesetzt.
siehe Tiefdruck. Hier wird die vertiefte Linie mit dem sogenannten Grabstichel in die Platte direkt eingraviert.
In der Mitte des 18. Jhs. in England erfundenes Verfahren, um Kupferstiche mit Porzellanfarben auf das Porzellan zu applizieren und auf diese Weise das Bild zu übertragen.
Köpfe mit Hals, der in einer Halbkugel endet. Daher sind sie sowohl seitlich, als auch nach oben und unten beweglich.
Humpen, auf dessen Gefäßwandung die sieben Kurfürsten (meist zu Pferde) dargestellt sind.
Großen Taschenuhren ähnliche, aber viel schwerer gebaute Uhren in meist wulstförmigen Gehäusen. Sie gehören zu den Reiseuhren. Typisch ist der Tragehenkel, mit dem die Uhr an der Kutsche oder am Sattel festgemacht wurde. Meist sind können sie auch als Wecker dienen.