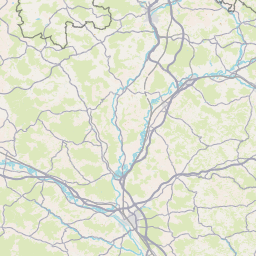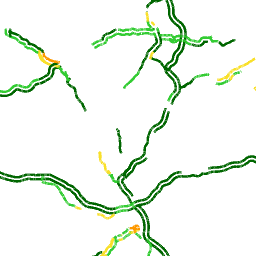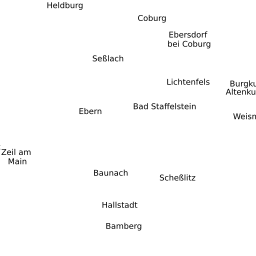Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "M"
Schalenblisterperle: Zuchtschalenperlen in Halbkugelform.
Griechisch = die Rasenden, bei den Römern werden sie Bacchantinnen genannt. Ekstatische Frauen, die zusammen mit den männlichen Satyrn das Gefolge des Gottes Dionysos (römisch: Bacchus) bildeten. Sie waren Teilnehmerinnen des Dionysoszuges und tobten, angeblich mit Schlangen, Dolchen und Thyrsosstäben behangen und unter lautem Geschrei, durch die Wälder, rissen Wild und aßen rohes Fleisch.
Italienische Fayencen (nach der altitalienischen Bezeichnung für Mallorca).
Auch Gießhorn genannt: früher ein Rinderhorn mit geöffneter Spitze. Heute werden entsprechende Gefäße (Gießbüchse) oder Gummibälle verwendet, die oben eine großen Öffnung zum Farbeinfüllen und unten einer feinen Öffnung zum Farbauftrag haben. Damit lassen sich dekorative, rustikale Malereien erzielen.
Mit dem Malhorn hergestellte, ein- und mehrfarbig kontrastierende Dekortechnik; meist auf Irdenware; in Deutschland vom 16. Jahrhundert bis in jüngste Zeit.
Kopf- und Schultertuch der spanischen Damenmode seit der frühen Neuzeit.
(= frz. Ehe, Hochzeit) Im Kunsthändlerjargon versteht man darunter einen aus unterschiedlichen Teilen zusammengefügten Kunstgegenstand.
Auch als Intarsie bezeichnet, meint die Flächenverzierung bei Möbeln. Verschiedenfarbige und -artige Hölzer werden zu Holzplättchen ausgeschnitten und in ornamentalen oder/und figuralen Mustern zusammengesetzt und aufgeklebt.
auch Hammerschlagschliff genannt. Die teils matte, teils polierte Oberfläche des Glases wirkt wie eine von vielen, nebeneinander gesetzten Hammerschlägen überzogene Metalloberfläche.
Aufbereitetes Rohmaterial für die Herstellung von Keramik.
Dreidimensionale Anlage oder "Installation".
Negativformen, die man zum Formen von Keramik benutzt.
Falsche Bezeichnung für einen umgestalteten kleinen Diamanten im sog. "Taille en Seize"-Schliff, einem Schliff, dessen Ausführung auf der geheimnisvollen pythagoreischen Wirkung beruht, die durch die Architektur von Andrea Palladio neu belebt wurde. Es handelt sich hier um einen Tafelstein mit 12 zusätzlichen Facetten.
Kurze Blankwaffe mit gerader oder leicht gekrümmter einschneidiger Klinge und asymmetrischem Griff.
Ein Mosaik, das aus winzigen quaderförmigen Steinen gebildet ist.
Markennamen von Modelliermassen auf Kunstharz- bzw. Zwei-Komponentenbasis, die zur Reparatur und zum Nachgießen alter Mischmassefiguren verwendet werden.
Form der ritterlich-höfischen Dichtung des 12. und 13. Jhs. (Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach u.a.).
Meist Bildhauer und Kunsthandwerker, die als freie Mitarbeiter Modelle liefern oder Unikate modellieren. Als Manufakturmitarbeiter oft mit dem Titel Modellmeister ausgezeichnet, sind sie für die Formgebung von Geschirren und Plastiken verantwortlich.
Eine vertiefte Form, mit der ein Abdruck vorgenommen wird. Beim Gießen werden auch Modeln verwendet.
Im Jahre 1919 begann der Antwerpener Diamantschleifer Tolkowsky, einen Brillantschliff rechnerisch zu ermitteln, bei dem die Proportionen von Ober- zu Unterteil, die Größe der Tafel sowie der Rundiste so gewählt sind, dass ein Optimum an Farbzerlegung erreicht wird. Seit 1938 wird nach diesen Vorgaben geschliffen - man spricht von Diamanten im modernen Brillantschliff.
Haar der Angora-Ziege. Wurde zur Herstellung von Puppenperücken verwendet.
Seide, deren Muster durch Lichtreflexe changiert.
Auch Millefioriglas genannt (= ital.: Tausendblumenglas). Dünne, verschiedenfarbige Glasstäbe werden so gebündelt, dass der Querschnitt wie eine Blume aussieht. Nach dem Zusammenschmelzen wird dieser "Blumenglasstab" in Scheiben geschnitten. Die einzelnen Scheiben werden dann in eine Form gelegt, und mit farblosem Glas umschmolzen. Die Technik lässt sich bis 1800 v. Chr. (Ägypten) zurückverfolgen.
Aufglasurfarben, die keine hohen Temperaturen vertragen und daher in einem dritten Brand im Muffelofen bei ca. 600 bis 900°C fixiert werden. Im Gegensatz zu den Scharffeuerfarben lassen sie sich nuancenreich verarbeiten. Da sie über der Glasur liegen, sind sie empfindlich gegenüber Abnützung und Kratzern.
Ofen für den Brand von auf die Glasur gemalten Muffelfarben. Die bemalten Objekte werden in einem Hohlraum, geschützt vor dem direkten Feuer bzw. der Flammenatmosphäre, gebrannt.
Oberer Beschlag, durch den die Blankwaffenklinge in die Scheide geschoben wird.
Seit dem letzten Drittel des 19. Jh. von Zinngießereien publizierte, illustrierte Verkaufskataloge.