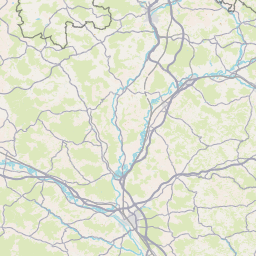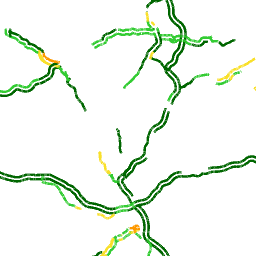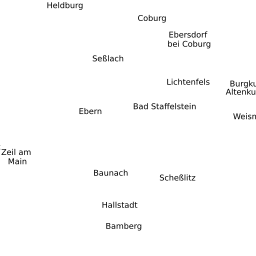Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "P"
Umhang
Schwere Blankwaffe des Reiters, dem Degen verwandt.
Wachsfigurenkabinett der Jahrmärkte.
Wurden vorwiegend für französische Bébé-Puppen verwendet. Sie waren zeitaufwendig und schwierig herzustellen, hatten aber eine sehr schöne Tiefenwirkung, ähnlich der "paperweights". Gemeint sind die dekorativen, kugelförmigen Glasbriefbeschwerer.
Stickerei auf gelochter Pappe.
Mischung aus Papier, Knochenleim, Kreide und Sand. Papiermaché lässt sich leicht in Formen pressen und wird zur Herstellung von Puppenköpfen und -körpern sowie von Tieren und Figuren verwendet.
Ist ein knetbare Masse aus Zellulose (aufgelöstem Papier oder Pappe), Ton, Kreide, Kleister und Farbzusätzen. Pappmaché wird in Schwefelformen gedrückt oder frei geformt (bossiert) und war schon im 18. Jh. bekannt.
Metallstange, angebracht am Übergang von der Klinge zum Gefäß (Griff) einer Blankwaffe, die verhindern sollte, dass ein feindlicher Hieb die Hand des Kämpfers verletzte.
siehe "Ladydoll".
siehe Furnier oder Intarsie, dessen Muster in Parkettform gelegt wurde.
Reliquiar in Kreuzform, das einen eingelassenen Holzspan vom Kreuz Jesu birgt.
Wohl im 15. Jh. in Italien aus dem Speer entwickelte, lange Stangenwaffe. Das Klingenblatt nach hinten zu breiter werdend, trägt an seinen unteren Enden kleine Flügelansätze. Bereits am Beginn der Neuzeit wurde die Partisane von einer reinen Kampfwaffe zu einer Trabanten- oder Paradewaffe.
Im 17. Jh. entstandener Begriff für das Hofkleid mit allen Accessoires. Im 18. Jh. wandelt sich die Bedeutung und meint nun eine Schmuckgarnitur. Mit Parure wird die Kombination aus Collier, Brosche und Ohrringen bezeichnet, während die Demi-Parure nur aus Brosche und Ohrringen besteht.
Abdeckpapierrahmung mit Rückfläche zum Einlegen graphischer Blätter.
Schmaler, hoher Becher, der mit aufgelegten Bändern, zum Teil auch mit Nuppen verziert wurde. Die Bänder dienten als Maße für den Einschank, wobei für Unter- oder Überschreiten Strafen erteilt wurden.
Zwischenstellung zwischen Zeichnung und Malerei. Trockenmalerei, die mit Pastellstiften ausgeführt wird. Pastellbilder lassen sich sehr leicht abreiben, deshalb ist es besser, sie mit Glas gegen Berührung zu schützen.
"Masse-auf-Masse", auch Schlickermalerei genannt. Eine Technik der Porzellanmalerei, bei der reliefartig weiße Porzellanmasse auf den noch porösen Untergrund aufgetragen wird, der nach dem Brennen farbig durchscheint. Entstanden ist diese Technik in China, die Pâte-sur-Pâte-Malerei aber wurde von Louis Robert in Sèvres erfunden. Auf der Weltausstellung in Chicago, 1893, machte die Porzellanmanufaktur Meissen mit ihren Pâte-sur-Pâte-Objekten weltweit Furore.
Durch Oxidation und andere chemische Vorgänge entsteht eine dünne Schicht auf Metalloberflächen und bei Edelmetallen. Diese entsteht durch den Feuchtigkeits-, Kohlendioxid- und Schwefeldioxidgehalt in der Luft. Sie kann auch künstlich durch Behandlung mit verschiedenen chemischen Lösungen herbeigeführt werden. Eine künstliche Patina findet sich bereits in der römischen Antike, als "alte Kunst" sehr gefragt war.
So werden die dickeren Pflanzenstengel lianenartig kletternder Rotang- oder Rattanpalmen bezeichnet. Peddigrohr oder auch Rattan findet bei der Herstellung von Stühlen, kleineren Möbeln, Spazierstöcken und in der Korbwarenindustrie Verwendung.
Pendeloque, eigentlich die Bezeichnung für einen facettierten und in Tropfenform geschliffenen Schmuckstein, kann auch allgemein für einen hängenden Ohrschmuck oder, noch allgemeiner, für ein Gehänge benutzt werden. Der Begriff Pendeloque ist aus dem Französischen "pendule", also Pendel abgeleitet.
Uhr mit schwingendem Pendel. Im heutigen Sprachgebrauch versteht man unter Pendulen meist französische Wand- oder Kommodenuhren mit reich verzierten Gehäusen.
siehe Pendeluhr.
Auch so genanntes "Pariser Pendulenwerk". Stabiles, trommelförmiges Acht-Tage-Uhrwerk mit Schlossscheibenschlagwerk.
Nach Entdeckung der Explosivität von Knallquecksilber eingeführtes Zündsystem, bei dem das langwierige Aufschütten von Pulver auf die Pfanne der Feuerwaffe vermieden werden konnte. Die Perkussionszündung, im frühen 19. Jh. eingeführt, beschleunigte die Schussfolge und führte dadurch im großen Umfang zum Umbau älterer Steinschlosswaffen auf Perkussionszündung.
Der Art ihrer Entstehung unterscheiden wir die natürlich gebildeten echten Perlen und die unter Mithilfe des Menschen erzeugten Zucht- oder Kulturperlen. Natur- und Zuchtperlen können sowohl im Salz- als auch im Süßwasser entstehen.
Ähnlich dem Nuppenglas. Hier wurden Glastropfen in Perlenform auf das Glasgefäß aufgeschmolzen.
Ein kissenförmiger Diamantschliff mit 32 Facetten im Oberteil, dessen Grundriss auf der Oktaederform beruht. Er wurde seit 1690 angewendet und beherrscht den Juwelenschmuck des 18. Jh. Angeblich wurde er von dem Venezianer Vincenzio Peruzzi erfunden. Allerdings hat es in Venedig einen Peruzzi wohl nicht gegeben, allenfalls in Florenz. Der Name selbst wurde im Handel mit Diamanten nie gebraucht. Er geht auf vage Spekulationen zurück, die A. Caire 1813 in seinem Buch "La Science des Pierres Précieuses" über die Herkunft dieses Schliffs anstellte und dabei den besagten Peruzzi erwähnte. Da sich aber der Name im Handel mit historischem Schmuck etabliert hat, wird er bis heute gebraucht.
Sitzende, trauernde Maria mit dem toten Jesus auf ihrem Schoß.
Ein Mosaik aus fugenlos zusammengesetzten Halbedelsteinen oder farbigem Marmor, das in ein Möbelstück eingelegt wird. Die Oberfläche wird anschließend auf Hochglanz poliert. Diese Technik wird für Tischplatten und auch für Kabinettschränke eingesetzt.
Legierung von 10 % Zink und 90% Kupfer, 1720 von Christopher Pinchbeck als Goldersatz erfunden.
Mit dem Pinsel hergestellte ein- oder mehrfarbige Dekortechnik, meist auf Fayence und Porzellan, sehr selten auf Irdenware zu finden.
Kurze Feuerwaffe, die mit einer Hand abzufeuern ist (Faustfeuerwaffe). Im Gegensatz zum Revolver eine Waffe, bei der das Magazin im Griff untergebracht ist.
Platinen sind die Werkplatten der Uhren. Diese werden von Pfeilern in Abstand gehalten und tragen die Bohrungen für die Wellen des Werkes. Großuhren haben eine Vorder- und eine Rückplatine. Diese ist dann häufig mit der Signatur des Uhrmachermeisters graviert. Taschenuhren haben dagegen oft nur eine Bodenplatine. Eine Dreiviertelplatine bedeckt drei Viertel der Fläche des Werkes.
Kleines Plättchen aus Horn, Schildpatt, Kunststoff oder Metall zum Anzupfen der (Metall-)Saiten bei Mandolinen, Zithern u. dgl.
Platte, auf der der untere Teil einer Figur ruht.
Hellster Stern im Sternbild 'Kleiner Bär'. Für einen Beobachter auf der Erde dreht sich der Sternhimmel um den Polarstern (in ca. 23 Stunden und 56 Minuten).
Werkzeug zum Glätten und Polieren. Beim Zinn können mit dem Polierstab – meist aus Achat – besonders feine Oberflächen erzielt werden.
Ein (u.U. aufklappbares und im Winkel verstellbares) Dreieck, dessen schräg verlaufende Kanten den Schatten auf die horizontale Sonnenuhr werfen. Das Polos-Dreieck bildet mit der Basisfläche einen Winkel von 90° minus. Die schattenwerfende Seite zeigt dabei zum Himmelpol, sobald die Sonnenuhr eingenordet ist.
Name verschiedener Typen von mechanischen Musikinstrumenten, insbesonders von Spieldosen mit einer Scheibe. Firmenname der Polyphon Musikwerke in Leipzig, gegründet 1886. Diese Geräte sind in der Regel in einem hölzernen Gehäuse untergebracht, das zugleich als Resonanzverstärker dient. Sie werden seitlich mit einer einsteckbaren Kurbel aufgezogen. Die oben auflegbare, austauschbare Scheibe weist nach unten aufgebogene Schlitze auf. Über eine einfache Mechanik reissen sie die Zungen eines metallenen Kammes an und bringen sie damit zum Klingen. Die Stücke auf den Platten sind in der Regel bekannte Melodien und Schlager der Zeit. Als Sammlerstücke sind Polyphone und ähnliche, mechanische Musik reproduzierenden Geräte begehrt und werden relativ gut bezahlt.
Messingähnliche Legierung, die in Frankreich im 18. Jh. als Goldersatz verwandt wurde.
In der Bildhauerkunst die ausgewogene Verteilung des Körpergewichts einer Figur auf Standbein und Spielbein.
Deutsch Säbelquaste, wörtlich aus dem Französischen übersetzt "trägt den Degen". Am Degen- oder Säbelgefäß befestigtes, langes, gewebtes oder ledernes Band, in einer Eichel oder einer Quaste endend. Diente ursprünglich dazu, die Blankwaffe mit dem Handgelenk zu verbinden und so ihren Verlust zu vermeiden. Später als Rangabzeichen oder als Abzeichen militärischer Einheiten verwendet.
Darstellung eines bestimmten Menschen. Dabei soll seine Individualität zum Ausdruck kommen, d.h. auch seine seelische Erscheinung soll sichtbar werden. Es gibt den Bildniskopf, der mit dem Halsabschnitt endet, das Brustbildnis, die Halbfigur, das Kniestück und die Ganzfigur. Weitere Porträtkategorien sind das Einzelbildnis, Doppelbildnis und Gruppenbildnis.
Um 1770 in Meissen eingeführt, jedoch erst in der 2. Hälfte des 19. Jhs. in größerem Maße angewendetes Verfahren. Dabei wird Baumwoll- oder Leinenspitze bzw. Tüll in Porzellanmasse getaucht, getrocknet und danach gebrannt.
Ein kleines Horn, das von Postillionen und Wachen auf Postkutschen benutzt wurde, um Ankunft und Abfahrt anzukündigen und während der Fahrt Warnsignale zu geben. Posthörner wurden bis ins 20. Jh. hinein verwendet. Auch in die Kunstmusik haben sie Eingang gefunden, u.a. bei Telemann und Bach.
In Zierborten aus Pappe geprägte Muster zur Weiterverarbeitung in und mit Papierbildern.
Unterbau eines Flügelaltars mit gemalten oder geschnitzten Figuren- Szenen.
Figur mit christlicher Thematik, die in der katholischen Kirche bei liturgischen Umgängen mitgetragen wird.
Benannt nach dem amerikanischen Industriellen George Mortimer Pullman, der in den 60er Jahren des 19. Jhs. den ersten Eisenbahnschlafwagen sowie den ersten Durchgangswagen mit reicher Innenausstattung (genannt Pullmanwagen) gebaut hatte. Die sogenannte Pullman-Limousine ist ein geschlossenes Automobil, in dem sich zwischen Lenker und Fahrgastraum eine Trennwand befindet.
Ein Stahlstab zum Einschlagen von Mustern in Metall, Leder oder Holz und deren Abschlagmuster. Schmuck: Beschauzeichen, Stempel, Marke für Zinn, aber auch Edelmetalle, sowie seltener für Gelbguss. Diese in Eisenstempel geschnittenen Meisterzeichen mit individuellen Monogrammen oder Wappen wurden in die fertigen Produkte eingeschlagen (punziert). Sie dienten seinerzeit als Qualitätszeichen und noch heute kann man an Hand von Markenbüchern die Hersteller der punzierten Erzeugnisse nachweisen. Zinn: Beschauzeichen, die der Zinngießer mit dem Punziereisen in seine fertigen Waren - meist an unauffälliger Stelle (Unter- oder Innenseite, Deckel u.ä.) - eingeschlagen hat. Wie der Silber- und Goldschmied garantierte auch der Zinngießer damit den Feingehalt seiner Legierung.
In der Oberfläche der Fassung eingestanzte Muster und Verzierungen.
siehe Punze
Putten (Einzahl: Putto, ital. = kleines Kind) oder Putti sind seit der Renaissance - nach dem Vorbild antiker Eroten - als figurales, künstlerisches Beiwerk (Raffael, Donatello u.a.) in Mode gekommen. Alte Zinnerzeugnisse sind immer wieder mit geflügelten Puttenköpfen ausgeschmückt. Als Füße von Zinnkannen waren sie besonders beliebt.
Nacktes Engelchen mit oder ohne Flügel in Kleinkindgestalt (Mehrzahl Putten oder Putti).