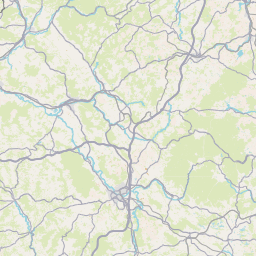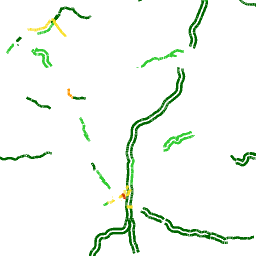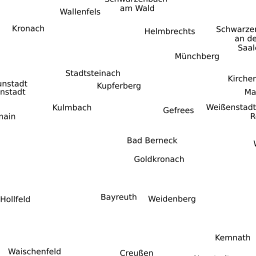Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "R"
Tiefdruckverfahren. Auf eine Metallplatte, meist Kupferplatte, wird eine Wachs- oder Lackschicht aufgetragen. In diese wird mit einer so genannten Radiernadel gezeichnet. Die Platte wird in ein Säurebad gelegt, so dass die mit der Radiernadel freigelegten Stellen in die Platte geätzt, also vertieft werden. Nach dem Einschwärzen und dem Abwischen der Platte ergeben diese vertieften Linien den sichtbaren Druck.
Im Gegensatz zu Sonnen-, Sand- und Wasseruhren (und neuerdings auch Quarzuhren) ist die Räderuhr eine auf Zahnrädern basierende Uhr mit eigener Energiequelle, die mittels des Räderwerks eine lesbare bzw. akustische Zeitangabe ermöglicht.
Im Profil eines Bilderrahmens die innerste Rundung, die am Glas ansetzt und wie ein umlaufendes Stäbchen aussieht, oft andersfarbig hervorgehoben oder schnitzverziert.
In der Biedermeierzeit, besonders in Österreich und im süddeutschen Raum, in großer Anzahl gefertigter Uhrentypus, bei welchem das Werk in einen bilderrahmenähnlichen Rahmen eingefügt ist.
Von lat. "realis","wirklich". Gemeint ist eine Malerei, die der Wirklichkeit nahe kommt.
Pendeluhr mit Temperaturkompensation des Pendels. Im heutigen Sprachgebrauch jedoch Wanduhren der 2. Hälfte des 19. Jhs. und der Jahrhundertwende mit teilweise reich verzierten Gehäusen und einfachen Werken.
Tragaltar oder Portatile mit Reliquieneinlassungen zum Zelebrieren eines Gottesdienstes.
Bezeichnung für sehr unterschiedliche Uhrentypen. Neben Kutschenuhren und Satteluhren werden mitunter auch Tischuhren dazugerechnet. Vor allem sind damit aber Uhren mit meist rechteckigem Gehäuse und Tragehenkeln gemeint. Die frühen Reiseuhren aus dem 18. Jh. besitzen immer ein feuervergoldetes Gehäuse. Ab der Mitte des 19. Jhs. überwiegen dann die Messinggehäuse. Hauptproduzent war Frankreich, in zweiter Linie England. Zu den Reiseuhren gehörte immer ein lederbezogener Holzkoffer für den sicheren Transport.
Relief en creux ist die französische Bezeichnung für "versenktes Relief". Dies bezeichnet ein Relief, das als Tiefschnitt (auch Flachschnitt genannt) in das Trägermaterial hineingearbeitet wurde und es nicht, wie beim "erhabenen Relief", überragt. Beim relief en creux werden die Figuren herausgeschnitzt, der Hintergrund bleibt stehen.
Es handelt sich hier um geschnitzte Holzkreuze vom Typ "Arma Christi", die typisch für das Barock sind und die mit Kreuzbalken und mit Schiebeverschluß ausgeführt sind. Im Kreuzbalken sind Reliquienpartikel eines Heiligen eingelegt, auf den das darüber gelegte Schriftbändchen hinweist. Die Reliquienpartikel sind sog. Berührungsreliquien. Sie entstehen dadurch, dass sie mit einer Originalreliquie in Berührung gebracht wurden und damit deren Wirkkraft auf sie übergegangen ist, so der Glaube. Reliquienkreuze sind im 18./19. Jh. sehr häufig.
Rechenschlagwerk, das nach dem Auslösen - durch das Ziehen einer Schnur oder dem Drücken eines Knopfes - die letzte akustische Zeitangabe wiederholt.
Reliefdekor in Metall durch eine Treibtechnik von innen heraus. Dadurch entstehen verschiedene Arten hervorgehobener Kanneluren: Pfeifen bei geraden und Melonenrippen bei geschweiften Kanneluren.
Steuerstempel bei Einfuhr oder Kontrolle.
Analog zur Gemälderestaurierung ist die handwerklich ausgerichtete Reparatur von der wissenschaftlich begründeten Restaurierung zu unterscheiden. Während Reparatur immer die Wiederherstellung der Spielbarkeit zum Ziel hat, wird bei der Restaurierung älterer Instrumente vorab geklärt, ob sie überhaupt noch spielbar sind. Erst dann werden, je nach Zustand des Instruments, entsprechende Maßnahmen vorgenommen.
Handfeuerwaffe, bei der die Treibladung und das Geschoss sich in einzelnen Bohrungen einer am hinteren Ende des Laufes angebrachten Walze befinden. Seit dem 15./16. Jh. immer wieder gebaut, gelang es erst im 19. Jh. in technisch sicherer Weise die genaue Justierung der Treibladungskammer mit dem Lauf zu erreichen. Revolversysteme wurden sowohl bei Faustfeuerwaffen als auch bei Langfeuerwaffen verwendet.
Schild- oder halbmondförmiges Metallblech mit ornamentaler Auflage (meist Wappen oder Herrschermonogram), das, auf der Brust um den Hals getragen, einen Rest des Halsschutzes, des Plattenharnisch darstellt. Der Ringkragen war bis ins frühe 19. Jh. das Rangabzeichen eines Offiziers, in späterer Zeit auch das eines Fahnenträgers.
In Sèvres von dem Porzellanmaler Xhrouet 1757 erfundene Fondfarbe, die zu Ehren der Marquise de Pompadour auf ihren Namen getauft wurde.
Dieser Schliff wird seit dem 14. Jh. bei flachen Rohsteinen angewendet. Er ahmt die Form einer aufblühenden Rose nach. Erst Mitte der 1940er Jahre wurde er durch den Achtkantschliff (ein runder Schliff mit 28 Facetten plus der Tafel) abgelöst.
Durch den Zusatz von Metalloxiden oder Kupferchlorid und ein anschließendes Wiedererhitzen erhält das Glas einen leuchtend roten Farbton. Deshalb spricht man hier auch von einer Anlauffarbe. Obwohl das Verfahren bereits in der Antike bekannt war, wurde besonders Johannes Kunckel im 17. Jh. für die Herstellung dieses Glases berühmt. Wegen ihrer hohen Wertschätzung wurden Rubingläser häufig in Gold oder Silber gefasst.
Rechenschlagwerk, das nur auf ein Auslösen hin die Zeit durch Schlagen auf eine Glocke oder Tonfeder angibt.
Beim Edelsteinschliff wird so die Kante zwischen Ober- und Unterteil eines Brillanten bezeichnet.