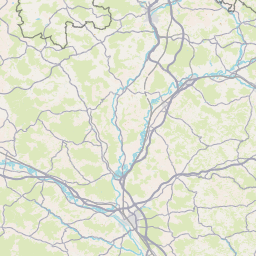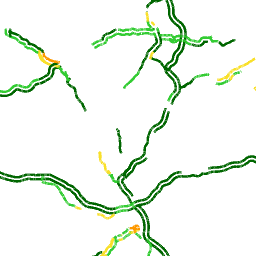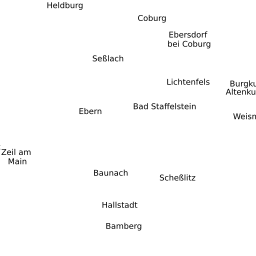Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "S"
Früher nannte man alle Taschenuhren Sackuhren, heute gilt die Bezeichnung nur noch für die frühen Taschenuhren. Sackuhren gibt es seit der 1. Hälfte des 16. Jhs. Entwickelt wurden sie aus den zylindrischen Dosenuhren. Zunächst wurden sie meist an einer Kette um den Hals und erst ab dem 17. Jh. vorwiegend in der Hosentasche getragen. Sie waren immer durch ein Ledersäckchen geschützt.
Lange Blankwaffe mit mehr oder weniger stark gekrümmter Klinge. Aber: Offiziers- oder Unteroffizierswaffen des 19./20. Jh. mit leicht gekrümmter Klinge werden im deutschen Sprachgebrauch als Degen bezeichnet.
Eine Glasur, die während des Brennvorgangs von Steinzeug entsteht, wenn Kochsalz in den Ofen gestreut wird. Es verändert die Oberfläche der Keramik chemisch und bildet einen feinen Belag.
Auch Sammlermarke genannt, mit der ein Sammler seine Objekte kennzeichnet. Beim Sammlerstempel handelt es sich um einen Stempel, wohingegen die Marke auch handschriftlich sein kann. Die Verwendung lässt sich bis ins 17. Jh. zurückverfolgen, wobei die Marken von Graphiken in eigenen Markenbüchern aufgenommen worden sind. Dazu: Lught, F.: Les Marques des Collections des Dessins et d´Estampers. Amsterdam 1921 ff.
siehe Kutschenuhr.
Maske in der Form eines Satyr, eines griechischen Fruchtbarkeitsdämonen, der zu dem Gefolge des Dionysos/Bacchus gehört. Er besitzt Ohren, Hörner, Beine und den Schwanz eines Ziegenbockes. Der Satyr vertritt das männliche Prinzip und wird häufig mit sexueller Zügellosigkeit gleichgesetzt.
Eine Erfindung aus den Jahren zwischen 1838 und 1846. Im Jahre 1846 wurde das Saxophon in Frankreich patentiert. Konstrukteur war Adolphe Sax (geb. Dinant/Belgien 1814, gest. Paris 1894). Das Saxophon besteht aus einer relativ weiten, metallenen, konisch verlaufenden Röhre mit zahlreichen Klappen und einem Mundstück mit einfachem Rohrblatt, ähnlich dem der Klarinette. Gebaut wird es in verschiedenen Größen, darunter dem Sopran-, Alt-, Tenor- und Baßinstrument, die zusammen ein Quartett bilden. Das Saxophon ist wie die Klarinette (sh. dort) ein transponierendes Instrument. Seit seiner Einführung wurde es in vielen Ländern vor allem in der Militärmusik verwendet, kaum aber in Deutschland. In Frankreich fand es Eingang in die Kunstmusik. Seinen eigentlichen Triumph erlebte das Saxophon aber seit den 1920er Jahren vor allem in den USA- im Jazz.
Eine mit Stoff bezogene Draperie vor einem Fenster oder über einem Bettgestell. Schutz- und Zierbehänge von Polstermöbeln werden ebenfalls Schabracken genannt.
Beim Schäleckenschliff, einer besonderen Form der Facettierung, ist die Oberfläche der Facette im Querschnitt leicht gemuldet. Die Facette wirkt also wie aus dem Glas herausgeschält, mit einer mittigen Vertiefung und erhabenen Kanten.
Scharffeuerfarben (Metalloxide) überstehen ohne tiefgreifende Zerstörung ihres typischen Farbcharakters die hohen Temperaturen des Glasurbrandes bei 900 bis 1100°C. Die vier klassischen Scharffeuerfarben sind: Blau (kobalthaltig), Grün (kupferhaltig), Braun bis Violett (mangan- bzw. braunsteinhaltig) und Gelb (antimonhaltig). Farbtechnisch bewertet gibt es keine wirklich rein schwarzen bzw. roten Scharffeuerfarben. Entweder handelt es sich um hoch konzentrierte kobalt-, mangan- und/oder auch eisenhaltige Verbindungen bzw. Mischungen für Schwarz oder um niedriger zu brennende Eisenverbindungen für Rot. Der Vorteil der Scharffeuerfarben besteht in der nicht zu überbietenden Farbbeständigkeit. Farbmischungen sind allerdings nur begrenzt möglich. Bei Fayencen werden sie als Inglasurfarben auf die noch ungebrannte Glasur gemalt und im Glasurbrand fixiert. Beim Porzellan sind sie als Unterglasurfarben im Glasurbrand Temperaturen bis zu 1.400°C ausgesetzt.
Dekorationsware; meist übergroße Gefäße, fast ohne praktischen Nutzen.
Geschirre, die mit modellierten Vegetabilien oder Tieren plastisch dekoriert und naturalistisch bemalt sind, so dass sie in Art des Trompe l´oeil wie angerichtete Speisen oder Blumenarrangements wirken.
Das Zifferblatt besteht aus zwei sich drehenden, hintereinander gesetzten Scheiben, die in der unteren Hälfte durch eine feststehende Zierblende verdeckt sind. Ein kleines Fenster der ersten Drehscheibe lässt die Ziffer der Stundenzahl erkennen. Das Fenster dreht sich entlang einer feststehenden Minutenanzeige am äußeren Rand und zeigt somit die Minuten an.
Aus Holz mit Lederüberzug, aus Leder oder Metall gefertigtes ovales Rohr, das zur Aufnahme der Klinge von Blankwaffen dient.
Ein Naturharz, das nach Anstechen der in Indien und Thailand vorkommenden Lackschildlaus Kerria lacca als Ausscheidung entsteht. Es wird in Alkohol gelöst und trocknet langsam. Wurde 1800 zum Hochglanzpolieren verwendet.
Auch "flirting eyes" genannt. Ein komplizierter Mechanismus lässt eine sehr lebendig wirkende Bewegung der Augen nach allen Seiten zu.
Fachausdruck für gebrannten Ton ohne bestimmte Form und seine verschiedenen, jeweils typischen Eigenschaften (Härte, Dichte, optische Zusammensetzung, Farbe, Porosität etc.).
Pilzbildung, die durch Feuchtigkeit entsteht.
Durch das Schleifen sollen bestimmte Eigenschaften von Diamanten und Farbedelsteinen belebt, zuweilen auch erst hergestellt werden. Dazu zählen Farbe, Transparenz , Lichtfiguren sowie das in den Regenbogenfarben aufleuchtende Feuer. Anfänglich konnte man nur ebene oder leicht gewölbte Flächen herstellen. Edelsteine mit einer höheren Mohshärte als 7 (d.h. Rubine, Saphire, Smaragde oder Granat) konnten erst mit dem Einsatz von Schmirgel, einem Gemenge von feinkörnigem Korund und Magnetit, Hämatit und Quarz, schließlich durch Verwendung von Diamantpulver bearbeitet werden. Zerstoßener Diamant wurde zur Zeit Alexander des Großen (336-323 v. Chr.) von Indien bis in den Vorderen Orient als Schleifmittel exportiert.
Große Zunftkanne mit gravierten Zunftemblemen, Meister- und Gesellennamen. Aus Zinn gefertigte Stücke zählen zu den schönsten Zunftgeräten. Seit dem späten 15. Jh. beim "Schleifen" - einem Brauch beim "Gesellenlossprechen" - in Gebrauch. Solche dekorativen Originale wurden im 19. Jh. häufig nachgemacht und gefälscht.
siehe Altschliff, Brillantschliff, Facettenschliff, Gemischter Schliff, Glattschliff, Mazarinschliff, Moderner Brillantschliff, Peruzzischliff, Rosenschliff, Tafelstein.
siehe Schliffarten.
Relativ kurzes Gewehr, das zur Jagd von einem Schlitten aus benutzt wurde. Auch zur Jagd von Wagen (Kutschen) aus verwendbar, dann als Wagenbüchse bezeichnet.
Der Zündmechanismus bei Vorderladern, bei Hinterladern der Zünd- und Verschlussmechanismus des Laufes.
Malen in die beim Brand schmelzenden Rohglasur.
Diese dienen zum Schmelzen des Gemenges, das sich in Hafen oder Wannen befindet.
Auch Pâte-surpâte, Quarkmalerei und Mary-Gregory-Malerei genannt. Hierbei wird weißes Emaille pastos aufgemalt.
Armbrust zum Verschießen von Kugeln, meist bei der Vogeljagd verwendet.
Nahe des frz. Dorfes Barbizon im Wald von Fontainebleau entstand um 1830 eine Malerkolonie. Hier wurden vor allem kleinformatige Landschaftsbilder (paysage intime) erstmals unter freiem Himmel und nicht im Atelier gemalt.
Ledernes Band mit aufgenähten oder aufgenieteten, sich überlappenden metallenen Schuppen. Sie wurde am Helm anstelle eines Kinnriemens angebracht und am Kürass als Verbindung von Rücken- und Bruststück.
Maria trägt einen weiten, mitunter von Engeln gehaltenen Mantel. Darunter stehen oder knien Gläubige in bittender Haltung. Dieser Marientypus kam im 13. Jh. auf. Maria kann mit oder ohne Jesuskind dargestellt sein.
In Form eines Schwanenhalses geschwungene Feder zur Feinregulierung von Taschenuhren.
Henkeltypus mit einer nach Art eines Schwanenhalses gebogenen Form.
Wurde bereits bei der mittelalterlichen Kirchenfenstermalerei verwendet und geht namentlich auf die Verwendung von Blei zurück. Nach der Mitte des 17. Jhs. von der Glasdekoration in die Fayence- und später in die Porzellan-Malerei übernommen.
Lange Blankwaffe mit gerader, meist zweischneidiger Klinge und symmetrischem Gefäß. Vorsicht: in England bezeichnet "sword" (Schwert) auch unsere Degen. Beliebter Fehler waffenunkundiger Übersetzer ("Offiziersschwert, 20. Jh.").
Kastensitz oder Armlehnenstuhl. Ein Stuhl, bei dem die Seitenteile aus einem geschlossenen Kompartiment gearbeitet sind.
Ersatzbild für verloren gegangenes, älteres Gnadenbild.
Berühungsreliquie, z.B. Holz, das mit einem für authentisch gehaltenen Kreuzpartikel in Berührung gebracht worden ist.
Porzellane der Sung Dynastie (960 - 1280) mit wässrig-lauchgrün glasierter Oberfläche, benannt nach dem Helden des Romans "L’Astrée" von Honoré d’Urfé.
siehe Siebdruck.
Preiswerte feine Irdenware mit aus weißem oder farbigem Ton gebranntem Scherben. Die Dekorierung erfolgt in kalten Lackfarben. Bei Billigwaren wird auf Handmalerei verzichtet und mit Farbdruckbildern (Umdruckdekor) dekoriert.
Der Darstellung entsprechend wird eine Schablone geschnitten (bei einem Farbdruck müssen mehrere, der Anzahl der Farben entsprechende Schablonen angefertigt werden) und auf einem möglichst engmaschigen, feinen Sieb befestigt werden. Diese Übertragung (Befestigung) auf das Sieb erfolgt heute zumeist fotomechanisch. Analog zur künstlerischen Vorlage und Absicht weist jedes Sieb Teile auf, die beim Druck auf den darunterliegenden Farbträger Farbe durchlassen bzw. zurückhalten, so dass die Partien der Unterlage, die nicht zeichnen sollen, weiß bleiben. Der Siebdruck eignet sich besonders gut für den gleichmäßigen Druck von Flächen, für serielle geometrisch-abstrakte Darstellungen, wie sie in der Op-Art und der Konkreten Kunst (Vasarely, Max Bill) üblich waren.
Andere Bezeichnung für Strass.
Bruderschaftsumhängsel aus kleinen Stoffteilen.
siehe Stimmwerk.
Gebogenes Holzprofil zur Formgebung bauchiger Möbelstücke.
Die Atomabsorptions-Spektralanalyse dient zur Untersuchung von Kunstwerken, bei der fast alle festen Elemente bestimmt werden können. Für die Analyse genügen wenige hundertstel Gramm. Die entnommene Probe wird in Säure oder durch ein Aufschlussverfahren gelöst. Die gewonnene Lösung wird in einer Flamme verbrannt. Mittels Hohlkathodenlampen werde die nachzuweisenden Elemente gemessen. Eine Variante dieser Untersuchung ist das sogenannte flammenlose Verfahren. Hier wird die Probe in einem Graphitröhrchen atomisiert und dann gemessen. Diese Methode eignet sich für schwerlösliche Proben.
Zum Schluss verspiegeltes Hinterglasbild im Unterschied zum sogenannten Nonnenspiegel, der Malerei in den Auskratzungen eines Spiegels enthält.
Das den Körper nur leicht stützende, unbelastete Bein.
Eine ungenaue Bezeichnung für mechanische Musikinstrumente, die in einem kleineren hölzernen Gehäuse ("Dose") untergebracht sind. Zumeist handelt es sich um Spielwerke, deren Walze sich dreht und dabei mit ihren Stiften die Zinken eines metallenen Kammes durch Anreißen zum Klingen bringt. Der Antrieb der Walze geschieht meist durch ein Federwerk zum Aufziehen oder, bei sehr kleinen, einfachen Stücken, über eine Handkurbel. Durch seitliches Verschieben der Walze sind in aufwendigeren Instrumenten mehrere Musikstücke abspielbar. Diese werden oft auf einem eingeklebten Zettel im Deckel aufgelistet. Hersteller solcher Spielwerke sind häufig im Schweizer Jura zu finden, aber auch im Schwarzwald. In Liebhaberkreisen werden gut erhaltene Stücke vergleichsweise teuer bezahlt.
Ein aus Stoffteilen zusammengesetztes Bild, oft auf einen Kupferstich appliziert.
Die älteste Hemmung von Uhren, bei der zwei auf einer Welle angebrachte Spindellappen abwechselnd in das Hemmungsrad eingreifen und es jeweils um einen Zahn weiterlaufen lassen.
Lange Stangenwaffe mit blattförmiger Spitze und darunter abgesetztem Querknebel oder sehr breiten Flügeln, ursprünglich als Kampfwaffe verwendet. Reichverziert mit Ätzungen von Wappen oder Monogrammen diente das Sponton später oftmals als Rangabzeichen für Offiziere oder Unteroffiziere.
Taschenuhr, deren Zifferblatt zusätzlich zum Deckglas von einem metallenen Deckel geschützt wird, welcher durch Drücken auf die Krone mittels eines Federmechanismus' aufspringt.
Milliput, eine Modellierungsmasse.
Verzieren von Geschirrpartien oder Bemalen von Figuren mit Farben und/oder Gold.
Jakob Stainer (Absam bei Innsbruck 1617(?)-1683) gilt als der bedeutendste Geigenbauer des deutschen Sprachgebietes. Seine Arbeiten zeigen handwerkliche und stilistische Ähnlichkeit besonders mit den Instrumenten der Familie Amati aus Cremona. Stainers Instrumente wurden in den deutschen Ländern und in England lange denen der Cremoneser vorgezogen. Gelegentlich tragen sie anstelle einer Schnecke einen Löwenkopf. Für den deutschen Geigenbau besaßen Stainers Violinen bis weit ins 19. Jh. hinein Modellcharakter, etwa für die Geigenmacher in Mittenwald, in Nürnberg und im Vogtland. Original-Instrumente von Jakob Stainer werden hochbezahlt. "Nachempfindungen" der unterschiedlichsten Qualitätsstufen sind in Deutschland in großer Zahl hergestellt und mit entsprechend nachgedruckten Etiketten versehen worden.
Das die Hauptlast des Körpers tragende Bein.
Ein schmaler, hoher Becher, der vom 15. bis zum 18. Jh. in ganz Europa verbreitet war. Verziert wurde er mit Ringen und Spiralen in Fadenauflage, eventuell auch mit Nuppen, Emaillemalerei und Diamantritzung. Mitunter war er auch mit Deckel und Standfuß versehen.
Verbesserung des Abzugssystems von Feuerwaffen, mit dem durch einen Vorspannabzug der Hauptabzug so fein gestellt wurde, dass bereits die kleinste Berührung den Schuss auslösen konnte. Ein "Verreißen" des Schusses durch zu heftiges Drücken wurde dadurch stark eingeschränkt.
Auch Tüllen- oder Tulpenvase genannt. Vor allem im 17. und 18. Jh. zum Arrangieren von Tulpenbouquets hergestellte Vasen aus Fayence und Porzellan.
siehe Lithographie.
Auch Steindelschliff, seit 1770 bekannt. Er besteht aus tief eingeschliffenen, geradlinigen, einander kreuzenden Furchen.
Seit dem 17. Jh. verwendete Zündung für Vorderladerwaffen, bei der ein gefederter Hahn mit eingespanntem Feuerstein auf ein Stahlblech schlug, Funken erzeugte und so die in der darunterliegenden Pfanne befindliche Zündladung zur Explosion brachte. Da dieses System bei Luftfeuchtigkeit oder für das Verkanten der Waffe ziemlich anfällig war, suchte man immer wieder nach Verbesserungsmöglichkeiten. Im frühen 19. Jh. wurde das Steinschlosssystem von der Perkussionszündung abgelöst.
Bei Stutz- bzw. Kaminuhren angebrachte Schraube zur Regulierung der Ganggeschwindigkeit.
An der Verbindung von Klinge und Gefäß von Blankwaffen angebrachtes ovales Metallstück. Es ist mehr oder weniger stark gewölbt und diente zum Schutz der Hand im Gefecht.
Darstellung von meist toten oder reglosen Gegenständen wie Blumen, Früchten, erlegten Tieren, einfachen oder kostbaren Alltagsgebrauchsgeräten. Vom Maler nach ästhetischen Gesichtspunkten zusammengestellt. Nach Gattungen unterschieden. z.B. Blumenstilleben, Fruchtstücke, Jagdstücke, Küchenstücke. Sie weisen als Memento mori oft auf die Vergänglichkeit alles Irdischen hin.
Braune Fleckenbildung, durch Feuchtigkeit entstanden.
Kleinere Federzuguhren mit Pendel, die man auf Tischen, Kaminen oder Konsolen aufstellen konnte. Diese Uhren hatten das Aussehen von verkürzten bzw. gestutzten ("Stutzuhr") Bodenstanduhren. Stock- bzw. Stutzuhren wurden ab etwa 1570 gebaut und waren von 1600 bis zum Ende des 18. Jhs. die häufigste Form der Hausuhr in Mitteleuropa. Hauptproduzent war ab der Mitte des 17. Jhs. England.
Auch Rechaud; mit Kerzen, Holzkohle oder Spiritus geheiztes Warmhalte-Gerät, meist aus Keramik, Silber oder Messing, selten aus Zinn.
Antonio Stradivari (Cremona 1644-1737) gilt als der bedeutendste Geigenbauer. Er war Schüler von Nicola Amati. Mehrere hundert als authentisch geltende Instrumente sind von ihm erhalten. Sie erzielen höchste Preise (die bislang teuerste 11 Millionen Euro) und sind als Instrumente für die großen Violinvirtuosen gesucht. Der Wert dieser Instrumente liegt in der grandiosen handwerklich-künstlerischen Qualität, in ihrem besonderen Klang und schließlich in ihrer Bedeutung als seltene Antiquität. Entsprechend häufig sind die Instrumente von Stradivari nachgebaut worden, in Serienfabrikationen sogar ohne genauere Kenntnis der Originale.
Eine Sonderform des Kali-Blei-Glases, das zur Imitation von Edelsteinen, besonders Diamanten von dem Straßburger Goldschmied Georg Friedrich Strasser in den Jahren 1730 bis 1734 in Paris entwickelt wurde.
siehe Stockuhr.
Zuchtperlen aus der Südsee und Australien, die im Durchmesser immer größer als 10 mm sind. Neben Weiß gibt es sie auch in Lachs-, Gold-, Kupfer- oder Grautönen.
Saugkanne mit Tragbügel, Klappdeckel und Saugröhrchen. Diese Schweizer Bezeichnung wurde vor allem für eine besondere Form von Trinkgefäßen für Kinder benützt.
Kopf, der auf einer Brustplatte drehbar ist. Der Swivel neck wurde häufig bei frühen französischen Modepuppen verwendet.
Eine Synthese (oder ein synthetischer Stein) wird künstlich hergestellt und besitzt annähernd die gleiche chemische Zusammensetzung wie ein natürlich gewachsener Edelstein, also auch annähernd die gleichen physikalische Eigenschaften, sei es die Härte, das spezifische Gewicht und die Lichtbrechung. Eines der bekanntesten ist das Verneuil-Verfahren, 1902 vom französischen Chemiker Auguste Verneuil veröffentlicht, mit dem künstliche Rubine und Saphire hergestellt werden konnten.