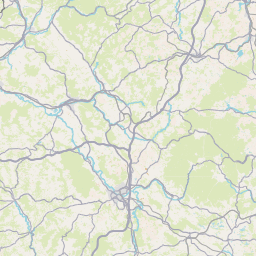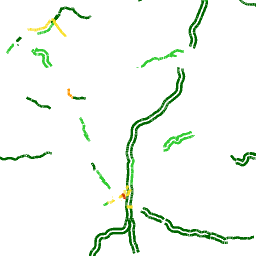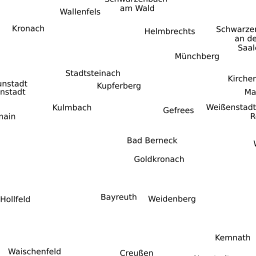Das Lexikon von Kunst + Krempel Alle Fachbegriffe mit dem Anfangsbuchstaben "T"
Objekte, die entweder zum Gebrauch oder als Zierde an einer reich gedeckten Tafel verwendet werden, wie z.B. ein Tafelaufsatz, das Geschirr, Pokale.
Spätmittelalterliche Gemälde auf gebrettertem Holzgrund.
Sogenannter Dickstein, der durch das Niederschleifen zweier gegenüberliegender Oktaederspitzen beim Rohstein entsteht. Eine Vorform des Brillantschliffs.
Auch unter dem Namen "Pariser Talmigold" (eine Kupferlegierung aus 87% Kupfer, 12% Zink, 1% Zinn) bekannt. Es wurde 1840 von dem Pariser Fabrikant Tallois in den Handel gebracht. Die Legierung ist mit einer aufgewalzten oder galvanisch erzeugten Goldschicht plattiert. Sie wurde als "Tallois-mi-or" (französ. "mi-or"= Halbgold) bezeichnet, woraus Talmi entstand.
Einhämmern von Edelmetalldrähten (Gold oder Silber) in eingeschnittene Rillen eines anderen Metalls (Kupfer).
Unedles Metall wird mit Einlagen von andersfarbigem Metall (auch Edelmetallen) verziert.
Die Tellerform war namensgebend. Diese Uhren sind eine spezifisch deutsche Uhrenform, die entweder in Augsburg oder in Nürnberg gegen Ende des 16. Jh. entstand. Das Zifferblatt ist wie ein Prunkteller mit einem breiten, reich ornamentierten Rand versehen. Die Teller können aus Eisen oder aus Messing – eventuell versilbert oder vergoldet – aber auch aus Silber gefertigt sein. Dieser Uhrentypus war in Süddeutschland sehr verbreitet.
Edelzinn-Schüssel, deren Reliefdekor von der zentralen "Temperantia"-Figur (Allegorie der Mäßigkeit) dominiert wird. Dieses Hauptwerk des berühmten Zinngießers Francois Briot (um 1550-1616) zählt zu den bedeutendsten Erzeugnissen des französischen Edelzinns. Die Schüssel wurde später häufig kopiert.
Die plastische Darstellung des Menschen bis zur Brust oder auch bis zur Schulter aus gebrannter Tonerde. Gebrannte Tonerde (terra cotta) eignet sich für Kleinplastiken und Gefäße und ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit.
Größere, meist bauchige Deckelschüssel mit Henkeln. Rund oder oval, wurden Terrinen in Metall (Zinn und Silber) und Keramik (Ton, Fayencen, Porzellan u.a.) hergestellt.
Terrine mit reichen Dekorelementen vor allem des Barock.
Italienische Familie von Geigenbauern in Mailand zwischen 1690 und der Mitte des 18. Jhs. Die bekannteste Mitglieder sind Carlo Guiseppe T. (arbeitete 1690 bis ca. 1720) und seine beiden Söhne Carlo Antonio (aktiv 1720 bis ca. 1760) und Paolo Antonio (arbeitete etwa 1725 bis 1760). Obgleich ihre Instrumente nicht nur zur allerersten Klasse italienischen Geigenbaus gerechnet werden können, sind es doch gesuchte Konzertviolinen. Der Name dieser Geigenbauerdynastie wird in jüngeren Produkten für Fälschungen missbraucht.
Szenische Darstellung religiöser Themen im Barock mit Statuen, die lebensgroß sein können.
Der Druckträger ist eine mit Wachs überzogene Metallplatte, zumeist Kupfer, in die das Motiv vom Künstler mit einer Radiernadel unter Freilegung der Wachsschicht gezeichnet wird. Wird die Platte anschließend in das Säurebad gelegt, so bleiben die bedeckten Stellen vom Ätzvorgang verschont, während die bezeichneten Partien Vertiefungen erfahren. In diesen Vertiefungen haftet beim Einfärben der Platte die Druckfarbe. Beim anschließenden Druck auf befeuchtetem Büttenpapier werden diese vertieften, mit Farbe versehenen Stellen entsprechend der Zeichnung seitenverkehrt sichtbar.
Die gravierten Darstellungen werden in die Gefäßwandung hineingearbeitet. Dabei bedient sich der Glasschneider einer Tretvorrichtung, die ein horizontal rotierendes Kupferrädchen antreibt, unter zusätzlicher Verwendung von Öl und Schmirgel. Wird stets in Mattschnitt ausgeführt.
Metallflitterauflagen von Borten und Mustern für industriell gefertigten Wandschmuck der zweiten Hälfte des 19. Jhs.
Dosen- oder kassettenförmige Uhren, bei denen das Zifferblatt parallel der Standfläche angebracht ist und die ihrer Größe nach für den Gebrauch auf Tischen geeignet sind. Dieser Uhrentypus erfreute sich vom 16. bis zum 18. Jh. besonders in Süddeutschland großer Beliebtheit. In Frankreich hingegen hielt das Interesse nur bis ins 17. Jh. hinein an.
Die Bezeichnung Tombak geht auf die malaiische Vokabel für Kupfer zurück, gelangte um 1700 vom Holländischen ins Deutsche und bezeichnet eine Kupfer-Zink-Legierung ( 30% Zink), die in Deutschland als Goldersatz seit Mitte des 18 Jh. verwendet wird.
Eine auf Gussböcken gelagerte Verteilerwelle mit mehreren Riemenscheiben, die die von der Dampfmaschine erzeugte Antriebskraft gleichzeitig auf mehrere Antriebsmodelle verteilt.
Malerei mit speziellen Emaillefarben, die, dünn aufgetragen, nach dem Einbrennen lichtdurchlässig werden.
Schmuck, der zur Erinnerung an Verstorbene getragen wird, besonders beliebt im Biedermeier. Die Trauer drückt sich zum einen in bestimmten Materialien wie Jet (schwarzer Schmuckstein) und Menschenhaar aus. Zum anderen zeigt Trauerschmuck Darstellungen, die mit dem Tod in Verbindung stehen wie z.B. Kreuz, Grab oder Obelisk.
Ein dreiteiliges Bild, wie es besonders beim mittelalterlichen Flügelaltar vorkommt, der aus einem Mittelbild und zwei Seitenflügeln besteht.
Eigentlich "Augentäuschung". Malerei, bei der durch naturalistische Genauigkeit unter Zuhilfenahme der Perspektive die Illusion hervorgerufen wird, dass sich wirklich ein körperhafter, dreidimensionaler Gegenstand im Bild befindet.
Grundtypus eines Blasinstruments mit einer Röhre von weitgehend gleichem Querschnitt. Üblicherweise aus Metall, vorwiegend aus Messing, im volkstümlichen Bereich oft mit Pflanzenteilen umwickelt (Rindentrompeten u.dgl.). Bis zum Ende des 18. Jhs. waren Trompeten auf dem Schlachtfeld (als Signalinstrument) und in der Kunstmusik einfache Röhren ohne Grifflöcher oder Ventile. Danach wurde begonnen, Trompeten mit Klappen und später mit Ventilen auszustatten. Die ventillosen Trompeten halten sich bis heute als Fanfaren. Ein frühes Zentrum des Trompetenbaues war u.a. Nürnberg.
Eigentlich ein Schlüsselbund, dann wechselte die Bedeutung zu: Aussteuer von Prinzessinnen. Gemeint ist auch die Garderobe und alle Dinge, die in Adelskreisen beim Wechsel von der Hauptresidenz in die Sommerresidenz mitgenommen wurden.
Helmartige, ursprünglich hohe militärische Kopfbedeckung mit rundem oberen Deckel und Augenschirm. Besonders im 19. Jh. in allen Armeen verbreitet, wurde sie immer kleiner und hielt sich bis zum 1. Weltkrieg. In einer besonderen Form wurde der Tschako bei der deutschen Polizei noch bis Mitte der 1960er Jahre getragen.
Ursprünglich helmartige hohe Kopfbedeckung mit, im Gegensatz zum Tschako, viereckigem Deckel. Im Verlauf des 19. Jh. wurde der Schaft immer stärker tailliert, so dass bis kurz vor dem ErstenWeltkriegs diese typische Kopfbedeckung der Ulanen aus einer halbrunden Kalotte bestand, die von einem Viereck bekrönt wurde.
Besonders ausgebildete Röhrenform. 1. für die – meist abnehmbare – Kerzenhalterung bei Kandelabern und Leuchter, 2. für spezielle Ausgüsse bei Kannen und 3. für Einstecköffnungen bei Tulpenvasen (Tüllenvase).
Stutzuhren, bei denen die Indikationsblätter auf den senkrechten Flächen häufig allseitig angebracht sind. Sie erinnern an die Uhrentürme der Renaissance. Dieser Typus wurde etwa von der Mitte des 16. Jhs. an über 100 Jahre lang hindurch von den namhaftesten Uhrmachern gefertigt, besonders in Frankreich und Süddeutschland.
Auch Tüllenvase. Ein speziell im 17. und 18. Jh. für die damals unglaublich teuren Tulpen entwickelter Vasentyp. Die Tulpenvase besteht aus verschiedenen Tüllen, also Röhrchen, in die man die Stengel einzeln einstecken und die Blumen so wie kleine Kunstwerke präsentieren konnte.