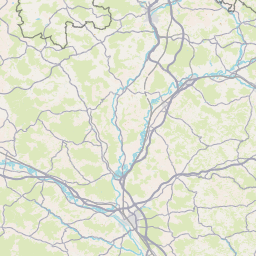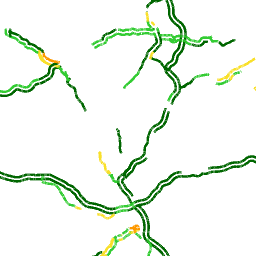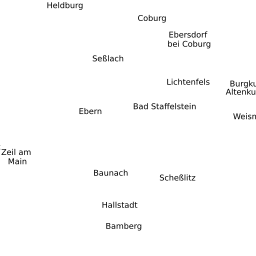Interview zum 16. März 1945 "Die Menschen hatten einen eisernen Willen"
"Nichts hat sich so tief ins Gedächtnis der Würzburger eingebrannt wie der 16. März 1945", sagt Andreas Mettenleiter. Umso faszinierter ist der Historiker von dem Willen, mit dem die Würzburger den Wiederaufbau angepackt haben.
Die Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 hat tiefe Spuren hinterlassen – nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern auch bei den Menschen, die den Angriff miterleben mussten. Wie überraschend kam der Angriff damals?
Andreas Mettenleiter: Er kam nicht wirklich unerwartet: Im Vorfeld wurde ja plakatiert und darauf hingewiesen, dass ein Großangriff bevorsteht, weshalb Frauen und Kinder evakuiert werden sollten. Trotzdem haben bestimmt viele gehofft, dass Würzburg doch verschont bleibt. Womit aber keiner gerechnet hatte, war das Ausmaß der Zerstörung. Die komplette Versorgungslage brach zusammen, die Überlebenden mussten vor allem erst einmal schauen, dass sie irgendwo unterkommen.
Was hat in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten überwogen: Hilfsbereitschaft oder Egoismus?
Aus den Zeitzeugenberichten habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sehr viel Solidarität gab. Manche Leute hatten ja außerhalb Würzburg ein Gartenhäuschen, in das sie während des Angriffs geflohen waren. Nach der Zerstörung ist man dann oft zusammengerückt und hat die Nachbarn, deren Häuser und Wohnungen ausgebrannt waren, mit im Gartenhaus untergebracht.
Aber natürlich gab es auch Neid und Missgunst und Leute, die in erster Linie an sich selbst gedacht haben. Zum Beispiel satte Bauern auf dem Land, die ihren armen ausgebrannten Verwandten nur bis zu einem bestimmten Maß geholfen haben. Die Bauern haben zwar Brot zur Verfügung gestellt, aber Butter und Schinken haben sie alleine gegessen.
Durch den Angriff wurde die Innenstadt zu 90 Prozent zerstört. Wie muss man sich die Wohnsituation danach vorstellen?
Die Menschen haben zum Teil in Kellern gehaust, Provisorien errichtet – typisch sind diese einstöckigen, kleinen Notunterkünfte und Notverkaufsräume. Einige davon können Sie heute noch sehen, wenn Sie mit aufmerksamen Augen durch die Stadt laufen. Zum Beispiel das Gebäude neben dem Discounter in der Eichhornstraße. Oder am Markt gibt es noch eine kleine Bäckerei. In erster Linie ging es den Leuten damals vor allem darum, ein Dach über dem Kopf zu haben und Geld zu verdienen, um den Wiederaufbau zu finanzieren.
Nach dem Angriff war an Wiederaufbau sicherlich erst einmal nicht zu denken. Es soll ja sogar Pläne gegeben haben, Würzburg gar nicht oder an anderer Stelle wieder aufzubauen.
Die Stadt war ein riesiger Trümmerhaufen. Die Frage ist ja immer, welchen Aufwand man betreibt. Und unter Umständen wäre es weniger Aufwand gewesen, in Richtung Heidingsfeld ein neues Würzburg aufzubauen als diesen ganzen Trümmerberg wegzuräumen. Auch die Uni war schwer getroffen. Es gab sogar Überlegungen, sie nach Regensburg zu verlagern und dort komplett neu aufzubauen.
Also hieß es erst einmal: abwarten.
Richtig. So lange nicht sicher war, dass Würzburg wieder aufgebaut werden würde, war es schwierig, eine Baugenehmigung zu bekommen. Eine der vier Familien, über deren Schicksal ich in meinem Buch berichte, hatte in einer Gasse ein Eckhaus. Nach der Zerstörung war erst einmal völlig unklar, ob diese Ecke bestehen bleiben oder ob stattdessen eine breitere Straße gebaut werden würde. Erst im Laufe des Jahres 1945 hat der Stadtrat den Entschluss gefasst, Würzburg an alter Stelle wieder aufzubauen.
Wie schwierig war es, an Baumaterial zu kommen?
Die größte Schwierigkeit bestand zunächst darin, die unvorstellbar großen Schuttberge beiseite zu räumen. Um an Baumaterial zu kommen, haben die Menschen damals sehr viel „organisiert“. Gerade am Anfang war das sehr schwierig. Es gab einen Schwarzmarkt, jeder, der konnte, hat kräftig seine Kontakte genutzt. Was diese Schwarzmarktgeschäfte betrifft, haben die älteren Leute teilweise heute noch ein schlechtes Gewissen. Wobei ja die heutige Generation sagt: He, ihr musstet doch schauen, dass ihr das auf die Reihe bringt. Das ist nur bedingt unsolidarisch gegenüber denen, die da keine Möglichkeiten hatten.
Es gab Prophezeiungen, der Wiederaufbau würde bis in die 1980er Jahre hinein dauern. Doch diese Rechnung hat ja – zum Glück – bei Weitem nicht gestimmt.
Was einen aus heutiger Sicht wirklich erstaunt, ist dieser Wiederaufbaugeist und der eiserne Wille, sich wieder eine Existenz zu schaffen. Die größten städtebaulichen Veränderungen gab’s ja nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern so 1870/80 als die Festungseigenschaft aufgehoben wurde und die ganzen Befestigungen verschwanden. Damals hat man riesige neue Straßen gebaut, z.B. die Schönbornstraße. Das sind die großen Achsen, die wir heute kennen. Auch die Sanderstraße war viel schmaler. Das Reurerkloster ragte weit in Straße hinein. Aber als die Straßenbahn gebaut wurde (1899/1900, Anm. d. Red.), brauchte man breite Straßen. Das heißt, die größten städtebaulichen Veränderungen sind eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg passiert. Und was man nach dem Krieg gemacht hat, ist, dass man diese Struktur erhalten hat. Was sich der heutige Historiker fragen mag: Es standen ja noch ganze Straßenzüge an Fassaden, warum hat man die nicht gerettet? Nun, es ging den Leuten damals darum, zu überleben, Wohnraum zu schaffen – und nicht darum, was Künstlerisches zu erhalten. Da muss man die Leute auch aus ihrer damaligen Situation heraus verstehen.
Der Autor
Andreas Mettenleiter, Jahrgang 1968, ist Mediziner und Historiker. In Beiträgen für die Lokalpresse und Buchpublikationen, die sich an ein breites Publikum richten, hat er sich mit der Stadt- und Universitätsgeschichte Würzburgs auseinandergesetzt. Ein medizinhistorischer Forschungsschwerpunkt ist die Vergangenheit des Würzburger Juliusspitals.
Was die Leute damals bewegt hat, haben Sie ja in Ihrem Buch „Zerstörung und Wiederaufbau in Würzburg“ eindrucksvoll dokumentiert.
Viele hatten sich schon einmal mit zähem Fleiß eine Existenz aufgebaut zwischen 1890 und den Zwischenkriegsjahren. Und dann war alles dahin. Und sie haben praktisch wieder von vorn angefangen mit einer unglaublichen Energie, haben sich innerhalb kürzester Zeit wieder eine Lebensgrundlage geschaffen.
Wenn man sich das Beispiel von Otto Schauer anschaut, er war orthopädischer Schuhmachermeister: Seine Verwandten auf dem Land behandelten ihn und seine Familie als Habenichtse. Das hat ihn so gewurmt, dass er gesagt hat: Ich will mir wieder eine Existenz aufbauen und wieder wer sein. Die Menschen damals hatten das Gefühl, ohne Haus oder Betrieb kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein.
Spannend ist es auch zu sehen, wie viele Menschen von Verwandten aus Amerika unterstützt wurden – in meinem Buch drei von vier Familien. Ganz Unterfranken war ja im 19. Jahrhundert Auswanderungsregion, in praktisch jeder Familie gab’s Verwandte in Amerika, die gerade in der Phase des Wiederaufbaus sehr geholfen haben. Einmal mit Care-Paketen natürlich, aber notfalls auch finanziell. Die wichtige Rolle, die die US-Verwandten damals gespielt haben, ist heute oft so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Wie bewegend war es für Sie, diese vier Schicksale zu dokumentieren? Ist das selbst für einen Historiker etwas Besonders?
Auf alle Fälle. Die Fakten waren ja im Grunde bekannt. Was mich wirklich fasziniert hat, waren die Interviews mit den Betroffenen. Aber auch die Unterlagen, die da noch in Familienbesitz waren. Für mich einmalige Dokumente sind beispielsweise die „Briefe“, die Mutter Auth an ihren vermissten Sohn geschrieben hat. Denn da musste sie sich um keine Zensur kümmern und schrieb Dinge, die in keiner Zeitung stehen, in keinem offiziellen Bericht. So etwas wie „Heute war schon wieder drei Mal Luftalarm. Die drehen uns jetzt die Heizung ab, demnächst gibt’s kein Gas mehr“. Da kriegt man einen hautnahen Eindruck von den Lebensverhältnissen der Leute. Wie sie das erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind, was sie für Sorgen hatten. Da waren die Alltagsprobleme oftmals wichtiger als die großen weltpolitischen Ereignisse. Wie gesagt: Die Fakten sind bekannt, aber wie die Menschen damit umgegangen sind – das ist es, was einem Geschichte wirklich nahe bringt.
Sie sind 1990 nach Würzburg gekommen und haben sich intensiv mit der Geschichte der Stadt auseinandergesetzt. Was geht ihnen heute durch den Kopf, wenn Sie durch die Straßen gehen?
Böse gesagt, ist Würzburg ja zerstört worden am 16. März – aber hinterher mindestens genauso durch die Bausünden der 1970er Jahre. Wenn ich mir heute anschaue, was in der Innenstadt für 0815-Gebäude gebaut werden, überlege ich schon, ob das unbedingt sein muss. Andererseits ist die Zerstörung mittlerweile 70 Jahre her. 1945 war der deutsch-französische Krieg gut 70 Jahre her und damit große Eingriffe ins Stadtbild mit gründerzeitlichen Fassaden – man denke an die Kaiser-, Sander oder Augustinerstraße. Andererseits sind die 1950er Jahre heute auch kulturgeschichtlich und baugeschichtlich bedeutsam, denken Sie an das Mozartareal. Und Würzburg ist heute eine Stadt der 1950er Jahre. Mit dem Stil, der damals modern war. Keine Ahnung, wie man in 100 Jahren darüber denkt und urteilt.
Aber als Historiker tut Ihnen wahrscheinlich nicht nur das Stadtbild weh.
Man wird sich auch schmerzlich bewusst, was in den Privathäusern an Dokumenten verloren gegangen ist. Mir geht’s ganz oft so, dass ich irgendwo in einem Archiv sitzen und dann heißt es: Der komplette Bestand ist verbrannt. Oder im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, ausgelagert und nicht mehr zurückgekommen. Das tut natürlich sehr weh. Umso wichtiger ist es jetzt für mich, Dokumente in Familienbesitz zu sichern, bevor sie auch eines Tages entsorgt werden und einfach weg sind.
Das Buch "Zerstörung und Wiederaufbau in Würzburg"
In einer Apotheke, einer Gastwirtschaft, einem Handwerksbetrieb und einem Papierfachgeschäft erlebten vier Würzburger Familien Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau. Sechseinhalb Jahrzehnte später erinnern sie sich in Zeitzeugeninterviews an ihre ganz persönlichen Erfahrungen in den Jahren zwischen 1933 und 1960. Zahlreiche Private Aufnahmen aus geretteten Fotoalben illustrieren eindrucksvoll dieses Kapitel hautnah erlebter Stadtgeschichte. Ergänzt werden die lebendigen Schilderungen durch Aufzeichnungen und Alltagsdokumente. Daraus entstand ein packender Tatsachenbericht, der bei vielen älteren Menschen Erinnerungen wachruft. Erinnerungen an eine Zeit voll Aufbruchsstimmung und zähen Überlebenswillens, über den die junge Generation nur staunen kann.
"Zerstörung und Wiederaufbau in Würzburg – vier Häuser, vier Familien, vier Schicksale". ISBN 3-940072-05-02, Preis: 22 Euro; unter anderem erhältlich bei Papier Pfeiffer, Sanderstraße 4a, Würzburg oder direkt beim Verlag unter info@akamedon.de.