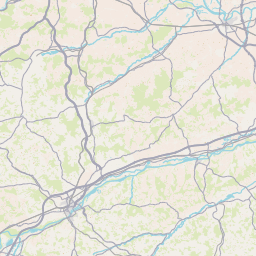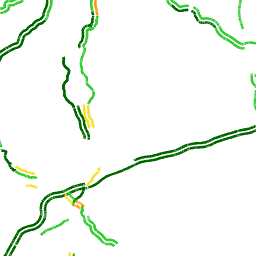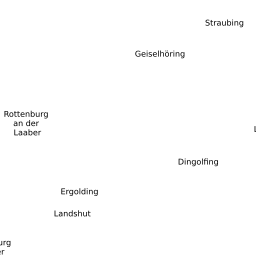Körpereigene Abwehr Das menschliche Immunsystem
Das menschliche Immunsystem hat die ADas menschliche Immunsystem hat die Aufgabe, Krankheiten abzuwehren. Es besteht aus Milliarden Zellen, die durch den Körper patrouillieren, um Fremdkörper wie Viren oder Bakterien aufzuspüren und zu vernichten.
Von: Justina Schreiber
Stand: 15.12.2023 |Bildnachweis

Das menschliche Immunsystem hat die Aufgabe, Krankheiten abzuwehren. Es besteht aus Milliarden Zellen, die durch den Körper patrouillieren, um Fremdkörper wie Viren oder Bakterien aufzuspüren und zu vernichten.
Experte:
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker, Direktor des Institutes für Immunologie der Ludwig-Maximilians-Universität München
Unzählige Immunzellen führen im menschlichen Körper einen ständigen Kampf gegen Eindringlinge. Rastlos sorgen sie für unsere Gesundheit - meist unmerklich. Manchmal jedoch führen die Abwehrstrategien des Immunsystems zu spürbaren Symptomen: Das Fieber steigt, die Nase läuft, der Hals tut weh.
"Wenn Sie sich krank fühlen, dann ist das eigentlich in den allermeisten Fällen ein guter Vorgang. Denn das bedeutet, dass Ihr Immunsystem funktioniert. Man bekommt bei einer Infektion z. B. Fieber, weil das Immunsystem verschiedene Botenstoffe, sogenannte Zytokine oder Lymphokine ausschüttet, die unter anderem eine Entzündung bewirken. Diese Entzündung ist notwendig, um das Immunsystem und den Körper auf Trab zu bringen, damit die Infektion bekämpft werden kann."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Dem Text liegt ein Interview mit Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker, dem Direktor des Institutes für Immunologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, zugrunde.
Das Immunsystem ist über den ganzen Körper verteilt. Es besteht aus unzähligen mobilen Zellen. Im Thymus, in der Milz und in zahlreichen Lymphknoten sowie im Knochenmark entwickeln sich die Zellen des Immunsystems. Hier reifen sie von Vorläuferzellen zu funktionellen Immunzellen heran. Sobald Gefahr in Verzug ist, werden sie aktiviert.
Überall lauern tödliche Feinde. Wir atmen Viren ein. Wir nehmen Hefepilze oder Parasiten beim Essen und Trinken auf. Wenn wir uns verletzen, dringen Bakterien in die Wunde. Ohne Immunsystem könnte kein Mensch überleben. Viele verschiedene raffiniert aufeinander abgestimmte und anpassungsfähige Zellarten schützen uns sehr effizient.
Die erste Barriere: Haut, Schweiß und Tränen
Die Epidermis-Schichten der intakten Haut bilden eine erste, schwer durchdringbare Barriere. Ein schwach saurer Film, der antimikrobielle Substanzen enthält, erschwert es pathogenen Keimen wie z. B. Pilzen, sich anzusiedeln und zu vermehren. Auch Sekrete wie Tränen, Speichel und Schleim wirken antibakteriell. Schleimhäute, die die inneren Oberflächen von Organen wie Lunge oder Darm bilden, können mechanisch und chemisch reagieren. Die Magensäure etwa verätzt so manchen potenziellen Feind. Und die feinen Härchen in der Luftröhre befördern Eindringlinge wieder nach oben. Viele Störenfriede verlassen den Körper, ohne Schaden angerichtet zu haben.
Die zweite Barriere: das angeborene Immunsystem
Wenn ein Fremdstoff (z.B. Viren und Bakterien) etwa über eine Wunde in die Blutbahn gelangt, reagiert das angeborene Immunsystem sofort und effizient. Sogenannte Wächterzellen stürzen sich auf den Erreger, um ihn zu neutralisieren. Diese auch Sentinels genannten Zellen sitzen in der Haut und den Schleimhäuten, also überall dort, wo wir mit der Außenwelt in Berührung kommen. Sie identifizieren die "bösen“ Keime: Sind es Rhinoviren, die einen Schnupfen auslösen, oder Pneumokokken, die zu einer Lungenentzündung führen können, oder vollkommen harmlose Partikel? Je nach Befund entwickelt sich in Blitzeseile eine eigens ausgestattete Armee.
Immunantwort = Entzündungsreaktion
Sogenannte Fresszellen (Makrophagen, Granulozyten oder Neutrophile) greifen die Erreger an, um sie zu neutralisieren. Gleichzeitig locken Botenstoffe weitere Zellen an den Herd der Infektion. Sie sorgen für eine stärkere Durchblutung des betroffenen Gewebes. Eine Entzündung, die oft als Rötung oder Schmerz wahrnehmbar wird, ist die Folge. Sie multipliziert die Immunreaktion und blockiert die Ausbreitung des "Feindes“.
Diese Antwort des Körpers folgt einem festen genetischen Programm.
"Das angeborene Immunsystem ist immer da. Es ist immer fertig, es kann immer sofort zuschlagen. Und es wird dann auch das wesentlich komplexere 'erworbene' oder 'adaptive' Immunsystem alarmieren."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Kampf der weißen Blutkörperchen
Die Zellen des angeborenen Immunsystems gehören zu den weißen Blutkörperchen (Leukozyten), die sich im Fall einer Infektion stark vermehren können. Sie werden durch Botenstoffe zu einer Entzündung gelockt und können auch durch Gewebe wandern. Wenn eine Wunde Eiter absondert, sind vor allem Granulozyten in großer Zahl aktiv.
Sogenannte dendritische Zellen verdauen ebenfalls Proteine fremder Keime. Aber sie zerstören sie nicht vollständig. Denn ihre Aufgabe ist es, das erworbene Immunsystem über die Angreifer zu informieren, denn die Erstreaktion des angeborenen Immunsystems nicht meist nicht aus. Dazu brauchen sie Material.
"Die dendritischen Zellen präsentieren Bruchstücke des Krankheitserregers auf ihrer Zelloberfläche und wandern aus den äußeren in tiefere Körperschichten, über die Lymphe z. B. in die Lymphknoten hinein. Dort zeigen sie die Bruchstücke dem (erworbenen) Immunsystem. Denn die Effektorzellen, die T- und die B-Zellen des erworbenen Immunsystems, dringen alleine meist nicht in die äußeren Gewebsschichten vor. Sie sitzen in den Lymph- oder Blutbahnen und den Lymphknoten und müssen zuerst aktiviert werden."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Das erworbene Immunsystem besteht aus Lymphozyten. Sie befinden sich hauptsächlich in den Lymph- und Blutbahnen, Lymphknoten, der Milz und dem Knochenmark.
Jeder Mensch macht verschiedene Krankheiten durch. Mit den Keimen, die ein Baby von Geburt an aufnimmt, trainiert der Körper seine Abwehrreaktionen. Denn er muss erst lernen, zwischen fremden und eigenen Zellen zu unterscheiden. In den Gedächtniszellen des erworbenen Immunsystems speichern sich dann die Informationen über Infektionen und ähnliche Erfahrungen wie Impfungen langfristig.
Im jugendlichen Alter ist das erworbene Immunsystem ausgereift. Wenn ein Kind in besonders keimarmer Umgebung aufwächst und nicht geimpft wird, verfügt es möglicherweise über nur wenige Antikörper und andere spezifische Abwehrmechanismen wie Gedächtniszellen. Dies kann gefährlich werden, wenn z.B. das immunologische Gedächtnis zu schwach ausgeprägt ist.
"Das immunologische Gedächtnis erlaubt uns, bei einer zweiten Infektion mit denselben Erregern sofort zuzuschlagen. Wir spüren davon meistens gar nichts mehr. Das ist auch das Prinzip der Impfung: dass man ein solches Gedächtnis erzeugt, damit bei einer richtigen Infektion die Vernichtung der Erreger kaum oder gar nicht merklich stattfindet."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Die Immunität betrifft vor allem Krankheiten, die durch Viren, Bakterien oder Pilze ausgelöst werden.
Wenn die Schleimhäute wegen trockener Heizungsluft oder Zugluft schlecht durchblutet sind oder besonders viele Keime unterwegs sind, fängt sich der Mensch Erkältungen ein. Viren dringen in Körperzellen ein und vermehren sich dort.
Das angeborene Immunsystem hält den Gegner in Schach, bis das erworbene Immunsystem seine hochspezifische Antwort fertig hat. Die Botenstoffe, die im Zuge der Abwehrreaktion freigesetzt werden, bewirken grippale Symptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen.
Dendritische Zellen des angeborenen Immunsystems wandern in das lymphatische System, um Bruchstücke eingefangener feindlicher Keime zu präsentieren. Jetzt muss sich eine T-Zelle finden, die die fremde Zell-Struktur erkennt.
- T-Zellen können direkt gegen infizierte Zellen vorgehen. Unser Körper enthält bis zu 500 Milliarden T-Zellen und jede einzelne T-Zelle trägt ein anderes Oberflächen-Molekül, das jeweils andere fremde Bakterien- oder Virenbruchstücke erkennen kann. Auf diese Weise hält der Körper eine Vielzahl möglicher Abwehrspezifitäten parat. Allerdings kann es eine Weile dauern, bis sich die zum Gegner passende T-Zelle findet und die ganz spezielle "Armee“ parat steht.
"Die T-Zelle dockt an die dendritische Zelle an, und bekommt nun Signale, sich zu vervielfältigen. Wenn dann viele Tausend oder Millionen Zellen ausgebildet sind, sogenannte Klone, wandern sie an den Ort der Infektion zurück, um die erregerinfizierten Zellen zu töten. Oder sie wandern in die Lymphknoten, um dort B-Lymphozyten zu stimulieren, die dann große Mengen an Antikörpern produzieren, und zwar solche, die nur für dieses Bakterium oder Virus spezifisch sind, dessen Material es in den Lymphknoten hineingeschafft hat und von der T-Zelle erkannt wurde."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
- B-Zellen wandern ständig durch den Körper. Unser Körper enthält ca. 300 Milliarden B Zellen. Sie können sich zu Plasmazellen weiterentwickeln, die Antikörper herstellen. Antikörper sind Eiweißmoleküle, die spezifisch für einen bestimmten Krankheitserreger wie beispielsweise Masern oder Hepatitis B sind. Sie binden die Krankheitserreger, machen sie unbeweglich oder kennzeichnen sie, sodass sie von Fresszellen leichter beseitigt werden können.
"Es werden tatsächlich die richtigen Zellen expandiert, das heißt, Zellen, die die richtigen Funktionen haben, um z. B. mit einer Hefepilzinfektion fertig zu werden. Oder Zellen, die die richtigen Funktionen tragen, um mit einer Virus- oder Bakterieninfektion fertig zu werden."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Ein funktionierendes Immunsystem unterscheidet klar zwischen eigenen und fremden Zellen. So lassen sich Eindringlinge sofort identifizieren.
Unser Immunsystem muss unentwegt neu sondieren, was zum Körper gehört und was nicht. Je nachdem, trifft es seine Entscheidungen: Fremde Zellen werden eliminiert, eigene geschützt. Aber manchmal irrt es sich oder es wird ausgetrickst. Dann können sich chronische Krankheiten ausbreiten.
Wenn das Immunsystem "aus Versehen“ körpereigene statt fremde Zellen angreift, bilden sich Autoimmunerkrankungen oder Allergien heraus. Die Ursachen dafür sind noch längst nicht wissenschaftlich geklärt. Mit verschiedenen Medikamenten wird dann meist versucht die Immunreaktion abzuschwächen.
Krebs dagegen entsteht, weil der Körper eben im Grunde nicht gegen sich selbst vorgeht. Tumoren bestehen jedoch nahezu ausschließlich aus körpereigenem Zellmaterial. Die medizinische Forschung bemüht sich deshalb, evtl. durch Mutation entstandene "fremde“ Moleküle eines malignen Geschwürs zu finden, um eine Immunreaktion des Körpers hervorrufen zu können.
Ein ewiger Kampf mit allen Waffen
So wie sich das Immunsystem immer wieder auf neue fremde Erreger einstellen muss, passen sich auch manche Viren an, um das Immunsystem auszutricksen. Sie schleusen sich z. B. in Zellen ein, ohne dass sich die Struktur der Moleküle auf der Oberfläche verändert. Oder sie unterbinden wichtige Mechanismen der Immunabwehr. Bei chronischer Hepatitis B und C oder bei Herpesinfektionen ist das der Fall. Das Immunsystem kann die Erreger nun nicht mehr eindeutig identifizieren und effizient eliminieren.
Bei einer HIV-Infektion wird das Immunsystem selbst zum Ziel des Angreifers. Der Virus infiziert und zerstört T-Zellen. Der kontinuierliche Verlust an T-Zellen schwächt das erworbene Immunsystem zunehmend.
Neuere Schätzungen haben ergeben, dass das Immunsystem, was ja über unseren ganzen Körper verteilt ist, insgesamt ungefähr 1.2 kg wiegt (bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von 75 kg). Diese anteilsmäßig recht große Masse an Zellen funktioniert und interagiert von Natur aus meist ziemlich perfekt. Aber wir können es etwas unterstützen.
Nikotin, Alkohol und Stress schwächen das Immunsystem. Auch übermäßiger (Leistungs-)Sport kann die Zellen schädigen. Wer etwas für seine Abwehrkräfte tun will, sollte deshalb vor allem eins: Maß halten. Die Immunzellen direkt zu stärken, ist nämlich kaum möglich.
Die Nahrung in westlichen Ländern enthält alle notwendigen Vitamine und Spurenelemente. Zusätzliche Ergänzungsmittel aus dem Drogeriemarkt oder der Apotheke kosten nur Geld und nützen dem Immunsystem nichts.
"Das heißt, wenn Sie sich ganz normal ernähren, geht es dem Immunsystem eigentlich gut."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Aber: Regelmäßige Saunabesuche und ähnliche Temperaturschwankungen, durch Kneippgüsse etwa, unterstützen die Abwehrkräfte, indem sie die Durchblutung verbessern. Von einer Stärkung des Immunsystems kann jedoch – wissenschaftlich strenggenommen – auch hier nicht die Rede sein.
"Alles, was die Durchblutung verbessert, hilft den Immunzellen besser in gewisse Hautschichten oder Gewebsschichten zu kommen, weil die Kapillaren sich ausdehnen und zusammenziehen. Wenn Sie also in Maßen joggen, stärken Sie zwar nicht das Immunsystem selbst, aber gewissermaßen die Wege und Straßen des Immunsystems. Eine neuere Studie hat auch gezeigt, dass die Einnahme von Magnesiumtabletten bei Virusinfekten und Tumorabwehr die T-Zellen sehr gut unterstützen kann."
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Brocker
Viele Medikamente wie Nasentropfen, Hustensaft und Schmerzmittel lindern nur die Beschwerden. Allerdings kann die moderne Medizin dem Immunsystem auch Arbeit abnehmen bzw. einspringen, wenn es versagt: Antibiotika töten Bakterien ab. Impfungen schützen vor Virusinfektionen.
- Schadstoffe und übermäßigen Stress vermeiden
- Sich ausgewogen und vollwertig ernähren
- Grippe- und andere Impfungen erwägen
- Für gute Durchblutung sorgen