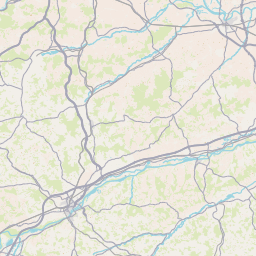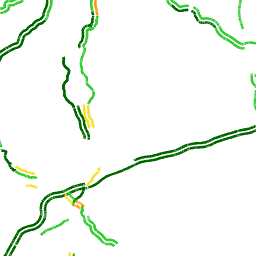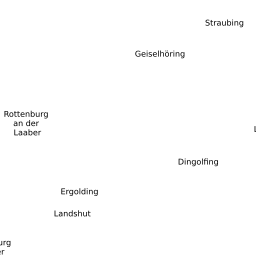Bayern genießen Hut und Hüten - Bayern genießen im September
Selbstverständlich hüten wir uns, die Hüte und das Hüten hier als alten Hut darzustellen: Das Thema nämlich ist unbedingt zeitlos - und hat großes Genusspotential.
Hier unsere Genuss-Themen aus den bayerischen Regionen rund ums Motto "Hut und Hüten"
Oberbayern: Mut zum Hut. Die weltgrößte Hutschau in Ingolstadt. Von Daniela Olivares
Niederbayern: Auf der Hut. Bauern und ihre Schachten im Bayerischen Wald. Von Renate Roßberger
Oberpfalz: Traditionshüter. Im Gespräch mit dem katholischen Traditionshüter Prälat Imkamp. Von Gerald Huber
Oberfranken: Hut ab. Gesunde Sonnenhutstauden aus Oberfranken. Von Susanne Roßbach
Mittelfranken: Alter Hut. Hutewälder im Steigerwald. Von Tanja Oppelt
Unterfranken: Hut im Ring. Die "Keuper-Connection" aus Zeil am Main. Von Pirmin Breninek
Schwaben: Wohlbehütet. Im Hutmuseum Allgäu. Von Doris Bimmer
Hutmuseum Lindenberg/Allgäu
Hut geht gemeinsam mit der Hütte und dem Haus auf eine uralte Wurzel chadh- zurück, die soviel bedeutet wie Flechten, Zusammendrehen. Schließlich werden Kopfbedeckungen oft geflochten oder gestrickt, genauso wie die Wände der ältesten Hausform, des Fachwerkhauses, geflochten werden. Das lateinische Wort casa kommt davon und der Kaser, die Schutzhütte auf der Alm. Folgerichtig hat dieses chadh- später noch die übertragene Bedeutung einschließen, bedecken bekommen. Ein Dach über dem Kopf braucht schließlich jeder. Wenns kein Haus ist, dann eben eine Hütte oder wenigstens ein Hut. Doch der ist nicht mehr selbstverständlich. Wer heute, sagen wir, in einem etwas fortgeschritteneren Lebensalter ist - um nicht zu sagen: ein alter Hut, der hat einen unerhörten Kulturwandel erlebt: Seit dem Mittelalter war es nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern nicht bloß unüblich, sondern sogar regelrecht verpönt, ohne Kopfbedeckung aus dem Haus zu gehen. Nur die mit Hut waren gut; alle anderen, bei denen man das geschorene Haar sah, im Wortsinn gschertes Gesindel. Der Hut war Zeichen der Freiheit - und der Rangunterschiede. Der Hut erhöhte seinen Träger, verkörperte gewissermaßen seine aufs Höchste gesteigerte Person und konnte damit sogar stellvertretend für den Träger stehen - denken Sie nur an den Geßlerhut, vor dem seinerseits den Hut zu ziehen Wilhelm Tell sich geweigert hat. Doch nur wenige Jahrhunderte nach dem Schweizer Freiheitskämpfer, verzichteten plötzlich alle von sich aus. Auf einmal hats "Hut ab" geheißen. Für alle. Und freiwillig. Es war die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts, besonders seit den 60er Jahren, als die Hüte zu verschwinden begannen. Bei beiden Geschlechtern. Der Hut hat gestört im Auto sagen viele. Aufwendige Herrenfrisuren und toupiertes Haar bei den Damen haben auch als Grund herhalten müssen. Aber das wars wohl nicht. Schon eher das amerikanische Ideal der Sportlichkeit, das nun den Erdball zu beherrschen begann und zu dem höchstens noch eine Baseballkappe passte. Damals noch richtigherum aufgesetzt. Kennedy war der erste amerikanische Präsident, der ohne Hut vereidigt wurde. Und die westlichen Politiker folgten brav. Die im Osten brauchten noch bis 1989. Spätestens dann aber schienen aufwendige Herren- und Damenhüte allenfalls ein Fall fürs Museum zu sein. Im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg im Allgäu können Sie 300 Jahre Hutgeschichte und dazu die spannende Hutgeschichte der Hutstadt Lindenberg besichtigen. Übrigens Udo Lindenberg (die Namensgleichheit zwischen Udo und der Stadt im Allgäu ist reiner Zufall) hat seinen Hut aus Lindenberg.
Steigerwälder Hutewaldschweine
Die Wörter aller Sprachen der Welt haben eine uralte Geschichte, eine Geschichte, die oft jahrhundertelang, jahrtausendelang in die Vergangenheit zurückreicht und von ihr erzählt. Besonders deutlich wird das in sogenannten stehenden Wendungen: Hut ab sagen wir und bekunden damit Respekt vor jemandem, vor dem wir den Hut ziehen. Der Zauberer auf den Märkten hat etwas aus dem Hut gezaubert und wer dort mit jemandem anderen seine Kräfte messen wollte, hat seinen Hut in den Ring geworfen. Wer sich dann schließlich geschlagen davonschleicht, der muss seinen Hut nehmen. Vorher kriegt er vielleicht noch einen Trostpreis, eine Feder oder sowas, die er sich an den Hut stecken kann. All solche Geschichten bewahrt die Sprache. Mit dem Hut im eigentlichen Sinn hat die Hut nichts zu tun - obwohl sie sich mit ihm die gleiche Wortherkunft teilt. Die Hut oder Hutung, wo man buchstäblich auf der Hut ist, das war in früheren Zeiten einmal Teil eines Gemeinschaftsbesitzes, der zu jedem Dorf gehörte und gemeinschaftlich bewirtschaftet wurde: Allmende heißt der Fachausdruck dafür - ein Wort, das mit allgemein zusammenhängt. Neben Gewässern oder Wiesen gehörten dazu auch Wälder - die allerdings ganz anders ausgesehen haben als unsere heutigen. Im Frühjahr hat man Großvieh hineingetrieben, das die jungen Triebe des Baumnachwuchses verbissen hat. So entstanden aufgelichtete Wälder, oft mit riesigen Eichen, Buchen; Kastanien oder Wildobst bestanden, deren energiereiche Früchte dann im Sommer und Herbst der Kleinviehmast dienten. Die Eichelmast etwa, sorgte bei den Schweinen für den rechten Speck, bevor sie im Winter geschlachtet wurden. Erst als Anfang des 20. Jahrhunderts zuerst Stallhaltung und dann Kraftfutter aufkamen, begannen diese uralten Teile der Kulturlandschaft zuzuwuchern bis zur Unkenntlichkeit. Schließlich wurde alles mit Fichten aufgeforstet. Im mittelfränkischen Steigerwald aber haben sich einige dieser Hutewälder erhalten. Und dort versuchen jetzt einige Landwirte, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Zum Wohl für Tier und wertvoller Kulturlandschaft. Hutewälder sind aber auch ohne Vieh beeindruckende parkartige Landschaften, perfekt für kleine Spaziergänge und große Wanderungen. Auf dem Hutewaldweg südlich von Iphofen zum Beispiel. Hier gibt es nähere Informationen zum Steigenwälder Schwarzerle.
Bodenmaiser Schachten
Man möchte es nicht glauben - aber der vielgerühmte deutsche Wald ist ein Mythos. Hochwald, wie wir ihn heute kennen, war - zumindest in den letzten 1500 Jahren - äußerst selten; und Urwald hats höchstens in den allerunzugänglichsten Gebirgsregionen gegeben. Vor allem aber war viel weniger Fläche überhaupt mit Wald bestanden. Denn seit es Bauern gibt, also bei uns seit rund 6000 Jahren, wurde der Wald immer intensiv genutzt. Ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind Hochwälder, vor allem auch sogenannte Urwälder, nicht besonders artenreich. Erst die intensive Nutzung, also der Wechsel von der Natur- zur Kulturlandschaft, hat die Kleinteiligkeit und Vielfalt entstehen lassen, die seltene Pflanzen und Tiere brauchen und die wir heute so schmerzlich vermissen. Oft waren durch die intensive Nutzung die Wälder so ausgedünnt, dass bloß noch einzelne Baumgruppen eine größere offene Lichtung umstanden. Solche Landschaften nannte man dann Schachen oder Schachten. Ortsnamen, wie Schechen oder die Königshütte Ludwigs II. am Schachen erzählen heute noch davon. Schachen oder Schachten gibt’s vor allem in Gebirgsregionen. Sie liegen nicht so hoch wie die ganz baumfreien Almen, erfüllen aber eine ähnliche Funktion. Auf den Schachten in Bodenmais im Bayerischen Wald sind heute noch wie in alten Zeiten Hirten auf der Hut. Große Forstbetriebe, die heute Holz zu Geld machen wollen, sehen die traditionelle bäuerliche Form der Waldnutzung nicht so gern. Umso lieber ist sie Pflanzen, Tieren und Menschen, umso bedeutender für die Vielfalt von Natur und Kultur. Und umso wichtiger ist es, nicht dem Märchen aufzusitzen, dass nur Hochwald oder gar Urwald richtiger Wald ist.
Arzneipflanze Sonnenhut
Praktisch alles, was wir heute wissen, ist ein Werk der Tradition. Manche Tradition dauert erst wenige Jahre, woanders handelt es sich um uralte Weisheiten, viele Jahre lang gehütet, die uns auf die eine oder andere Art überliefert worden sind. Erst die immer neuen Schübe der sogenannten Aufklärung haben zu allen möglichen Traditionsbrüchen geführt. Nehmen Sie zum Beispiel die Medizin: Als im Spätmittelalter die Ausbildung von Heilkundigen Sache der Universitäten wurde, da wollten die frischgebackenen Doctores Ärzte nichts mehr wissen von alter Heilpflanzenkunde, gehütet von Abbetern und sogenannten Quacksalbern. Sie schlugen einen wissenschaftlichen Weg ein, der geradewegs zu den riesigen Erfolgen der heutigen Medizin führte. Wieviel dabei aber an durchaus auch Bewahrenswertem verlorengegangen ist, das beginnen wir erst in den letzten Jahrzehnten wieder zu ahnen. Wo man heute geneigt ist, manchmal mit der chemischen Kanone auf Krankheitsspatzen zu schießen, da hat man sich früher einfach eines alten Hausmittels bedient. Vor dem Wacholder niederknien und vor dem Holunder den Hut ziehn hats früher bei uns geheißen, wenn es um wichtige pflanzliche Anlaufstellen für Gesundheit geheißen hat. Auf der anderen Seite des Atlantiks wiederum haben die Ureinwohner Amerikas - und damit sind wir wieder beim Thema - den Roten Sonnenhut kultisch verehrt, mit dem sie alle möglichen kleinen Wehwehchen und großen Krankheiten kuriert haben und der ihnen zu sprichwörtlicher Gelassenheit verholfen hat - selbst bei Schlangenbissen: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Heute gilt der entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkstoff aus dem Sonnenhut als anerkanntes Heilmittel. Abgesehen davon ist der Sonnenhut, wie er etwa in den altehrwürdigen Bamberger Gärten, zum Beispiel in der Staudengärtnerei von Johann Strobler, kultiviert wird, eine prächtige Staude und eine Zier für jeden Garten.
Wein aus dem Gipskeuper
Als göttliches Heilmittel schlechthin hat schon in der Antike der Wein gegolten. Bei den Griechen war Dionysos der Gott des Weines. Dionysos - wörtlich heißt das nichts anderes als Gottessohn - galt als Sohn der göttlichen Jungfrau Persephone und war ein alter ego des großen Sonnengotts Apoll. Der starb alljährlich im Herbst den Wintertod. Als sein eigener Sohn Dionysos begann er dann mit der Wintersonnenwende tief aus der Unterwelt heraus wieder zu wachsen, bevor er im Frühjahr in Form des Weinstocks neue Blätter trieb. Um Dionysos auferwecken zu können, suchten die Priester in der Mittwinternacht heilige Höhlen auf, wo der göttliche Sohn in einer Getreideschwinge schlief. Man kann dabei an die Höhle von Betlehem und an den christlichen Gottessohn denken – aber wer käm dabei schon auf den Stollen eines Gipsbergwerks? Nun, ebenso wie ihre antiken Vorfahren wissen halt auch die unterfränkischen Winzer, was sie, beziehungsweise ihre Weine, am Boden haben. Terroir nennt man das heute: Es gibt Muschelkalk, Buntsandstein oder Keuper. Und letzterer ist nichts anderes als Gips. Vor allem im Steigerwald werden seit Jahrhunderten auf dem Gipskeuper Weintrauben geerntet. Und seit ein paar Jahren bringen drei junge Winzer ihren fertigen Wein in den Keuper, sprich in einen alten Gipsstollen, um ihn dort auszubauen und wie ihren Augapfel zu hüten. Daraus wird ein rarer Tropfen, den es sich auch im eigenen Weinkeller zu hüten lohnt. Maximal 500 Flaschen gibt’s von jedem Wein.
Mut zum Hut
Jetzt haben wir - vom Hut zum Hüten - einen weiten Bogen geschlagen. Aber so, wie Dionysos und Apoll sich abwechseln im Jahreslauf, so kehrt auch diese Sendung wieder an ihren Anfang, zum Hut im eigentlichen Sinn, zurück. Totgesagte leben länger hab ich gesagt. Und beim Hut stimmt das bestimmt. Unübersehbar hat er sich in den letzten Jahren wieder Terrain zurückerobert. Einen gehörigen Anteil daran hat Ute Patel-Missfeldt aus Neuburg an der Donau. Sie wollte den Hut wieder da hinbringen, wo er hingehört: Auf den Kopf. Dazu hat sie 1998 in Neuburg die Hutschau "Mut zum Hut" gegründet. Im Lauf der Jahre ist daraus eine einzigartige Messe geworden, die größte Hutschau Deutschlands. Heuer musste sie aus Platzgründen umziehen nach Ingolstadt ins dortige Neue Schloss. Startschuss ist am 24. September.
Zum Schluss
Übrigens: Der 15. September ist offizieller Huttag - zumindest in Amerika, wo solche absurden Gedenk- und Feiertage erfunden zu werden pflegen. Angeblich hat man an diesem Datum früher den sommerlichen Strohhut gegen den wärmeren Filzhut ausgetauscht. Heutzuztag wärma froh, wenns noch Hüte aufhätten und nicht bloß depperte Kappe. Aber das hamma ja schon bedauert. Naja. Sollns uns doch aufn Hut steign…