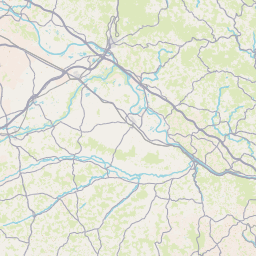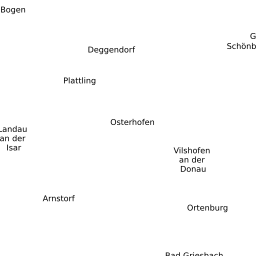Vergangenheit und Zukunft von Omas Ökologie Motorrad & Hühnerstall
"Fridays for Future" wirft Eltern und Großeltern vor, die Umwelt auf Kosten ihrer Kinder und Enkel rücksichtslos zerstört zu haben. Unser Feature fragt: Wie ökologisch korrekt oder unökologisch war die bayerische Oma noch Mitte des 20. Jahrhunderts? Und: Gibt es einen Weg zurück?
"How dare you! Wie könnt ihr es wagen! Ihr zerstört unsere Zukunft!". Wie soll man auf diesen Vorwurf von Greta Thunberg reagieren, wie soll man damit umgehen, wenn Fridays for Future voll "Feuer und Flamme" für das Klima streikt und man selbst zur Generation Oma und Opa gehört? Man hat doch immer versucht, sein Bestes zu tun? Und plötzlich ist man schuld am Klimawandel. Und das ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den man einem heute machen kann. Klimawandel, das bedeutet praktisch Weltuntergang, zwei Grad mehr Erderwärmung heißt 50 cm höherer Meeresspiegel, drei Grad mehr und New York gibt‘s nicht mehr, unter Wasser, Atlantis? Aber haben die Jungen Recht? Wie war das denn, damals, als die Omas und Opas von heute jung waren? Und was haben sie falsch gemacht?
"Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist ne ganz patente Frau."
Titelzeile eines Kinderlieds
"Patent" war einmal das, was heute "cool" ist. Und ja: Oma und Opa, Uroma und Uropa waren auch einmal cool, haben das Beste für sich und ihre Nachkommen gewollt. Aufbauen, Wohlstand, gleiche Rechte für Frauen, ein besseres Leben. Und jetzt? Sind sie auf dem Holzweg? Haben sie die falsche Abzweigung genommen? Damals, als das Motorrad im Werkzeugschuppen stand und Autos nur für ein paar wenige, wohlhabendere waren - die "besseren Leut".
"In Wiesau gabs drei Autos… der Doktor hat auf jeden Fall ein Auto gehabt, wie’s mit dem Apotheker war bin ich mir nicht sicher, der Bürgermeister hätt i gmoint hätt eins gehabt, aber es gab fast keine Autos. Es war ruhig, gab‘s nichts, gab keine Umweltverschmutzung, gab keinen Plastikmüll."
Heidi Scherm
"Auf den Komposthaufen ist alles drauf kemma.... wenn man keine Viecher gehabt hat, hat mans auf den Kompost getan. Ein Jahr lang ist der dann, verrottet ist der, und der ist dann später wenn er fertig war, ungefähr nach einem Jahr, ist der dann auf die Gemüsebeete kemma, als Dünger, als Erde. Des war direkt dann a Humus, des war ein ewiger Kreislauf."
Erika Krix
Aber eines Tages stand da plötzlich Konkurrenz aus Blech im Heustadel. Zwischen Hühnermist, Stroh und Spinnweben konnte man einen fremden, betörenden Geruch wahrnehmen, den Geruch von Metall, Kunststoff, Öl und Benzin. Direkt neben Ziegenstall und Hühnerverschlag stand die Verheißung einer neuen Freiheit. Der Traum von der Mobilität für viele hatte begonnen, die Motorisierung hatte im Hühnerstall Einzug gehalten. Niemand wär damals auf die Idee gekommen, sich über die Folgen des Aufschwungs Gedanken zu machen, man träumte von Fahrten ins Fichtelgebirge oder ans Meer nach Italien. Die erste Postkarte aus dem Italienurlaub war eine Sensation, da lief noch die ganze Familie zusammen, um andächtig zu staunen. Konsumrausch, Massenproduktion und Müll waren keine Themen auf der Tagesordnung. Der Horizont war voller Möglichkeiten, reinstes Blau.
Und endlich gab es auch für einfachere Leute die Hoffnung, ein bisserl mehr auf den Teller zu kriegen, als bis jetzt gewohnt. Essen wegschmeißen so wie das heute passiert, tonnenweise, verbot sich von selbst. Essen war teuer. Wenn es irgend möglich war, war man Selbstversorger, hat man einen Garten gehabt und wenns nur ein kleines Stück war. Kaufen musste man da gar nicht mehr so viel. Und wenn doch - dann im Krämerladen und größtenteils unverpackt. Man ist mit der Milchkanne und dem Netz einkaufen gegangen und mit der Butterdose. Und die Essiggurken hat die Krämerin in ein Butterpapier gewickelt, das war so ein mit Wachs getränktes Papier. Und wenn man mal was zum Wegschmeißen gehabt hat, dann gab‘s eine Methode der ersten Wahl, dann kams in den Ofen. Doch mit dem Wirtschaftswunder kam auch der Müll, erst unorganisiert und ein bisserl wild.
"Wenn man von Wiesau-Fichtenschacht nach Schönhaid is da warn a so Halden wo man das Zeig hingschütt hat. Wenn im Winter der Schnee drauflag auf diesen Bergen, dann bin i da mit die Schi runtergfahrn. Auf so einen Müllplatz, da haben sie ja dann die Schule hinbaut. Das war ein Riesenplatz, da konnst alles hinschmeißen. Und da hat man allweil gespielt und gwühlt, wie jetzt die Kinder in Bukarest oder wo, die am Müll umanand rennen. Dann hama a gschaut was da liegt, ob des no brauchbar is oder so."
Anna und Heidi Scherm
Wunder haben halt manchmal zwei Seiten, auch das Wirtschaftswunder. Irgendwann musste man sich nicht mehr jedes Stückl Wurst vom Mund absparen. Und man war mit einem Mal mobil. Dazu das Fernsehen, noch in Schwarzweiß, aber immerhin. Der Blick von Wiesau-Fichtenschacht, wo die Scherms damals gewohnt haben, in die Welt war auf einmal frei. Metallschüsseln werden durch Plastikschüsseln ersetzt, Hölzerne Schneidbretter und Tischplatten durch solche aus Resopal und Kunststoff. Für die Oma hieß das ein bisschen Aufbruch in die Freiheit. Elektrische Haushaltshelfer sorgten dafür, dass es in der Küche einfacher wurde und der Waschtag hat nicht mehr drei Tage gedauert wie früher, sondern hat sich mehr und mehr fast nebenbei erledigt.
In den Städten dagegen waren Umweltverschmutzung und praktizierter Umweltschutz schon seit Jahrhunderten ein Thema. Als im Mittelalter Wirtschaft und Bevölkerungsdichte in den städtischen Ballungszentren rasant zunahmen, wurde auch der anfallende Müll zu einem immer größeren Problem für die Stadtbewohner und ihre Gesundheit. Noch im 19. Jahrhundert entsorgten die Bewohner der Städte ihren Abfall in tausenden Müllgruben, die meist auf den Grundstücken der Wohnhäuser lagen. Wo auch sonst? Und das stank zum Himmel. Die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal. Durch das undichte Grubensystem, drangen Fäkalien von Mensch und Tier in den Untergrund, ins Grundwasser. Die Entsorgung des täglichen Unrats in städtische Bäche und Gräben, verwandelten diese in stinkende Kloaken. Die Brunnen waren vergiftet.
Große Städte wie München sind noch im 19. Jahrhundert ein Seuchen-Hotspot, Cholera und Typhus grassieren, sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Das ruft 1874 die Stadtoberen auf den Plan. Konzepte für eine moderne Stadthygiene werden entwickelt. Das Programm soll die Wasserversorgung, Maßnahmen zur Reinhaltung des Bodens, die Errichtung eines städtischen Schlacht-und Viehhofs und den Bau eines stadtweiten Kanalnetzes umfassen. Bliebe noch der Hausmüll. Wohin damit?
Auf Betreiben von Magistratsrat Alois Panzer erlässt die Stadt München am 14. April 1891 eine "ortspolizeiliche Vorschrift über die Lagerung und Wegschaffung des Hausunrats". Ab sofort darf Hausmüll nicht mehr in Gruben abgelagert, sondern muss zweimal wöchentlich zur Abfuhr bereitgestellt werden. Einachsige Karren in Pferdestärke, die legendären "Harritschwagen" sammeln den Müll ein, verfrachten ihn zur Verladung an die Landsberger Straße, von wo er dann auf der Schiene zur Puchheimer Sortierfabrik transportiert wird, um dort weiterverwertet zu werden. Glas, Papier, Lumpen, Leder, Gummi, Kork und Metalle werden von Hand aussortiert, Holz und andere brennbaren Substanzen in der Dampfkesselanlage verfeuert. Verwertungsquote: beinah 100 Prozent. München hat sein erstes städtisches Abfallkonzept.
Auf dem Land gehen die Uhren langsamer. Eine professionelle Müllbeseitigung ist für die ländliche Bevölkerung in Bayern noch lange unbekannt. Mülltonnen oder ähnliches, gibt es auch nach dem 2. Weltkrieg noch nicht.
"Papier hat man verbrannt, hat man hergenommen zum Anheizen. Tageszeitung oder was, hat man dann hergnommen zum Abdecken, im Garten, wenns kalt war, Frost, und so, damit die Pflanzen geschützt waren. Was man vom Gemüse so weggeputzt hat, Kartoffelschalen, oder wenn irgendwo mal ein paar Nudeln übriggeblieben sind, das hat man in einen Kübel reingetan, und das hat jemand geholt, der Schweine gefüttert hat. Alte Töpfe und Zeug, was nicht mehr gebraucht wurde, alte Betten, so Federbetten, ist in den Wald geschmissen worden: A Loch graben und einegeschmissen."
Erika Krix
Was selbst nicht wiederverwertet werden konnte, aber noch einen Wert repräsentierte, hat man weggegeben. Vor allem Altkleider und Textilien waren in der Nachkriegszeit ein äußerst begehrter Rohstoff und Abnehmer leicht zu finden. Auch für Metallschrott gab es viele Sammler, Hausierer mit Handwägen. Ab den 60er Jahren dann wurden von caritativen Organisationen regelmäßige Sammlungen organisiert. Die Recyclingfirma Wittmann in Geisenhausen bei Landshut entstand aus dieser Bewegung. Andreas Wittmann hat den Betrieb von seinen Eltern übernommen, die bereits in den 1960er Jahren mit Unterstützung der Kirche und dem Roten Kreuz angefangen hatten, Straßensammlungen zu organisieren und den Haushalten das abzunehmen, was diese nicht mehr brauchen konnten. Was als kleines Familienunternehmen begann, ist heute ein stattlicher Entsorgungsfachbetrieb mit insgesamt vier Filialen.
"Wir machen in der Woche ca. 15 LKW Ladungen, und die gehen hauptsächlich nach Italien und nach Osteuropa. Wir lagern das hier jetzt zwischen, und am Montag, kommt der Lkw aus meinetwegen Rumänien. Und wir liefern dann die Ware zu unseren rumänischen Kunden, das ist ein Sortierbetrieb, und die wiederum betreiben in großem Stil auch Second Hand Shops in Rumänien, so dass man ungefähr 50/60% von dem was wir da sammeln, das wird auch wieder getragen dann da dorten." Andreas Wittmann
In seinen Filialen recycelt Wittmann außer gefährlichem Sondermüll so ziemlich alles: Altpapier, Glas, Plastik, Sperrmüll, Bauschutt, Holzabfälle und sogar Grüngut. Kreislaufwirtschaft nennt man das. Textilien die man nicht mehr tragen kann, werden zu Putzlappen verarbeitet. Das betrifft 20% der gesammelten Textilien. Insgesamt werden ca. 90-92% des gesammelten Materials recycelt lediglich 8% sind Müll und geht in die Müllverbrennung.
Ein Problem bleibt der Kunststoff, das Plastik. "Ein Joghurtbecher im gelben Sack ist ein Joghurtbecher in der Müllverbrennung", sagt so mancher Abfallexperte ein bisschen sarkastisch. Und da ist was dran: Wenn Plastik mal in der Umwelt ist, wird man das Zeug kaum mehr los. Vieles davon braucht man aber, in der modernen Medizin geht ohne Kunststoff fast gar nichts, sterile Handschuhe, Spritzen, Operationen - ohne Kunststoffe nicht denkbar. Mittlerweile gibt es ein paar Dinge, die man tun kann, wenn man Verpackungen aus Plastik vermeiden will. Man kann zum Beispiel in Unverpackt-Läden einkaufen, oder alles was man konsumiert auf die Waagschale legen, bevor man was kauft. Aber ist das nicht ein bisschen viel Aufwand? Kostet das nicht eine Unmenge Zeit?
"Also wenn mans schlau anstellt, hat man sogar mehr Zeit. Die ganzen trockenen Sachen, die kann ich nach Hause tun dann brauch ich bloß noch mir in der Nähe mir Obst und Gemüse frisches Zeug eben holen. Den Rest hab ich zuhause, d.h. ich muss dann gar nicht so oft einkaufenfahren. Gehen wir mal davon aus wir würden nur unsere Sachen verpackt kaufen können, und wir schmeißen im Durchschnitt 30% an Lebensmitteln weg, dann wärs doch schlau ich würde Lebensmittel ordentlich verwerten, dann muss ich 30% weniger Verpackung nachkaufen, weil ich 30% weniger Lebensmittel nachkaufe, weil ich ordentlich verwertet habe. Was meinen Sie, woher ich das habe? Von meiner Oma! Wir waren letztens in einem Museum und da hatten die einen Raum aufgestellt wie man früher eingekauft hat. Und da hatten die Abfüllanlagen wie man sie heute bei nem Unverpackt-Laden hatte, da hab ich schon gestaunt. Ja und man tut heute so als wär das so diese komplett neue Idee, aber nein wir kommen schon auch back to Basic. Zwar nicht in allen Sachen, also es ist gut, dass es so ne Mischung gibt aus Technik und back to Basic."
Stefanie Rassow-Kiessling, Projekt Zero Waste, produziert mit ihrer Familie keinen Müll
Zurück aufs Grundlegende, Notwendige mag heute "Back to Basic" heißen. Im Prinzip aber bedeutet es das Gleiche: Verzicht auf Überfluss. Dabei war und ist es gerade der Überfluss, der Luxus, das Schlaraffenland, das der Mensch schon immer ersehnt hat. Aber ist dieses so flott klingende "Back to Basic" nicht eigentlich Wunschdenken von einer romantisch verklärten heilen Welt. Eine Welt, in der die Oma übrigens nie gelebt hat. Sie wollte weg aus dieser Welt, nach vorn mit Vespa, Isetta und Goggo. Gas geben ohne zu bremsen. Keine Frage aber: Sich zusammen mit anderen aktiv dem Wunschtraum nach einer besseren Welt hinzugeben kann, ähnlich wie Fridays for Future, ein großes Gemeinschaftserlebnis sein, in unserer Zeit, die zur Vereinzelung neigt.
"Müllvermeidung und Umweltschutz, das kann einen so schön zusammen bringen… Ich hab ganz viele Leute über die Müllvermeidung kennen gelernt. Und wir arbeiten zusammen. Zum Beispiel eine Kleidertauschbörse, die macht jetzt die eine Freundin, mit der anderen mach ich die Schenk-und Tauschparty, wo man alle Dinge hinbringen kann die man nicht mehr braucht, und dann gibt’s noch ne Saatguttauschbörse, und das Reparaturcafé, und das sind einfach so ein paar liebe Leute, die mir so an s Herz gewachsen sind und richtig gute Freunde geworden sind. Und ich finde das hat einen ganz tollen Aspekt, der einen zufrieden macht. Das macht ein gutes Klima, gibt Lebensfreude."
Stefanie Rassow-Kiessling, Projekt Zero Waste
Ob das reicht, den Planeten zu retten? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall fragt sich jede Generation, wie sie in Zukunft leben will. Und die Ziele changieren dabei zwischen religiösen Träumen und Schlaraffenlands-Utopien wie bei den Menschen des Mittelalters, Konsumutopien wie bei der Oma der Nachkriegszeit und Zukunftsvorstellungen bei heutigen jungen Leuten, die durchaus auch an Utopien eines Goldenen Zeitalters erinnern können.
"In meiner Utopie gibt’s kürzere Arbeitszeiten, das Glück der Menschen ist nicht mehr an Konsum orientiert, und nicht mehr der gilt als der beste und tollste, der sich das meiste leisten kann. Wir besinnen uns zurück auf das Soziale, auf das Miteinander aufs Solidarische. In meiner Utopie würd ich gern morgens aufwachen, mit dem Elektrobus in die Schule fahren, die nicht mehr am Leistungsdruck orientiert ist, glücklich mit meiner Familie im Nahversorger im Dorf Biolebensmittel kaufen, und abends mit Freunden im Dorfwirtshaus sitzen können: Das Leben wie Oma, nur besser. Und ich finde, das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Welt. Die Leute, die kannten damals das Leben. Und wenn wir im Geist heute so frei bleiben wie wir sind, und das auch vor Ort leben können dann wär das für mich schön. Für mich wärs eine schöne Utopie."
Sara Schöps, Schülerin am Hans Carossa Gymnasium in Landshut
Die Oma hat viele dieser Träume noch persönlich erlebt. Und fand die meisten eher nicht so erstrebenswert. Deswegen war sie schnell unterwegs. Und ein Blick in den Rückspiegel zeigt, sie hat manches erreicht. Vieles zum Guten, aber nicht alles. Jede Generation muss sich erlauben, den Fuß vom Gas zu nehmen und auf den Weg in die Zukunft zu schauen. Ruhig auch mit Hilfe der Routenplaner von Apple und Google Maps, die, genau betrachtet, ja auch aus Omas Küche stammen. Denn die Oma war nicht nur die, die ohne Bremse und ohne Licht im Hühnerstall unterwegs war, sie war vor allem auch eine sehr patente, eine echt coole Frau.