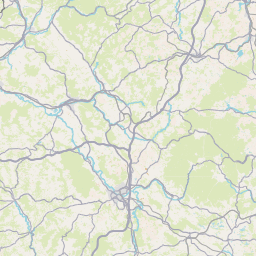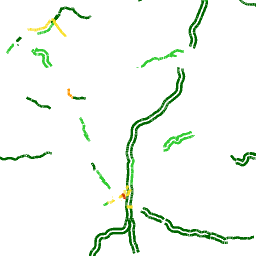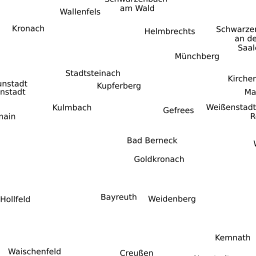Gerechtigkeit im Wandel der Philosophie Das Thema

Schon in der Antike waren die Vorstellungen von Gerechtigkeit vielfältig. Ein auffallender Unterschied bestand dabei zwischen den frühen ägyptischen und assyrischen Hochkulturen auf der einen Seite, in denen sich die Gerechtigkeit von einer göttlichen Weltordnung herleitete, und dem Griechenland der archaischen Zeit von etwa 800 bis 500 vor Christus. Denn die Götter, in den frühen griechischen Epen wie der Odyssee, handelten keineswegs nach einem absichtsvollen Gesamtplan, sondern griffen - nicht zuletzt aus Eigeninteresse - situationsbedingt zu Gunsten oder Ungunsten der Menschen ins Weltgeschehen ein. Die philosophische Auseinandersetzung der Griechen mit der Frage der Gerechtigkeit setzte im fünften Jahrhundert vor Christus mit den Sophisten ein, einer Gruppe von Philosophen, die den Menschen, seine Ethik und seine Erkenntnismöglichkeiten ins Zentrum ihrer Betrachtungen rückte. Mit unterschiedlichen Ansätzen erklärten sie Gerechtigkeit als natürliches oder gesellschaftliches Phänomen.
Einigen von ihnen gibt der große griechische Philosoph Platon (428/427-347 v. Chr.) - selbst kein Sophist - in den von ihm schriftlich überlieferten "Dialogen" das Wort. So kommt etwa Kallikles von Acharnai dort zu dem Schluss, dass Gerechtigkeit von Natur aus einer Bevorzugung der Stärkeren entspreche. Thrasymachos von Chalkedon hingegen entlarvt die Gerechtigkeit als Instrument der Herrschenden, mit dem sie ihre Interessen sicherten.
Platons Vorstellung von Gerechtigkeit
Platon dagegen betonte zum ersten Mal, dass Gerechtigkeit, auch eine Frage der persönlichen Haltung des Einzelnen ist. In seinem Werk, "Der Staat" ("Politeia") richtete er den Blick aber zugleich auf die Gemeinschaft. Platon legte dar, dass die Gerechtigkeit für die Harmonie der menschlichen Seele verantwortlich ist, indem sie die Balance hält zwischen deren drei Teilen: dem muthaften, dem denkenden und dem begehrenden Teil. Analog dazu sah er den Staat dreigeteilt in einen Stand der "Wächter", also Krieger, einen Stand der Philosophenherrscher und einen Erwerbsstand der Handwerker und Bauern. Den Ständen entsprechen bei Platon - wie den Seelenteilen - ihre jeweiligen Tugenden: die Tapferkeit, die Weisheit und die Besonnenheit, wobei der Erwerbsstand letztere mit den beiden anderen Ständen teilt. Die Gerechtigkeit, als vierte und höchste der sogenannten Kardinaltugenden, vereint die Teile des Staates zu einem vernünftigen Ganzen. Wichtig war für Platon dabei ein weiterer Aspekt der Gerechtigkeit: dass "jeder einzelne nur einen öffentlichen Beruf in der Stadt ausüben soll, nämlich den, zu welchem seine Natur am besten geeignet ist". Denn Gerechtigkeit sei, "dass jeder das Eigene und Seinige hat und tut", lässt Platon seinen Lehrer Sokrates in "Der Staat" erklären.
Aristoteles
Den Unterschied zwischen der allgemeinen Definition der Gerechtigkeit als "bester unter den Tugenden" und ihren besonderen Aspekten, der gerechten Verteilung von Aufgaben und Gütern einerseits, und des angemessenen Ausgleichs für verkaufte oder geschädigte Güter andererseits, arbeitete Platons Schüler Aristoteles genauer heraus.
Er differenzierte dabei, wie Platon, zwischen zwei Arten von Gleichheit im Zusammenleben der Menschen: Die eine ist rein zahlenorientiert, sie ist die arithmetische Gleichheit und gilt etwa unter Geschäftspartnern, von denen der eine dem anderen für ein überlassenes Gut einen entsprechenden Wert schuldet, oder wenn der einer den anderen schädigt, und für den verursachten Schaden aufkommen muss. Die zweite Form der Gleichheit hat dagegen qualitativen Charakter und ist bei der Verteilung von Gütern und Ämtern ausschlaggebend. Dabei steht für Aristoteles wie für Platon demjenigen mehr zu, dessen allgemeine Verdienste größer sind. Viele der grundlegenden Überlegungen Platons und seines Schülers Aristoteles finden sich noch über 500 Jahre später bei dem römischen Rechtsgelehrten Ulpian (170-223) wieder, der drei Grundsätze des Rechts formulierte:
"Lebe ehrenhaft! Tue niemandem Unrecht! Gib jedem das Seine!"
Ulpian
Spätantike und Mittelalter - Platons und Aristoteles’ Erben
Noch in der Spätantike und im Mittelalter war die platonische Gerechtigkeitskonzeption von bedeutendem Einfluss. Platons Vorstellung von der Harmonie der Seele findet sich bei dem Neuplatonisten Plotin (um 205-270) ebenso wieder wie beim Kirchenvater Augustinus (354-430). Allerdings unterschieden beide zwischen einer noch unvollkommenen Gerechtigkeit auf Erden, und einer höheren, wahren - bei Augustinus himmlischen - Form der Gerechtigkeit. Der Grund für den unvollkommenen Charakter der Tugenden unter irdischen Bedingungen lag Augustinus zufolge in der Erbsünde der Menschen. Entsprechend war in seinen Augen die wahre Gerechtigkeit von Gottes Gnade abhängig. Eine eigenständige Definition der Gerechtigkeit fand der Theologe Anselm von Canterbury (1033-1109). Für ihn wurde Gerechtigkeit erreicht, indem das moralisch als richtig Erkannte um seiner selbst Willen getan wurde. Ein wichtiger Schritt für die christliche Gerechtigkeitslehre war die Übersetzung von Aristoteles "Nikomachischer Ethik" ins Lateinische um 1246/47 und der Kommentar des Albertus Magnus (um 1200-1280) dazu. Durch Magnus und seinen Schüler Thomas von Aquin (um 1225-1274) fand Aristoteles’ differenzierte Sicht der Gerechtigkeit Eingang in die christliche Theologie.
"Der Mensch ist des Menschen Wolf"
Mit der Neuzeit wuchs die Skepsis unter den Philosophen, ob der Mensch überhaupt daran interessiert sei, sich seinem Nächsten gegenüber gerecht zu verhalten. Das Gegenteil sei der Fall, stellte der Engländer Thomas Hobbes (1588-1679) fest, der dem neuen, an Erfahrungen orientierten, wissenschaftlichen Denken verpflichtet war: Der Mensch sei "des Menschen Wolf" und der "Krieg aller gegen alle" der natürliche Zustand unter den Menschen, die jeweils keinen freien Willen besitzen und von ihrem egoistischen Selbsterhaltungstrieb beherrscht sind. Um der daraus resultierenden Unsicherheit ein Ende zu bereiten, müssen die Menschen nach Hobbes ihre Gewalt gemeinschaftlich einem Staat übertragen, mit dessen Rechtsordnung für ihn Gerechtigkeit im Wesentlichen überhaupt erst etabliert werden kann.
Aufklärung - "Zurück zur Natur" des Menschen
Auch der Schweizer Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) schlug einen solchen "Gesellschaftsvertrag" vor. Doch anders als für Hobbes, der im Staat vor allem auch einen Garanten für den Rechtsschutz des individuellen Eigentums sah, war für Rousseau der Privatbesitz die Wurzel menschlichen Übels. Vom Moment der ersten Besitznahme an erfolgt für Rousseau die Entwicklung der Gesellschaft weg von einem nahezu paradiesischen, vorzivilisatorischen Naturzustand hin zu einer immer ausgeprägteren gemeinsamen Herrschaft "der Reichen" über die Armen und Einfältigen. Der Staat dient dabei für Rousseau zunächst nur als Schutz für die Ungleichheit von arm und reich. Um ihn zu einem gerechten Staat zu machen, bedarf es eines "Gesellschaftsvertrags", der durch die freie Übereinkunft aller Bürger entsteht. Durch den Vertrag unterstellen sich die Bürger dem gemeinsamen Willen ihrer Mehrheit, dem Gemeinwillen, der die Grundlage für ihre Gesetze ist.
"Der Bürger willigt in alle Gesetze, selbst in die, die gegen seien Willen durchgegegangen sind, selbst in die, die ihn bestrafen, wenn er eins davon verletzt. Der beständige Wille aller Staatsglieder ist der Gemeinwille; durch ihn sind sie Bürger und sind frei."
Rousseau
Auch für den deutschen Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) kann "die gesetzgebende Gewalt nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen". Auf die Frage nach der Gerechtigkeit gibt sein allgemeines Sittengesetz, "der kategorische Imperativ" Antwort:
"Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne."
Kant
Gerechtigkeitstheorie im 19. und 20. Jahrhundert
Während Gerechtigkeit für Rousseau bedeutete, die dem Menschen angeborene Gleichheit und Freiheit gesellschaftlich zu verwirklichen, entstand für Hobbes Gerechtigkeit eigentlich überhaupt erst im Rahmen einer staatlichen Rechtsordnung. In den unterschiedlichen Ansätzen Hobbes’ und Rousseaus’ klang damit eine Frage an, die den Gerechtigkeitsdiskurs seit der Antike prägte: Die Frage, ob Gerechtigkeit als ethisch maßgeblicher Wert Teil einer überstaatlichen, natürlichen, mitunter göttlichen, Ordnung ist, oder ob sie erst das Ergebnis einer gesellschaftlichen Rechtsordnung ist. Die sogenannten Rechtspositivisten des 19. und 20. Jahrhunderts, gingen davon aus, das vom Staat gesetzte, positive Recht, besitze eine Eigenständigkeit gegenüber moralischen Normen wie etwa der Gerechtigkeit, und das positive Recht bedürfe keiner weiteren Begründung, solange es verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Zwar unterscheiden sich die verschiedenen Positionen des Rechtspositivismus darin, in welchem Maße sie das positive Recht unabhängig von der Moral sehen. Doch hat die Lehre an sich Kritik erfahren, spätestens seit die deutschen Nationalsozialisten ihre Schreckensherrschaft auch auf der Basis regulär beschlossener Gesetze begründeten.
Rousseaus kritische Beurteilung des Privateigentums und der Teilung der Gesellschaft in Besitzende und Nicht-Besitzende nahm eine andere geistige Strömung vorweg, die sich im 19. Jahrhundert etablierte, den Sozialismus. Ihr bedeutendster Vertreter, Karl Marx, stellte mit seiner Kritik an den Produktionsverhältnissen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auch deren Moral in Frage, konzentrierte sich aber auf eine Analyse der öknomischen Verhältnisse. Seine Vision einer nachbürgerlichen kommunistischen Gesellschaft aber, "jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen", lässt an Platons Gerechtigkeitsvorstellung denken.
Aktuelle Theorien zur Frage der Gerechtigkeit
Besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Gerechtigkeitsbegriff zunehmend erweitert, etwa um die Fragen der Generationengerechtigkeit oder der globalen Gerechtigkeit. Zu den wichtigen zeitgenössischen Gerechtigkeitsmodellen zählt die "Theorie der Gerechtigkeit" (1971) des amerikanischen Philosophen John Rawls (1921-2002). Er formulierte zwei Grundsätze zur Verteilungsgerechtigkeit in einer Gesellschaft: Erstens hat jeder im Umgang mit Institutionen "ein gleiches Recht auf größtmögliche Freiheit, die mit derselben Freiheit für alle vereinbar ist." Und zweitens sind soziale Ungleichheiten, bedingt durch die Institution, als "willkürlich" einzustufen, wenn nicht anzunehmen ist, dass sie sich zum Vorteil aller auswirken. Dabei müssen die "Positionen und Ämter, mit welchen diese Ungleichheiten zusammenhängen oder durch welche sie sich ergeben allen offenstehen." Um die Grundsätze des Zusammenlebens zu ermitteln, schlug Rawls unter dem Stichwort "Schleier des Nichtwissens" ein Gedankenexperiment vor: Eine Situation, die fingiert, die betroffenen Personen entschieden über die Grundsätze ohne Kenntnis davon, in welcher gesellschaftlichen Position sie ihre eigene Entscheidung betreffen würde. Ein Experiment im Sinne der sogenannten "Verfahrensgerechtigkeit". Unter diesem Begriff werden zeitgenössische Ansätze zusammengefasst, mit denen Gerechtigkeit mittels geeigneter gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse erreicht werden soll. Dazu gehört auch die Diskursethik des deutschen Philosophen Jürgen Habermas.
Er sieht vor, dass gesellschaftlichen Entscheidungen im Idealfall ein offener Diskurs aller Beteiligten vorausgeht. Dabei sollen sie allerdings nicht wie beim Modell Rawls’ dank einer "Informationsbeschränkung" "eine gemeinsame Perspektive" einnehmen, sondern "sich in die Perspektive und damit das Selbst- und Weltverständnis aller anderen versetzen". Im Diskurs wird durch Argumente und Gegenargumente ein Ergebnis gefunden wird, dem alle zustimmen können. Gerechtigkeit wird entsteht auf diese Weise nicht gemäß übergeordneten Prinzipien, sondern durch den Konsens der tatsächlich Betroffenen.