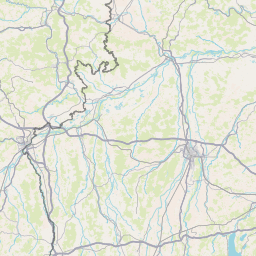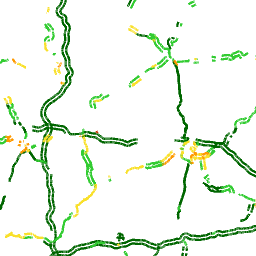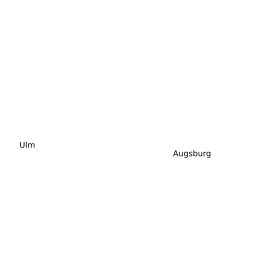Sitten und Bräuche Flüchtlinge zwischen Kultur und Gesetz
Rund eine Million Flüchtlinge kamen 2015 nach Deutschland - und mit ihnen: Kulturen, Traditionen, Bräuche. Viele Deutsche sind verunsichert. Wie passen die Sitten zum deutschen Recht? Eine Gegenüberstellung.

Ja, die Deutschen sollten fremden Kulturen eine gewisse Toleranz entgegenbringen - aber sie hat auch eine eindeutige Grenze, das Gesetz der Bundesrepublik nämlich.
Das hat der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung im Gespräch mit der BR-Nachrichtensendung Rundschau klar gemacht. Martin Neumeyer sagt, die Diskussionen müssten selbstverständlich geführt werden über Bräuche und Sitten, die vor allem Flüchtlinge muslimischen Glaubens mit nach Deutschland bringen, und die bei so manchem Bundesbürger für Unverständnis und Irritationen sorgten. Doch zugleich müsse man sie neutral führen und frei von Vorurteilen. Denn nur mit Akzeptanz auf beiden Seiten sei die Integration letztlich zu schaffen.
Islamisches Recht vs. deutsche Gesetze
Dennoch stehen sich Deutsche und Flüchtlinge oft unverständig gegenüber - zu verschieden sind die Kulturen, um binnen kürzester Zeit zu verschmelzen. Gefordert sind beide Seiten. Grundlage für einen Dialog, der auf nicht von Vorurteilen und Halbwissen geprägt ist, sind Fakten wie beispielsweise die jeweilige Rechtslage, auf der viele Bräuche basieren. Grundlage jener Traditionen von Flüchtlingen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder auch afrikanischen Staaten ist oft der Koran oder darauf basierend die strengen Gesetze der Scharia. Der Vergleich mit deutschem Recht ist fraglos problematisch, stehen sich doch ein religiöses und ein staatliches Rechtssystem gegenüber. Doch Koran und Scharia sind zugleich auch ein gemeinsamer Kultur-Nenner, der viele der Flüchtlinge eint - anders als ihre Staatsangehörigkeit.
Brauchtum und Recht - eine Gegenüberstellung
Martin Neumeyer macht klar: Es gibt keine Kompromisse, wenn es um Gewalt geht wie etwa gegen Frauen und Mädchen. Das müsse man den Menschen unmissverständlich deutlich machen. Vor allem die "Beschneidung von Mädchen, die vielleicht in manchen Ländern insbesondere in Afrika üblich ist, das geht in Deutschland nicht."
Diskussion ja, doch frei von Emotion, empfiehlt der Integrationsbeauftragte. Nur mit Akzeptanz auf beiden Seiten sei Integration zu schaffen.