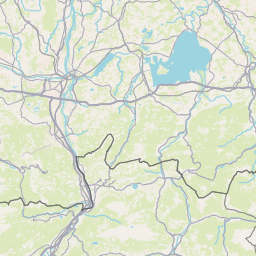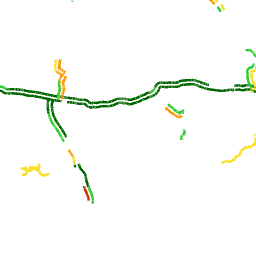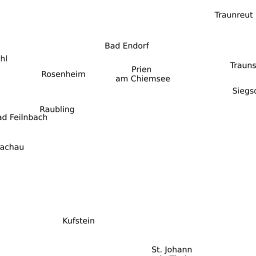Jäger im Visier Schützenhilfe für den Waldumbau
Der Wald in Bayern leidet unter Hitze und Trockenheit – und muss deshalb umgebaut werden. Die Jäger sollen dabei stärker in die Pflicht genommen werden. Doch sie wehren sich dagegen.
Die Jäger in Bayern finden es nicht mehr lustig: Das Bundesjagdgesetz wird reformiert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die Reformpläne vorgestellt: Von einer "Mindestabschussquote" ist die Rede, außerdem von einer "Verjüngung des Waldes im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen". Formulierungen, die beim Bayerischen Jagdverband (BJV) die Alarmglocken schrillen lassen. Aber warum eigentlich? Was befürchten die Jäger? Um das zu verstehen, wollen wir möglichst nah ran: Wir gehen mit auf die Jagd – mit einem der insgesamt 70.000 ehrenamtlichen Jäger in Bayern.
Auf der Jagd mit Johannes Schneider
Es ist kurz nach sechs Uhr morgens und stockfinster. Ich bin mit Johannes Schneider im Wald unterwegs. Er ist Jäger in Großharbach, in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Meine Stirnlampe wirft einen Lichtkegel direkt vor meine Füße – ich sehe braunes, gefrorenes Laub. Wenn ich meinen Kopf nach rechts oder links wende, wandert der Lichtschein über große, imposante Eichen und Buchen. Wir laufen zu Johannes Schneiders Hochsitz im Gickelhäuser Tal. Wir sind allein – denken wir. Aber aus dem finsteren Nichts gellen plötzlich Schreie – sie klingen wie heiseres, abgehacktes Hundebellen. Ein Reh hat uns bemerkt und "schreckt" – wie der Jäger sagt.
"Ich nehme an, es war eine Geiß, also ein weibliches Stück. Die schrecken meistens deutlich länger als die männlichen. Wenn man nicht weiß, dass Rehe solche Laute von sich geben, dann hört sich das ganz schaurig an. Die zieht jetzt langsam weg, das Schrecken entfernt sich. Das ist der Warnruf, dass für sie irgendetwas nicht in Ordnung war."
Johannes Schneider, Jäger
Johannes Schneider, Geschäftsführer in einem Energieunternehmen, ist seit über 40 Jahren Jäger. Als junger Mann, so erzählt er mir, sei die Jagdprüfung für ihn fast wichtiger gewesen als das Abitur. Auch sein Vater war bereits Jäger. Schneider wohnt in seinem Revier und ist fast täglich dort unterwegs.
"Wenn man hier sitzen kann in der Natur, wenn der Tag so langsam erwacht, das ist einfach schön. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen, dass man früh um fünf Uhr aufsteht, um dann um sechs Uhr im Wald zu sitzen bei minus sechs Grad. Aber das ist für mich diese Entspannung, Ruhe, Erholung – das ist Jagd. Das ist auch bei uns, in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, möglich. Natürlich gehört zur Jagd viel mehr. Ich will mich als Jäger dafür einsetzen, dass die heimischen Wildtiere auch weiter ihren Platz bei uns in der Kulturlandschaft haben. Das sehe ich als Aufgabe für uns Jäger, sich dafür einzusetzen."
Johannes Schneider, Jäger
Die Jagd – älter als der Homo Sapiens
Die Jagd ist die ursprünglichste Tätigkeit des Menschen, sie ist älter als der Homo Sapiens. Die ersten archäologischen Belege für die menschliche Jagd sind rund 1,7 Millionen Jahre alt. Die Jagd auf Tiere lieferte Nahrung und Kleidung. Aus Knochen wurden Werkzeuge hergestellt, aus Häuten Zeltplanen und Taschen. Bis ins frühe Mittelalter hinein war das Jagen in Mitteleuropa ein Jedermannsrecht. Auf dem Land, vor allem bei den Bauern, wurde davon rege Gebrauch gemacht. Ab dem achten Jahrhundert beanspruchten Könige und Fürsten das Jagdrecht mehr und mehr für sich. Das Jagen wurde ein Feudalrecht, und so blieb es eintausend Jahre lang.
Erst die deutsche Revolution von 1848 stellte eine Zäsur dar: Ab sofort war das Jagdrecht an Grundbesitz gebunden. Die gesellschaftliche Stellung des Grundbesitzers spielte dabei keine Rolle. Die Bauern bekamen damit ihr Jagdrecht zurück. Diese Bindung an Grundbesitz gilt heute noch: Großgrundbesitzer mit mehr als 80 Hektar Grund dürfen – sofern sie den Jagdschein besitzen – auf ihrem Grund selbst jagen. Alle anderen müssen sich zu so genannten Jagdgenossenschaften zusammenfinden und einen Pachtvertrag mit einem Jäger abschließen.
So wird man in Bayern Jägerin oder Jäger
Wer Jägerin oder Jäger werden will, muss in Bayern eine rund einjährige Ausbildung absolvieren – ehrenamtlich in Wochenend- und Abendkursen beim Bayerischen Jagdverband oder in einer privaten Jagdschule. Das ist bereits ab 15 Jahren möglich, die staatliche Jagdprüfung kann man dann ab 16 Jahren ablegen. Wildkunde, Biologie, Waffenrecht, Naturschutz und Tierschutz werden im Jagdunterricht gelehrt. Erfahrene Jäger nehmen die Jagd-Azubis unter ihre Fittiche. Nachwuchsprobleme gibt es nach Auskunft des Bayerischen Jagdverbandes nicht. Auch immer mehr Frauen legen die Jagdprüfung ab. In manchen Gegenden machen sie nach Angaben des Bayerischen Jagdverbandes bis zu 30 Prozent der Jungjäger aus.
Der Hauptgrund, Jäger zu werden, ist die Familientradition. Das "Jäger sein" – so scheint es – wird vor allem weitervererbt: Vom Großvater auf den Vater auf den Sohn – und immer häufiger auf die Tochter. Wer nicht aus familiären Gründen Jäger wird, den treibt in der Regel oft der Wunsch nach einem naturnahen Leben an.
"Es ist nicht etwas, was man so nebenbei macht, aus dem Büro raushupft und für eine halbe Stunde im Revier ist. Weil es auch nicht so ist, dass man, wenn man ein Tier erlegen möchte, draußen wild auf das nächste Tier schießt, das sich bewegt. Wir müssen genau wissen, wann sind die Schonzeiten, wann sind die Jagdzeiten? Ist das Tier ein Muttertier? Gibt’s andere Hintergründe, die dafür sprechen, dieses Tier zu erlegen oder auch nicht. Also die Jagd und Jägersein ist etwas, was man 24 Stunden, 365 Tage im Jahr im Herzen mitnehmen muss. Es ist wirklich eine Lebenseinstellung."
Thomas Schreder, Pressesprecher des Bayerischen Jagdverbandes
Das Bundesjagdgesetz wird überarbeitet
Was Jäger dürfen und müssen, regelt das Bundesjagdgesetz: Was sind jagdbare Tiere, welche Munition ist erlaubt. Jedes Bundesland hat darüber hinaus ein eigenes Landesjagdgesetz. Das bundesweite Rahmengesetz stammt aus dem Jahr 1952 und ist mehrmals überarbeitet und geändert worden. Im Moment durchläuft eine weitere Änderung den Gesetzgebungsprozess in Bundestag und Bundesrat: Im Entwurf ist von einer Mindestabschussquote die Rede. Jäger sollen künftig eine Mindestanzahl von Rehen pro Jahr schießen. Denn in Deutschland läuft ein gigantisches Wiederaufforstungsprogramm, um durch Trockenheit und Hitze entstandene Waldschäden zu beheben. Rehe und andere Wildtiere sollen die Aufforstung nicht gefährden.
"Das ist angesichts der immensen Jahrzehnte-Aufgabe, die wir haben mit der Wiederbewaldung, natürlich ein enormer Rückschlag, wenn das, was gesetzt wird, wo wir viel Geld in die Hand nehmen, wenn das am Ende nicht die Chance hat, wieder zu einem Wald hochzuwachsen."
Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin
Viel Aufregung im Bayerischen Jagdverband
Die geplante Mindestabschussquote wird im Bayerischen Jagdwesen wenig ändern. In Bayern gibt es bereits so genannte Abschusspläne: Jagdpächter, Grundbesitzer und Behörden einigen sich auf einen Abschusskorridor. In diesem Rahmen muss der Jäger Wild in seinem Revier erlegen. Es ist daher eine andere Formulierung in der Novelle des Bundesjagdgesetzes, die den Bayerischen Jagdverband umtreibt: Bisher war im Gesetz von "Naturverjüngung" die Rede. Das heißt, der Wald erneuert sich selbst. Es wächst, was eben wachsen will. Und der Jäger muss dafür sorgen, dass diese Selbstheilungskräfte des Waldes nicht durch zu viel Wild gestört werden. In der Neufassung des Gesetzes ist dagegen nur noch von "Verjüngung" statt einer "Naturverjüngung" die Rede. Ein kleiner Unterschied, der für viel Aufregung sorgt. Thomas Schreder vom Bayerischen Jagdverband befürchtet, dass der Waldumbau letztendlich mit dem Gewehr sichergestellt werden soll.
"Auch Baumarten, die es bisher noch überhaupt nicht in dem Wald gegeben hat, müssen dann künftig ohne Schutz hochkommen. Und das ist aus unserer Sicht unmöglich. Wenn ich eine neue Baumart – eine Eiche in eine Fichten-Monokultur zum Beispiel – setze, dann wird auch das letzte Reh, das dort seine Fährten zieht, am Schluss an der Eiche vorbeikommen und an der Eiche knabbern. Für uns ist das gleichgesetzt mit dem Ziel, den Wald völlig wildfrei zu machen. Das dürfen wir als Vertreter der Jagd und des Wildes nicht akzeptieren."
Thomas Schreder, Pressesprecher des Bayerischen Jagdverbandes
Hitze, Trockenheit und der Borkenkäfer machen Fichtenwald kaputt
Es hat geschneit, der Schnee knirscht unter unseren Füßen. Ich bin nach Oberfranken gefahren und habe mich mit Angelika Morgenroth verabredet. Wir laufen in ihren Wald, das "Erplichtholz" in der Nähe von Zapfendorf im Landkreis Bamberg. Nach ein paar hundert Metern bleiben wir an einer Lichtung stehen. Bis vor kurzem war hier noch ein Fichtenwald. Er sei durch Hitze, Trockenheit und den Borkenkäfer kaputtgegangen, erzählt Angelika Morgenroth. Jetzt hat sie neue Baumarten in die Lichtung gepflanzt.
"Vor allen Dingen Bäume, die ich in der Zukunft hier gut sehe: Das ist die Mehlbeere, die Elsbeere und der Speierling. Und um weiterhin Nadelhölzer zu haben auch die Douglasie."
Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin
Um die jungen Bäumchen hat Angelika Morgenroth runde Gitter angebracht. Damit sie nicht von Rehen verbissen werden. Außerdem sollen in dem ehemaligen Fichtenwald jetzt Eichen wachsen. Der ganze Waldboden ist von jungen Eichentrieben übersät. Einzelne Gitter anzubringen, ist hier unmöglich. Die Eichentriebe stehen ungeschützt, und viele sind bereits verbissen. Rehe sind Feinschmecker, sie lieben die Abwechslung: Taucht eine neue Baumart im Wald auf, stürzen sie sich darauf. Ich will von Angelika Morgenroth wissen: Warum bringt sie rund um die Lichtung nicht einfach einen Zaun an, um alle jungen Bäume darin zu schützen.
"Weil Zaun auch Geld kostet. Weil Zaun auch bedeutet, dass er durchlässig wird, indem das Wild rein rennt. Also ich muss ständig kontrollieren, ob der Zaun noch dicht ist. Wenn er nicht mehr dicht ist, macht es ja keinen Sinn mehr. Es ist kostspielig. Und vor allem erhöht es auch den Verbissdruck auf die restlichen Flächen. Dort, wo die Rehe nicht reinkönnen. Dann suchen sie sich andere Plätze. Dann versammeln sie sich an bestimmten Stellen, und dann ist der Verbissdruck noch höher."
Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin
Angelika Morgenroth führt mich zu einer anderen Stelle etwas tiefer im Wald. Dort stehen kleine junge Kiefern und Fichten. Kaum mannshoch – aber viele sind schon wieder braun oder sogar kahl. Hier sollte eine so genannte Naturverjüngung stattfinden: Es wächst, was der Waldboden eben hergibt. Das funktioniere nicht, sagt Waldbesitzerin Morgenroth.
"Warum schauen sie nicht vital aus? Weil die Trockenheit den Bäumchen zusetzt. Drin sieht man immer wieder kaputte Fichten. Diese Trockenheit verträgt die Kiefer hier nicht. Und warum soll ich auf diese Naturverjüngung setzen, die schön ist, ja. Aber sie hat keine Zukunft, diese Verjüngung im Nadelholz. Die paar Eichen und Birken, die werden es vielleicht schaffen, ist eine gute Beschattung für die Laubhölzer. Aber die Naturverjüngung im Nadelholz wird hier keine Zukunft haben. Und das ist eigentlich das Drama."
Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin
Kiefer und Fichte leiden am meisten unter Klimawandel
"Die Geschwindigkeit des Klimawandels kann man wahrscheinlich - außer in Gletscherregionen und am Nordpol - kaum irgendwo so gut ablesen wie hier im Wald. Weil wir Baumarten, von denen wir vor Jahren noch glaubten, dass sie die Klimaerwärmung gut mitmachen, verlieren. Zum Beispiel die Kiefer, von der vor 20,30 Jahren noch die Ansicht bestand, dass sie die Klimaerwärmung mitmacht, hier jetzt in Franken auch großflächig ausfällt."
Götz von Rotenhan, stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Waldbesitzerverbandes
Kiefer und Fichte leiden am meisten unter dem Klimawandel. Gleichzeitig sind sie in den bayerischen Wäldern am häufigsten vertreten: Laut Bayerischem Forstministerium machen Fichte und Kiefer knapp 60 Prozent der Waldbäume aus. Ob sie die nächsten Jahrzehnte in Bayern – vor allem im besonders trockenen Nordbayern – überleben können, ist unklar. Viel wird sich in den Wäldern verändern müssen. Und diese Veränderung findet – so wie es aussieht – nicht von alleine statt. Der Mensch muss eingreifen: Pflanzen, sähen, neue Baumarten heimisch machen. Ein natürliches Gleichgewicht ist aus der Balance geraten. Was bedeutet das für die Tiere des Waldes? Haben sie noch einen Platz – oder stören sie nur?
Verhärtete Fronten zwischen Jägern und Grundbesitzern
Das neue Bundesjagdgesetz will auch das Verhältnis zwischen Grundbesitzern und Jägern neu regeln. Die Abschusspläne sollen künftig nur zwischen den Jagdvorstehern und den Jägern ausgehandelt werden. Behörden, wie zum Beispiel das Landratsamt, sollen sich raushalten und nur im Streitfall eingreifen. Im bayerischen Waldbesitzerverband ist man skeptisch, ob das gelingen kann. Es bräuchte mehr Schulungen für Wald- und Feldbesitzer. Die Grundeigentümer, also die Jagdgenossenschaften, müssten sich ihrer großen Verantwortung mehr bewusst sein, sagt der stellvertretende Vorsitzende Götz von Rotenhan. Niemand wolle einen Wald ohne Wild, so Rotenhan. Aber der Bestand müsse angepasst werden.
Das Ziel: der Erhalt der Natur in all ihrer Vielfalt und Schönheit
Thomas Schreder, Pressesprecher des Bayerischen Jagdverbandes, sieht ebenfalls die Notwendigkeit, das Rehwild nachhaltig zu bejagen. Doch es aus den Wäldern zu verbannen, bloß um künstlich eingebrachte Baumarten erfolgreich anzusiedeln – das geht ihm zu weit. Die Fronten scheinen verhärtet. Zumindest auf Verbandsebene wird weiter verbal aufgerüstet zwischen Jägern und Grundbesitzern. Das Verhältnis ist und bleibt sensibel und störanfällig. Dabei wollen doch alle das Gleiche: Den Erhalt der Natur in all ihrer Vielfalt und Schönheit.