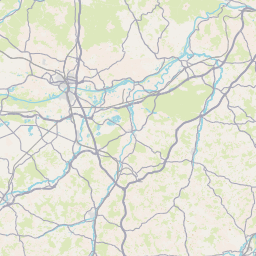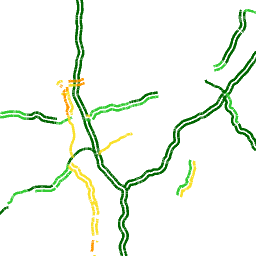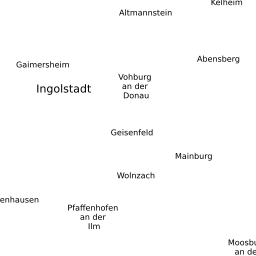Sterben in Würde Palliativmedizin und Hospizarbeit
Palliativmedizin ist die ganzheitliche umfassende Versorgung von Menschen, die mit lebensbedrohlichen Erkrankungen konfrontiert sind, und für die die Medizin keine Maßnahmen zur Heilung mehr treffen kann.
Von: Sabine März-Lerch
Stand: 27.11.2023 |Bildnachweis

Palliativmedizin ist die ganzheitliche umfassende Versorgung von Menschen, die mit lebensbedrohlichen Erkrankungen konfrontiert sind, und für die die Medizin keine Maßnahmen zur Heilung mehr treffen kann.
Expertin:
Unheilbare Krankheiten sind häufig mit großen körperlichen, seelischen, sozialen und spirituell-existentiellen Belastungen verbunden. Um diese zu lindern, arbeiten in der Palliativmedizin die verschiedensten Berufsgruppen zusammen: Ärzt*innen, Pflegende, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, Seelsorgende, Physiotherapeut*innen, Atemtherapeut*innen, u.a. Die Bedürfnisse der Patienten stehen dabei im Fokus, weniger die zugrundeliegende Erkrankung. Der Anspruch der Palliativmedizin ist, Lebensqualität bis zum Lebensende zu erhalten - auch angesichts einer begrenzten Lebenszeit von Monaten, Wochen oder Tagen. Und ein würdevolles Sterben mit möglichst wenig Schmerzen und anderen Beschwerden zu ermöglichen.
Der Text beruht auf einem Gespräch von Sabine März-Lerch mit Prof. Dr. Claudia Bausewein, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin, Klinikum der Universität München, Lehrstuhl für Palliativmedizin.
Einen Mantel (=Pallium) um den unheilbar kranken Patienten legen und ihn behüten, das ist die Bedeutung der Palliativmedizin. Im Zentrum stehen die Schmerztherapie und die Linderung anderer Symptome des Patienten wie Atemnot, Unruhe, Angst, Mundtrockenheit oder Depression – immer mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität. Und zur Lebensqualität gehören auch die Aspekte des psychosozialen und spirituellen Lebens. Insofern begleiten Psychologen die Patienten, Sozialarbeiter schalten sich ein, Seelsorgende kümmern sich um Patienten und Angehörige. Oft geht es einfach darum, Ansprache und Aussprache zu ermöglichen: In der Familie ist das Thema Tod und Sterben oft Tabu, aber selbst der eigene Hausarzt hat manchmal Probleme, über das nahende Ende zu sprechen. Was Palliativmedizin bedeutet – drei Vorurteile:
Vorurteil 1: "Palliativmedizin richtet sich nur an Krebspatienten."
"Es wird immer gedacht, für eine palliativmedizinische Versorgung muss man eine Tumorerkrankung haben - das stimmt überhaupt nicht mehr. Wir wissen aus dem klinischen Alltag und der Forschung, dass Menschen mit Erkrankungen der Lunge, des Herzens, der Niere, der Leber oder mit neurologischen Erkrankungen genauso palliativmedizinische Betreuung brauchen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Vorurteil 2: "Palliativmedizin ist nur für Menschen in der Sterbephase gedacht."
"Es ist ein Vorurteil, dass die Palliativmedizin erst dann vonnöten sei, wenn jemand sterbend, also in den letzten Lebenstagen, ist. Wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Patient*innen mit einer unheilbaren Krankheit schon Wochen, Monate oder gar Jahre vor dem eigentlichen Lebensende starke Beeinträchtigungen haben können – körperlicher, seelischer oder sozialer Natur. Und wir wissen, dass die Patient*innen einen großen Benefit davon haben können, wenn wir dann schon Palliativmedizin anbieten, ja sogar, dass im Einzelfall Menschen dadurch länger leben anstatt schneller zu sterben." Prof. Dr. Claudia Bausewein
Vorurteil 3: "Palliativmedizin ist gleichzusetzen mit Schmerztherapie."
"Das wäre zu kurz gegriffen: Wir sind nicht nur da, wenn jemand Schmerzen hat, sondern auch bei allen anderen Symptomen. Denn unheilbar kranke Menschen haben neben Schmerzen auch viele andere Belastungen, die es zu lindern gilt - wie Atemnot, Erbrechen, Übelkeit, Schlafstörungen, Ängste oder Depressionen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Solange solche Vorurteile über Palliativmedizin kursieren, werden viele Menschen zu spät oder gar nicht in die Betreuung kommen. Immer noch fehlt es an breitem Wissen über Palliativmedizin. Mit Konsequenzen für den einzelnen Betroffenen:
"Die Menschen denken, wenn ich auf die Palliativstation komme, dann ist das Lebensende da, dann werde ich sterben. Ihre Reaktion ist, dass sie eine mögliche Aufnahme auf die Palliativstation so lange wie möglich hinausschieben. Sie kommen sehr spät, und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass sie hier sterben. Viele Patient*innen kommen auf die Station und sagen nach zwei bis drei Tagen ‚Mein Gott, wäre ich doch eher gekommen‘."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Seit 2007 hat jeder Versicherte einen gesetzlichen Anspruch auf Palliativversorgung im häuslichen Bereich, und die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) wurde ausdrücklich Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Sogenannte SAPV-Teams betreuen Patienten zu Hause, arbeiten mit Hausärzten und Hospizvereinen zusammen. Das seit 8. Dezember 2015 geltende Hospiz- und Palliativgesetz will sterbenden Menschen die Gewissheit geben, in ihrer letzten Lebensphase nicht allein, sondern in jeder Hinsicht gut versorgt und begleitet zu sein. Daher wurden eine Vielzahl von Maßnahmen in diesem Gesetz ergriffen, wie zum Beispiel, dass ehrenamtliche Hospizbegleiter seither auch im Krankenhaus eingesetzt werden können oder die Verbesserung der Finanzierung von stationären Hospizen oder ambulanten Hospizdiensten oder die Verbesserung der ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung in Pflegeheimen.
"Wir haben bisher Bedarfszahlen, dass geschätzt auf 250.000 Einwohner ein solches multiprofessionelles SAPV-Team zur Verfügung stehen sollte. Wir haben in München und Umgebung fünf solcher Teams. Diese Teams sind auch entsprechend finanziert und das war tatsächlich ein ganz großer Erfolg. Da sind wir sehr gut aufgestellt."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
"Ich überblicke die Entwicklung über mehr als 30 Jahre. Wenn man sich überlegt, dass wir von nicht bestehenden Strukturen in den 80er-Jahren über eine Pionierphase heute in eine Konsolidierung kommen: Wir sind Teil des Gesundheitswesens geworden, Teil der Gesetzgebung, es gibt eine Finanzierung, das finde ich für 30 Jahre eine unwahrscheinliche Entwicklung innerhalb eines Gesundheitswesens und innerhalb der Medizin."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
"Wir haben eine Bevölkerungsentwicklung, in der immer mehr ältere Menschen leben, die immer mehr Erkrankungen haben werden – wir nennen das in der Medizin Multimorbidität -, das macht die Betreuung komplexer und schwieriger. Diese Menschen werden an Zahl zunehmen. Wir haben das große Thema Menschen mit Demenz und die Themen Pflegemangel und Ärztemangel, also wir haben viele Herausforderungen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
"Wenn man verschiedene Definitionen von Palliativmedizin anschaut, steht in keiner, dass die Patient*innen eine vordefinierte Krankheit haben müssen. Sondern es muss eine fortgeschrittene und weiter fortschreitende Erkrankung vorliegen, die das Leben vorzeitig beendet. Es geht nicht um spezielle Diagnosen - neben Krebserkrankungen gibt es viele Erkrankungen des Herzens, der Lunge, der Nieren oder neurologische Erkrankungen, die ebenso das Leben vorzeitig beenden und den Menschen große Beschwerden machen und zu vielfältigen Belastungen führen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Angehörige von Menschen mit einer unheilbaren Krankheit sind in vielfacher Hinsicht belastet, manchmal sogar mehr als die Patienten selbst: Sie verlieren einen geliebten Menschen; sie sind oft Hauptbetreuer und mit der Pflege des Patienten betraut; ihre Trauer beginnt schon, solange der geliebte Mensch noch lebt.
"Bei uns gehören die Angehörigen in der Begleitung immer dazu. Wir haben nicht nur zehn Patienten auf Station, sondern zehn Angehörige und Familien."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Angehörige müssen oft in der Rolle des Vorsorgebevollmächtigten für den Angehörigen Entscheidungen treffen – mit der Sorge, über Leben und Tod entscheiden zu müssen.
"Wir müssen sie immer wieder darauf aufmerksam machen und entlasten – dahin, dass sie nur das Sprachrohr des kranken Angehörigen sind, um dessen Meinung zu vertreten und nicht über den*die Patient*in entscheiden sollen. Hier ist es hilfreich, wenn eine Patientenverfügung vorliegt."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Krankenhausleistungen werden zu einem großen Teil über das sogenannte Fallpauschalen-System abgerechnet – das bedeutet: eine bestimmte Summe pro Fall. Die Finanzierung orientiert sich in diesem Modell an Diagnosen. Auch ein Großteil der Leistungen auf Palliativstationen wird innerhalb des Fallpauschalsystems vergütet. Die Schwierigkeit jedoch ist, dass Palliativmedizin sich an Symptomen orientiert und nicht an Diagnosen. Wenn also jemand Schmerzen hat, dann ist es nicht ausschlaggebend, ob ein Brust- oder Lungentumor vorliegt. Wenn jemand Atemnot hat, kann dies Symptom einer chronischen Lungen- oder auch einer Krebserkrankung sein. Die Herausforderung für palliativmedizinische Stationen ist nun, die Finanzierung in den Kategorien des Fallpauschalsystems unterzubringen. Zum zweiten werden die Kosten in Krankenhäusern über sog. Verweildauern geregelt.
"Unheilbar kranke Menschen, die im Verlauf ihrer Krankheit immer mehr Probleme haben - oder bei denen ein Problem das andere ablöst -, da ist man schnell bei längeren Verweildauern. Die Folge ist, dass diese Menschen im Rahmen der Grenzverweildauer gar nicht mehr im Krankenhaus sein dürften. Und wenn ein Mensch sterbend ist, dann können Sie das nicht in eine Verweildauer pressen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
"In anderen Ländern ist weder die Diagnose noch die Prognose ausschlaggebend für palliativmedizinische Betreuung. Es sind die Bedürfnisse und es ist die Situation der Patienten. Wenn jemand starke unkontrollierte Schmerzen hat und vielleicht noch zwei Jahre leben kann, dann wird er Symptomkontrolle brauchen. Und wenn jemand Atemnot aufgrund seiner chronischen Lungenerkrankung hat (und das vielleicht sogar vier bis fünf Jahre vor dem Lebensende), kann Palliativmedizin helfen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Es ist die Aufgabe aller im Gesundheitswesen Beschäftigten, schwerkranke und sterbende Menschen zu Hause, im Seniorenheim, im Krankenhaus zu begleiten und zu betreuen, also eine allgemeine palliativmedizinische Versorgung zu gewährleisten.
Ist die Situation des Einzelnen sehr belastet, sind die Schmerzen nicht zu kontrollieren und sind die Beschwerden deutlich stärker als normalerweise, greift die spezialisierte Palliativversorgung, z.B. die SAPV im ambulanten Bereich oder Palliativstationen und Palliativdienste im Krankenhaus.
"Wir können mit unseren multiprofessionellen Teams auch auf die anderen Stationen eines Krankenhauses gehen, wenn Patient*innen mehr Unterstützung brauchen. Diese Palliativdienste begleiten dadurch deutlich mehr Menschen als Palliativstationen. Wir haben zum Beispiel auf der Palliativstation in Großhadern zehn Betten, in denen wir durchschnittlich 300 Patient*innen im Jahr betreuen. Mit dem Palliativdienst, der Patienten auf den normalen Stationen unterstützt, erreichen wir ca. 800 - 1.000 Patienten im Klinikum."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Seit 1996 hat sich die Zahl der ambulanten Hospiz- und Palliativdienste mehr als verdreifacht auf rund 1.500 im Jahr 2023. 1996 gab es 28 Palliativstationen sowie 30 stationäre Hospize – heute sind es über 340 Palliativstationen und mehr als 260 stationäre Hospize. Es gibt über ca. 400 SAPV-Teams in Deutschland. Mehr als 120.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich in Hospiz- und Palliativdiensten und -einrichtungen. (Quelle: Deutscher Hospiz- und Palliativ-Verband)
Seit 2013 müssen Medizinstudierende, die ihr 2. Staatsexamen ablegen, einen verbindlichen Leistungsnachweis im Fach Palliativmedizin erbringen. Alle Ärztinnen und Ärzte haben die Möglichkeit, eine Zusatzweiterbildung im Fach Palliativmedizin zu machen. Ihre Zahl ist von 100 im Jahr 2005 auf fast 14.000 im Jahr 2023 gestiegen. (Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung)
"Es gibt zunehmend auch Modellprojekte im hausärztlichen Bereich. Und so haben wir nun ein System, das viel mehr in die Breite geht."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Eine Patientenverfügung ist eine schriftlich abgefasste Willenserklärung, in der im Voraus festgelegt wird, wie man therapiert werden will, wenn man sich selbst nicht mehr dazu äußern kann. Die Vorstellung, hilflos im Krankenhaus zu liegen, von unbekannten Ärzten und der Apparatemedizin abhängig zu sein, macht den meisten Menschen Angst. Krankheit oder Unfall können diesen Albtraum schnell Realität werden lassen. Damit dann nicht andere darüber entscheiden, wie der Patient behandelt werden soll, muss man - rechtzeitig und umfassend - vorsorgen.
Drei Verfügungen, drei Wege der Bevollmächtigung
Eine umfassende Vorsorge für den Ernstfall deckt drei Verfügungsbereiche ab:
• Patientenverfügung
Die auch als Vorausverfügung bekannte Patientenverfügung gibt dem Arzt Hinweise, unter welchen Umständen eine Behandlung wie gestaltet oder begrenzt werden soll. Dabei sind Therapieablehnungen für den Arzt verbindlich, Therapiewünsche nicht.
Tipp: konkret werden
Das Verfassen einer solchen rechtsgültigen Vorsorge ist nicht ganz einfach, denn je allgemeiner die Verfügung gehalten ist, desto schwieriger kann es für den Arzt sein, sich daran zu halten. Je klarer und genauer eine Patientenverfügung z.B. auf die Situation einer schweren Erkrankung ausgerichtet ist, desto eher werden sich die Ärzte daran halten. Einige Patientenverfügungen enthalten einen eigenen Abschnitt "Für den Fall schwerer Krankheit", in der auch auf Notfallsituationen eingegangen werden kann, z.B. was Ärzte bei einer akuten Blutung eines Tumors tun sollen, oder welche Wünsche bestehen zum Umgang mit Ernährung in der Sterbephase.
Gespräch mit Vertrauenspersonen
Eine Patientenverfügung sollte möglichst nicht alleine verfasst werden. Gespräche mit Freunden und Familienmitgliedern, und dem Hausarzt über die Patientenverfügung geben Anregungen oder verändern den Blickwinkel auf die angestrebte Behandlung im Ernstfall. Wenn der Verfasser der Patientenverfügung bereits schwer erkrankt ist, wird auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Arzt notwendig sein. So kann sich der Betroffene mit dem möglichen Verlauf der Krankheit auseinandersetzen und in der Patientenverfügung festlegen, welche konkreten Therapieschritte erwünscht sind und welche abgelehnt werden.
• Vorsorgevollmacht
In der Vorsorgevollmacht benennt der Verfasser eine oder mehrere Vertrauenspersonen. Diese vermitteln im Ernstfall als Stellvertreter den Willen des Patienten gegenüber den behandelnden Ärzten. Diese Vertrauenspersonen sind also für gesundheitliche Fragen zuständig, aber auch dafür, wo ein Mensch begleitet und gepflegt werden soll. Für die verschiedenen Lebensbereiche können unterschiedliche Menschen bevollmächtigt werden. Nach deutschem Recht sind nicht automatisch der Ehe- oder Lebenspartner oder die Kinder als gesetzliche Vertreter vorgesehen. Seit 2023 gilt allerdings das sogenannte Ehegattennotvertretungsrecht, das besagt, dass der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin grundsätzlich Entscheidungen für eine verheiratete Person treffen kann, wenn sie wegen einer akuten medizinischen Situation, z.B. Bewusstlosigkeit oder Koma, selbst nicht mehr in der Lage ist, in Gesundheitsangelegenheiten zu entscheiden. Die möglichen Entscheidungen sind ausschließlich auf Entscheidungen im medizinischen Bereich beschränkt. Dieses Recht ist auf sechs Monate begrenzt. (Quelle: Bundesministerium der Justiz)
• Betreuungsverfügung
Mit einer Betreuungsverfügung kann der Verfasser für das Betreuungsgericht verbindlich festlegen, welche Menschen seines Vertrauens als Betreuer eingesetzt werden sollen für den Fall, dass er selbst nicht mehr für sich entscheiden kann, also eine gesetzliche Betreuung notwendig wird. Dieses Instrument hat seit Einführung der Vorsorgevollmacht an Bedeutung verloren, da letztere die aufwendigen gerichtlichen Betreuungsverfahren vermeidet.
Tipp: in der richtigen Form
Es gibt inzwischen eine fast unüberschaubare Zahl von Formularen mit Patientenverfügungen. Von den Palliativmedizinern des LMU Klinikums wird die Broschüre des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums empfohlen, da hier neben der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auch eine spezielle Verfügung für den Fall schwerer Krankheit und die Erstellung eine Werteanamnese mit beinhaltet sind.
Nach einer Gesetzesnovelle, die seit 1. September 2009 in Kraft ist, sind Patientenverfügungen für Ärzte verbindlich. Der Wille des Patienten ist gestärkt worden. Allerdings müssen Patientenverfügungen schriftlich abgefasst und klar formuliert sein. Patientenverfügungen gelten auch unabhängig von Art, Schwere und Stadium einer Erkrankung, also nicht nur bei unmittelbarer Todesnähe - der vorher festgelegte Wille hat also Vorrang vor den Entscheidungen von Angehörigen und Ärzten. Vor der Gesetzesnovelle verfasste schriftliche Patientenverfügungen behalten ihre Wirksamkeit.
Tipp:
Um zu überprüfen, ob die Patientenverfügung noch mit der eigenen Meinung übereinstimmt, sollte sie unbedingt bei Veränderungen der Lebenssituation angepasst werden. Manche Experten empfehlen eine Überprüfung und erneute Unterschrift alle zwei Jahre. Dies ist allerdings keine notwendige Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Patientenverfügung.
"Es wäre schön gewesen, wenn der Gesetzgeber verankert hätte, dass mit der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ein ärztliches Gespräch verbunden sein müsse. Denn so habe ich als Ärztin oft die Frage, ob das juristisch tragfähig ist, wenn die Papiere eventuell am Sonntagmorgen am Küchentisch nebenbei ausgefüllt werden. Im Sinne der Angehörigen sollten in einen Gesprächsprozess auch Angehörige und Bevollmächtigte einbezogen werden – zu ihrer Entlastung."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Als universitäre Einrichtung hat das Klinikum Großhadern einen wissenschaftlichen Auftrag – auch in der Palliativmedizin werden derzeit aktuelle Projekte wissenschaftlich begleitet.
Die Atemnotambulanz
Die Atemnotambulanz ist eine ergänzende palliativmedizinische Maßnahme bei fortgeschrittener Erkrankung. Atemnot ist neben Schmerzen ein sehr belastendes Symptom einer fortgeschrittenen unheilbaren Krankheit. Gerade Menschen mit einer chronischen Lungenerkrankung leiden häufig an Atemnot, aber auch Menschen mit verschiedenen Krebserkrankungen. Die Betroffenen verspüren am Anfang oft nur bei stärkerer Belastung Atemnot, später aber auch schon bei leichterer Belastung und können dann manchmal nur noch wenige Meter gehen, bevor sie atemnötig werden. Im Extremfall kann Atemnot auch beim Sprechen oder im Sitzen auftreten. In der Atemnotambulanz in Großhadern arbeiten Palliativmediziner und Physiotherapeuten mit den Patienten, um ihnen Maßnahmen des Selbstmanagements im Umgang mit der Atemnot zu vermitteln. Die Arbeit in der Atemnotambulanz wird wissenschaftlich begleitet.
"Es gibt wenige Medikamente, die helfen, aber viel, was die Betroffenen selbst machen können. Weil Atemnot auch Verhaltensweisen hervorruft, die die Atemnot wieder schlimmer machen. Wir treffen auf diese Weise auch Patient*innen, die wir sonst nie in der Palliativmedizin gesehen hätten."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Palli-MONITOR – immer im Bilde über die Bedürfnisse der ambulanten Patienten
Mit Fragebögen, die mittels Smartphone, Tablet oder Computer direkt von den ambulant betreuten Palliativpatienten an die betreuenden Ärzte und Pflegenden des SAPV-Teams übermittelt werden, sollen die Bedürfnisse dieser Patienten engmaschiger und aktueller berücksichtigt werden und die Betreuung gezielter angefordert werden können.
"Patient*innen müssen hier keine Sorge haben, dass palliative Zuwendung damit sozusagen digitalisiert würde – im Gegenteil: die Zeit des Pflegeteams kann gezielter auf die Bedürfnisse der Patientinnen abgestimmt werden. Palli-MONITOR wird nie ein Gespräch ersetzen, aber helfen, die ambulante Betreuung zu strukturieren."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Man möchte meinen, dass Palliativmediziner durch ihre fast tägliche Begegnung mit sterbenden Menschen wissen, wie Sterben "funktioniert". Das ist jedoch ein Trugschluss. Und tatsächlich liegt das Sterben auch nicht im Fokus der Palliativmedizin:
"Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, aber ich glaube nicht, dass wir das besser wissen. Was ich für mich gelernt habe: Gerade im Angesicht des begrenzten Lebens geht es ums Leben. Es geht ums Leben bis zum Ende und nicht immer nur darum auf den Moment des Sterbens zu schauen."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
Medizinstudium und Gesundheitswesen definieren ärztliches Handeln als Behandeln eines kranken Menschen mit dem Ziel der Heilung und möglichst langem Überleben. Mancher behandelnde Arzt erlebt es als persönlichen Misserfolg, wenn ein Mensch trotz bestmöglicher Behandlung stirbt.
"Wir Palliativmediziner*innen müssen hier grundsätzlich umdenken: Für uns ist die Verbesserung der Lebensqualität eines Kranken der Erfolg. Wenn jemand zum Beispiel bei der Visite sagt: ‚Ich habe das erste Mal wieder gut geschlafen, weil ich keine Schmerzen hab!‘. Wenn man Palliativmedizin unter diesem Aspekt sieht, dann ist das eine Arbeit mit viel Erfolg. Und alle, die in dieser Arbeit stehen, sagen ‚Das ist eine wertvolle, bereichernde Arbeit‘."
Prof. Dr. Claudia Bausewein
"Der Wunsch, das Leben vorzeitig zu beenden oder nach Sterbehilfe wird immer wieder an uns herangetragen. Das Wichtigste ist, das ernstzunehmen und herauszufinden, was die Not dieses Menschen ist, dass er darum bittet. Sind es Schmerzen oder andere belastende Beschwerden, ist es eine Depression, ist es die Angst vor einem einsamen Tod? Im Vordergrund muss die Linderung der Not stehen, die den Menschen dazu bringt, schneller sterben zu wollen. Wenn die Patient*innen eine Betreuung durch das palliativmedizinische Team erleben und erfahren, dass sie in ihrer Situation und Not absolut ernstgenommen werden, dass es viele Möglichkeiten der Medizin gibt, körperliche Beschwerden, aber auch seelische oder existentielle Belastungen zu lindern, verschwindet der Wunsch nach Sterbehilfe bei fast allen Patienten. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, lebensverlängernde Maßnahmen einzustellen oder nicht zu beginnen, wie zum Beispiel eine künstliche Ernährung oder ein Antibiotikum bei einem Infekt am Lebensende. Wir werden dann also alles tun, um das Sterben nicht aufzuhalten. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben Menschen aber die Möglichkeit, bei einem Suizidanliegen die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Eine Tötung auf Verlangen ist aber in Deutschland definitiv nicht erlaubt."
Prof. Dr. Claudia Bausewein