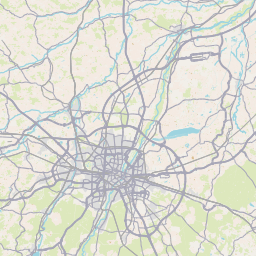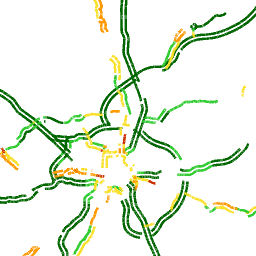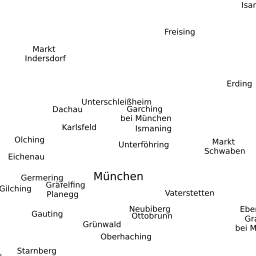Bayern 2 Nah dran Moderation: Ulrike Ostner

Dienstag, 01.04.2025
09:05
bis 12:00 Uhr
-
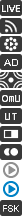 Als Podcast verfügbar
Als Podcast verfügbar
BAYERN 2
9.10 Ein Jahr Genderverbot an Bayerns Schulen
Gespräch mit Simone Fleischmann. BLLV-Präsidentin
9.20 Bayern 2 Radiowissen
Das Schwein - Verkanntes Borstentier
9.50 Bayern 2 Kalenderblatt
01.04.1909: Befreiung von Kochherd und Waschbrett
10.00 / 11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr
10.10 Was wir aus Krisen und Untergängen lernen können
Gespräch mit der Philosophin Katharina Ceming
11.10 Nahaufnahme:
Nebelfänger und Wassersammler - "Wasserernte" in trockenen Gebieten
11.30 20 Jahre Tagfalter-Monitoring - der Bestand der Schmetterlingsarten in Deutschland
11.56 Werbung
Moderation: Ulrike Ostner
Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.
Unter dieser Adresse finden Sie die Manuskripte von Bayern 2 Radiowissen:
http://br.de/s/5AgZ83
Das Schwein - Verkanntes Borstentier
Schweine sind wandlungsfähige Tiere. Es gibt sie wild in der freien Natur und als Nutztiere in zahllosen Varianten weltweit. Sie überleben in engen Ställen, in Wäldern, auf Feldern und sogar in der Stadt. Ihnen schmeckt ungefähr das gleiche wie uns Menschen, weswegen sie in großen Mais- und Getreidefeldern Schäden anrichten können. Und sie schmecken uns. Wenn wir sie mästen, so geschieht das ihres Fleisches wegen, das wir zu Koteletts, Schweinswürsten oder chinesisch süßsauer verarbeiten. Am Stichtag 13. April 2023 lebten weltweit 778.640.000 Schweine in Nutztierhaltung, davon weit über die Hälfte in China. Nichts normaler als das Schwein, so scheint es. Andererseits findet die Verhaltensforschung Erstaunliches über das emotionale Leben der Schweine und ihre mentalen Fähigkeiten heraus. Immer mehr Menschen stellen die konventionelle Haltung in Frage und verzichten auf den Konsum von Schweinefleisch. Ändert sich unsere Beziehung zu dem beliebten Borstentier?
Nebelfänger und Wassersammler - "Wasserernte" in trockenen Gebieten
Mehr als zwei Milliarden Menschen leben in Gebieten, in denen das Trinkwasser knapp ist. Gleichzeitig speichert die Atmosphäre Unmengen Wasser - selbst in den trockensten Gegenden ist das so. Diese Quelle nutzen Menschen schon lange: Bereits die Inkas stellten Eimer unter die Bäume, um die an den Blättern kondensierende Luftfeuchtigkeit aufzufangen. Heutzutage versuchen Forschende dieses Prinzip nachzuahmen mit Netzen aus Kunststoff, an denen Nebeltröpfchen und Tau hängen bleiben. Andere experimentieren mit Materialien, die sich stärker abkühlen als ihre Umgebung und so als Kondensationsflächen dienen; die ETH Zürich betreibt auf dem Dach ihres Gebäudes einen solchen "Wassersammler". Experimentiert wird auch mit speziellen Salzen, sogenannten Superabsorbern, wie sie zum Beispiel in Babywindeln verwendet werden: Sie ziehen die Feuchtigkeit geradezu aus der Umgebung heraus. Noch sind viele dieser Projekte nicht ausgereift. Und manche auch kostspieliger als Trinkwasser selbst - wenn es welches gibt. Doch das könnte sich ändern: Die Methoden werden rentabler. Denn der Klimawandel führt dazu, dass noch mehr Wasser verdunstet und sich in der Atmosphäre sammelt.