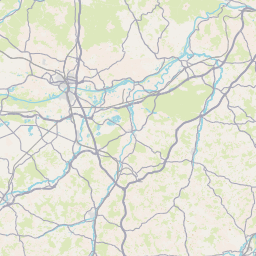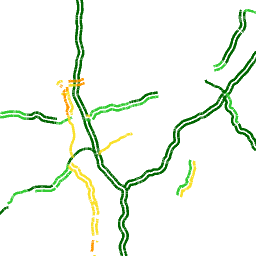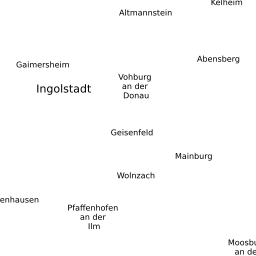29. Mai 1942 Bing Crosby nimmt "White Christmas" auf
Manchmal fallen einem Dinge zur Unzeit ein. Gut, wenn irgendwann dann doch die Zeit reif dafür ist. So ging es dem Titel "White Christmas". Eingespielt im Frühling, veröffentlicht im Sommer, wollte die Single erst niemand haben. Richtung Weihnachten aber ging sie weg wir warme Semmeln. Autorin: Julia Devlin
29. Mai
Mittwoch, 29. Mai 2024
Autor(in): Julia Devlin
Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl
Redaktion: Susi Weichselbaumer
Im Jahr 1942 tobte der Zweite Weltkrieg, aber trotzdem wurde es auch damals Frühling. An einem schönen Freitag, dem 29. Mai, eben 1942, ging der amerikanische Sänger Bing Crosby ins Studio, um ein Lied aufzunehmen, das Geschichte schreiben sollte. Kein Frühlingslied, ganz im Gegenteil: Das Lied handelte von verschneiten Baumwipfeln und Weihnachtskarten, von Pferdeschlitten und bimmelnden Glöckchen. Die Verkaufszahlen der Single, die im August auf den Markt kam, dümpelten erst einmal vor sich hin, im Hochsommer nicht weiter verwunderlich. Doch im Spätherbst eroberte das Lied erstmals die Spitze der Hitparaden und hielt sich dort lange, lange. "White Christmas" wurde eines der erfolgreichsten Lieder überhaupt.
Weihnachten daheim
Komponiert hatte es Irving Berlin. Geboren wurde er 1888 als Israel Beilin. Wo genau, wusste er selbst nicht, ob in Sibirien oder Weißrussland, jedenfalls im russischen Zarenreich. Sein Vater, ein jüdischer Kantor, wollte mit seiner Familie dem Hunger und den Pogromen entfliehen und ging nach Amerika. Hier wuchs der Junge auf, in der Lower East Side in New York, dem Tor für Immigranten aus Europa.
Wenn schon, dann üppig
Als Erwachsener änderte Israel Beilin seinen Namen in Irving Berlin. Mit seiner Frau Ellin zusammen richtete er stets ein prächtiges Weihnachtsfest für seine drei Töchter aus, mit einem festlichen Abendessen im Kerzenschein, unzähligen Geschenken und einem riesigen geschmückten Weihnachtsbaum.
Und jedes Jahr erzählte ihnen der Vater dieselbe Geschichte: Wie er als kleiner Junge aus der Wohnung schlich, zu den irisch-katholischen Nachbarn, und dort verzückt den prächtigen Weihnachtsbaum anstarrte - eine Tradition, die es bei seinen frommen, jüdisch-orthodoxen Eltern natürlich nicht gab. Bei Irving Berlin später schon. Für ihn wurde das Weihnachtsfest zu einer Bestätigung, es geschafft zu haben, angekommen zu sein in der neuen Gesellschaft.
Doch Weihnachten hatte noch eine weitere Bedeutung für den Komponisten und seine Frau: Am Weihnachtstag 1928 war ihr neugeborener Sohn plötzlich gestorben. So jährte sich immer an Weihnachten der Todestag von Irving Berlin junior.
"White Christmas" vereint all das, ist durchdrungen von Nostalgie. Es beschwört eine Fata Morgana herauf, ein fernes Trugbild von unerreichbaren Dingen. Der Kindheit, der Vergangenheit, dem Schnee, der schmilzt und vergeht. Sicher klingt etwas von Berlins Weihnachts-Melancholie in diesem Lied mit, ein Klagelied für seinen Sohn. Doch diese Melancholie traf den Nerv so vieler Menschen, egal welcher Herkunft. Irving Berlin hatte den größten gemeinsamen emotionalen Nenner gefunden. Und den Trost geschaffen, den eine vom Krieg verängstigte und verunsicherte Gesellschaft bitter nötig hatte.
Es ist also schon ein erstaunliches Lied, dieses "White Christmas": Eine säkulare amerikanische Weihnachtshymne, komponiert von einem im russischen Zarenreich geborenen Sohn eines jüdischen Kantors, aufgenommen an einem Maientag des Kriegsjahres 1942.