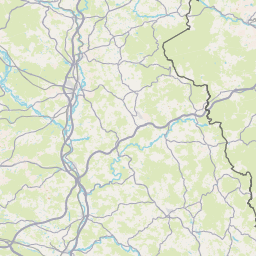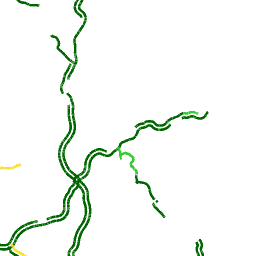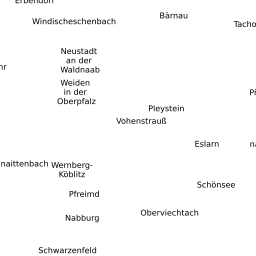10. April 1815 Vulkan Tambora verfinstert die Welt
Der Tambora: ein aktiver Schichtvulkan. Sein Ausbruch im Jahr 1815 bewirkte globale Klimaveränderungen, weshalb man das folgende Jahr in Europa und als das „Jahr ohne Sommer“ bezeichnete. Ernteausfälle und eine erhöhte Sterblichkeit von Nutztieren führten zur schlimmsten Hungersnot des 19. Jahrhunderts. Autor: Markus Mähner
10. April
Donnerstag, 10. April 2025
Autor(in): Markus Mähner
Sprecher(in): Christian Baumann
Redaktion: Frank Halbach
Oh ja, es war wahrlich ein fürchterlicher Sommer! 10. Juni: Ungeheure Gewitter mit großen Verwüstungen in Schwaben. Dasselbe in München. Hagel isarabwärts. Am 14-ten Hagel in Würzburg, dem 16-ten in Landshut. In Österreich Überschwemmungen. Anfang Juli sogar Neuschnee im Berner Oberland und weiterhin Zerstörungen durch starken Hagel und Dauerregen in Süddeutschland und Österreich.
Das Jahr ohne Sommer
Die Rede ist vom Jahr 1816 - gerne als "Jahr ohne Sommer" bezeichnet. In vielen Gegenden Nordeuropas kam es zu enormen Ernteausfällen und infolgedessen zur größten Hungersnot des 19. Jahrhunderts. Hatten die napoleonischen Kriege ohnehin schon große Landteile verwüstet und die Reserven aufgebraucht, so wurde es nun noch schlimmer: Menschen streckten Brotmehl mit Baumrinden, Gräsern oder Bucheckern. Sie aßen alles, dessen sie habhaft werden konnten: Dachse, Hasen, Vögel, Maulwürfe oder Ratten. Hunde, Katzen und Pferde wurden sogar von offiziellen Stellen zum Verzehr freigegeben. Nur beim Gehirn der Katze solle man vorsichtig sein...
In vielen Kommunen entwickelten sich lokale Wohltätigkeitsvereine um der Flut der Armen beizukommen. Menschen stahlen, schmuggelten und wilderten, wo immer sie konnten. Die Zahl der verhafteten Diebe stieg in Bayern um das Fünffache an und wäre wohl noch mehr gewesen, wenn die Gendarmerie nicht verstärkt an den Grenzen eingesetzt gewesen wäre, um der illegalen Ausfuhr von Nahrungsmitteln Einhalt zu gebieten. In Frankreich und England kam es zu Aufständen.
Klimawandel durch Vulkanausbruch
Ausgelöst wurde dieses unfreiwillige "sozialpolitische Experiment", das zeigte, wie Gesellschaften mit Klimawandel umgehen, durch ein Ereignis, das 12.000 Kilometer entfernt und bereits ein Jahr zuvor stattgefunden hatte: Im April 1815 brach auf der indonesischen Insel Sumbawa der Vulkan Tambora aus. Seinen aktiven Höhepunkt erreichte der 4300 Meter hohe Berg am 10. April 1815. Nachdem der Tambora 140 Millionen Tonnen vulkanisches Gestein in bis zu 20 Kilometer Entfernung und über 50 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Atmosphäre gespuckt hatte, war er eineinhalb Kilometer niedriger und große Teile der Nordhalbkugel verdunkelt. Die Explosion war etwa viermal so stark wie der Ausbruch des Krakatau 1883 und noch mehrere tausend Kilometer entfernt zu hören. Wer den Ausbruch überlebt hatte, wanderte aus, verkaufte sich und seine Kinder in die Sklaverei. Auf dem indischen Subkontinent brach eine Cholera-Epidemie aus, die sich 1917 zu einer weltweiten Pandemie entwickelte und verschärft zu der großen Hungernot hinzu kam.
Die Opferzahlen, die der Ausbruch des Tambora indirekt mit sich brachte, lassen sich nicht beziffern.
Vorhersagen von Vulkanausbrüchen sind heute viel besser als damals und auch Hungersnöte können durch den internationalen Handel abgeschwächt werden. Ein großer Vulkanausbruch und dessen Folgen auf Teile der weltweiten Landwirtschaft lassen sich also abfangen. Doch sollten diese Folgen global stattfinden - wie etwa beim Klimawandel - so führt dies zu einem neuen "sozialpolitischen Experiment".