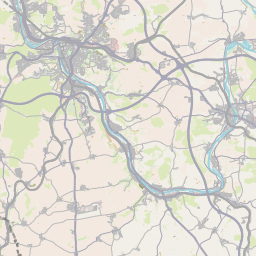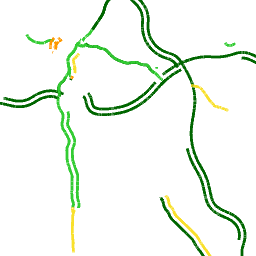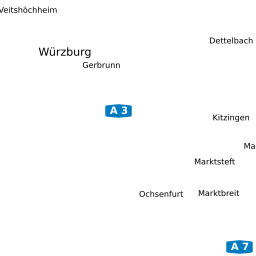30 Jahre Tschernobyl Auf der Suche nach der Wahrheit
26. April 1986: In Tschernobyl explodiert der vierte Block des Atomkraftwerks. Die westliche Welt erfährt erst Tage später, dass sich der Super-GAU ereignet hat. Helga Montag hat sich über zwei Jahrzehnte immer wieder vor Ort auf Spurensuche begeben.

Es gibt Themen, die lassen einen nicht los. Tschernobyl ist so eines. Als ich 1989 - also noch zu sowjetischen Zeiten - im Rahmen eines Austausches in der deutschen Redaktion des Ukrainischen Rundfunks in Kiew arbeitete, erfuhr ich, dass es möglich war, nach Tschernobyl zu fahren. Glasnost und Perestroika machten es möglich. Ein Jahr später war es soweit. Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Fink fuhr ich in die Ukraine, in der Hoffnung, herauszufinden, was 1986 in Tschernobyl geschehen war und wie sich die Situation fast fünf Jahre nach dem GAU darstellte. Wir hatten keine Vorstellung, was uns dort erwartete.
Das Schlimmste war nicht die 30-Kilometer-Zone rund um das Kernkraftwerk. Die war zwar gespenstisch: mit der Geisterstadt Pripjat, die nur drei Kilometer vom Reaktor entfernt liegt und in der vor der Katastrophe 50.000 Menschen gelebt hatten; das Kernkraftwerk mit dem Sarkophag über dem vierten Reaktorblock, an dem der Geigerzähler verrückt zu spielen begann; die abgesiedelten Dörfer, deren Friedhöfe niemand mehr besuchen durfte. Schlimmer aber noch war es, die Menschen zu erleben, die fast fünf Jahre nach dem GAU noch immer in Dörfern und Städten lebten, in denen die Strahlung höher war als in der "Zone"; die Mütter mit ihrem Babys, die in der Stadtverwaltung um die Genehmigung bettelten, wegziehen zu dürfen; die Schulkinder, die nicht im Freien spielen durften, weil Wälder und Wiesen verstrahlt waren; den Menschen zuzuhören, die der Natur nicht mehr trauten und die von Krankheit und Tod in ihren Familien erzählten. Und es mangelte an Lebensmitteln, an Medikamenten, an Geräten in den Krankenhäusern - und sogar an Strahlenmessgeräten.
Nicht nur berichten, sondern helfen
Es gibt Situationen, in denen man es als Journalist nicht mehr nur beim Beobachten, Recherchieren und Berichten belassen möchte. Zurück in München berichteten wir nicht nur über die Situation fünf Jahre nach dem GAU, sondern setzten uns auch für eine Spendenaktion ein. Der damalige Intendant Reinhold Vöth unterstützte diese Initiative. Rund 22 Millionen Mark spendeten die Hörer und Zuschauer des Bayerischen Rundfunks für die Opfer von Tschernobyl.
Widersprüchliche Aussagen
Zum zehnten Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl fuhren Matthias Fink und ich erneut in die Ukraine. Wir fanden eine unübersichtliche Situation vor. Es gab verstrahlte Regionen, in denen die Absiedlung weit vorangetrieben worden war, es gab aber auch Tendenzen, die Evakuierung zu stoppen und wieder Landwirtschaft zu betreiben. Wir bekamen widersprüchliche Aussagen über die Gefährlichkeit des Sarkophags und über die gesundheitlichen Folgen der Strahlung. Und wir trafen auch zehn Jahre danach noch unzählige Menschen, die sich im Stich gelassen fühlten, die nicht einmal die zum Überleben notwendigen Medikamente bekamen.
"Es ist schwer. Die Kinder hungern nicht. Wir essen alles aus unserem Garten, davon leben wir, denn wir haben kein Geld, um etwas zu kaufen. Die Kinder wissen, dass man das nicht tun soll. Ich weiß es auch, aber sonst verhungern wir. Wie schlecht es mir dabei geht und was ich fühle, das kann ich gar nicht mit Worten sagen. Ich habe Angst um meine Kinder."
Oleana Feschenko, Näherin
Die Wahrheit werden wir nicht finden
2006, zum 20. Jahrestag, sind wir erneut zu Recherchen aufgebrochen. Wir wollten sehen, wie es weitergegangen ist in den verstrahlten Städten. Wir wissen mittlerweile, dass wir keine überprüfbaren Zahlen herausbekommen werden. Im Dickicht von geheim gehaltenen Daten, fehlenden oder nicht überprüfbaren Statistiken wird es schwierig, sich ein umfassendes Bild zu machen. Bis heute streiten sich die Experten je nach politischem Standort über das Ausmaß der Katastrophenfolgen. Die Erfahrungen der Betroffenen sprechen eine andere Sprache.
BR 2011
Die Autorin:
Helga Montag war seit 1990 mehrmals auf Spurensuche in den verstrahlten Regionen in der Ukraine und in Weißrussland. Sie hat mit Betroffenen, Verantwortlichen und Politikern, mit Wissenschaftlern und Ärzten gesprochen. Sie hatte die Hoffnung, die Wahrheit herauszufinden über die Katastrophe und ihre Folgen. Als die Autorin 2011 an ihrem Feature zum 25. Jahrestag der sowjetischen Reaktorkatastrophe arbeitete, kam die Schreckensmeldung von Fukushima.
Hier können Sie das Manuskript herunterladen