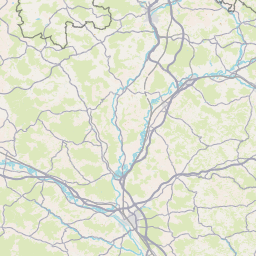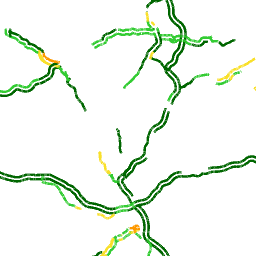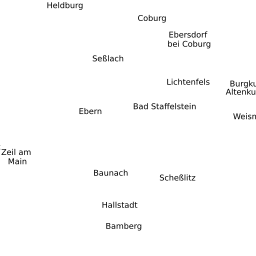Friedrich Hölderlin Die Sprache Hölderlins

Goethe spricht wohlwollend über Hölderlin. Er nennt ihn "wirklich liebenswürdig und mit Bescheidenheit, ja mit Ängstlichkeit offen." Mit dem, was ihm der junge Kollege 1797 zur Prüfung vorlegt, kann er allerdings wenig, bis gar nichts anfangen. Zu einem Rat von hoher Warte reicht es jedoch allemal. Goethe empfiehlt seinem verschreckten Besucher, künftig "kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen." Mit anderen Worten: Hölderlin ist durchgefallen! Zu ehrgeizig, zu pompös, zu verstiegen.
Edle Einfalt, stille Größe und ja kein Experiment
Auch Schiller, der den Landsmann zunächst fördert, ist von der Lyrik seines Bewunderers nicht angetan. Er nennt sie "subjektivistisch", "überspannt", "einseitig", beklagt "ihren idealischen Hang" und fürchtet, dass auch dieses "brave Talent" wie so viele andere verloren gehen könnte. "Idealisch", "subjektivistisch", "einseitig", "überspannt" - wie kommt dieser Eindruck zustande? Vielleicht muss sollte man zunächst einmal klären, wer das Urteil fällt. 1797 haben Goethe und Schiller die Ideenwelt der Weimarer Klassik bereits voll entfaltet. Ihr Konzept lautet Evolution statt Revolution, Maß und Ordnung, Klarheit und Ausgewogenheit, Gelassenheit und Seelenruhe.
Freiheit beginnt beim Satzbau
Von all dem ist Hölderlin weltenweit entfernt. Was und vor allem wie er schreibt, ist mit den Forderungen der Klassik nicht vereinbar. Das beginnt bei seiner Sprache mit ihrem ekstatischen Überschwang und ihrer oft dunklen Bildlichkeit. Das "Überspannte", Gedrängte, mitunter fast Gehetzte dieser Dichtung entsteht nicht zuletzt durch Eigenwilligkeiten eines Satzbaus, der sich kühn über die Regeln einer "normalen", schulgemäßen deutschen Syntax hinwegsetzt. Die Wort- und Satzumstellungen erzeugen immense, hochwirksame Spannungen, aber auch syntaktische Leerstellen und Verständnisprobleme. Die grammatischen Bezüge sind nicht immer sofort klar, es entstehen strukturelle Mehrdeutigkeiten und eine Art rhythmisch-syntaktisches Flackern, das Unrast vermittelt. Hölderlin setzt diese Mittel bewusst und wohlüberlegt ein. Zum einen ist diese Sprache ein "heiliger" Raum, in dem sich das Göttliche zeigt. Zum andern ist diese Sprache der Versuch, in einem Akt selbstbestimmter Freiheit etwas ganz Eigenes zu schaffen. Und dieser "freie Gebrauch des Eigenen ist das schwerste, was die moderne Kunst zu lernen hat".
Pardon wird nicht gegeben
Der "hohe Ton", die Geste des Seherdichters, die rhythmische, syntaktische Erregtheit, eine ausgefeilte Metrik, die in ihrer Fülle, Meisterschaft und Raffinesse unerreicht ist, all das schafft eine Dichtung, in der es keine Ruhepunkte, kein Ausrasten gibt. Dazu kommt ein inhaltlicher Anspruch, der kein rasches Überlesen erlaubt. Hölderlin schreibt keine Erlebnislyrik. Hölderlins Dichtung ist Gedankenlyrik. Selbst da, wo er von eigenem Erleben, von konkreten Landschaften oder Örtlichkeiten ausgeht, landet er schnell und zielsicher bei seinen eigentlichen Themen: Bei der Frage, wie Geist und Natur zueinanderstehen, was das Wesen des Göttlichen und des Menschlichen ausmacht, wie diese Kräfte im Geschichtsprozess wirksam werden, aufscheinen und untergehen.
Pallaksch! Pallaksch!
Hölderlin macht keine halben Sachen. Und er will auch keine halben Leser. Er will den ganzen, den arbeitenden, den mitarbeitenden Leser. Trotzdem bleibt vieles nicht nur beim ersten, sondern auch wiederholten Lesen unverständlich. Lohnt sich die Mühe? Darauf muss jeder seine eigene Antwort finden. Das Leben wird durch Hölderlin nicht besser, nicht leichter. Es ist nur Dichtung. Keine Annäherung an ein wirkliches Kunstwerk wird je mehr sein als bestenfalls asymptotisch. Aber laut und langsam lesen hilft. Mehrmals lesen hilft auch. Und ganz zuletzt steht es jedem frei, zu reagieren wie der greise Hölderlin, wenn er Fragen beantworten sollte, die er partout nicht beantworten wollte. Solche Fälle fertige der Dichter kurzerhand ab mit einem entschiedenen "Pallaksch, Pallaksch!"