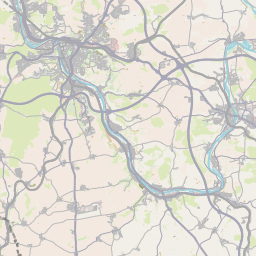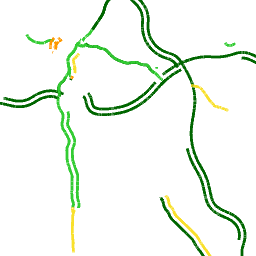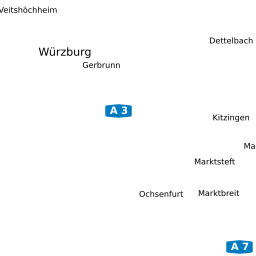Professor:innenlaufbahn Wer kommt an die Spitze? Auch Kinder aus "niederen" sozialen Verhältnissen?
Hat ein Arbeiterkind mit gleichem Hochschulabschluss wie ein Akademikerkind ehrliche Chancen auf eine Professor:innenlaufbahn? Oder findet hier eine Diskriminierung auf Grund sozialer Herkunft statt? Eine Analyse des Deutschen Hochschulverbandes auf der Wissensplattform "Forschungs & Lehre".

Der Klassismus an sich bezeichnet die Vorurteile gegenüber sozialer Herkunft, so auch im Bezug auf den Bildungsabschluss und nicht zuletzt auf den Zugang zu Professuren. Das ist dann der Klassismus academicus. Er richtet sich meist gegen Angehörige einer "niedrigeren" sozialen Klasse.
Laut der Analysen Tanja Gabriele Baudsons und Riccardo Altieris vom Deutschen Hochschulverband zeigt der "Bildungstrichter": Von 100 Grundschulkindern, deren Eltern beide studiert haben, besuchen 74 die Hochschule. 63 erwerben einen Bachelor-, 45 einen Masterabschluss, und 10 erlangen die Doktorwürde. Bei 100 Kindern aus nicht-akademischen Haushalten gelangen nur 21 an die Hochschulen, 15 schaffen den Bachelor, acht den Master, und nur eine Person wird promoviert.
Das hat weitreichende Folgen für den akademischen Alltag bis hin zur Besetzungspolitik für Lehrstühle.
Nur 11 Prozent - d.h. sieben der 698 befragten C4- beziehungsweise W3-Proefssor:innen aus "niedriger sozialer Herkunft"
Auch der Status der Professur ist mit der sozialen Herkunft verbunden. Von 698 befragten C4- beziehungsweise W3-Professorinnen und Professoren stammten 34 Prozent aus dem Spektrum mit "hoher sozialer Herkunft", nur 11 Prozent aus der Gruppe mit "niedriger sozialer Herkunft". Bei 431 befragten C3- und W2-Professorinnen und -professoren verhielt es sich nahezu analog. Lediglich 119 außerplanmäßige Professuren ohne entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung waren etwas durchlässiger für Angehörige der beiden mittleren Gruppen ("mittel" = 28 Prozent, "gehoben" = 31 Prozent).
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften am durchlässigsten für die Chance auf eine Professor:innenstelle mit nichtakademischen Hintergrund
Besonders eklatant war damals der soziale Unterschied bei den 42 befragten Juniorprofessorinnen und -professoren: Während nur je sieben Prozent eine "niedrige" oder "mittlere soziale Herkunft" besaßen, konnten 62 Prozent derjenigen mit "hoher sozialer Herkunft" einen solchen Posten erlangen. Einige Fächer sind besonders selektiv: In den Rechtswissenschaften stammen beispielsweise 79 Prozent, in der Humanmedizin 72 Prozent aller Professorinnen und Professoren aus der "gehobenen" oder "hohen" Herkunftsgruppe. Am anderen Ende der Skala finden sich die Sozial- und Politikwissenschaften (56 Prozent), die Psychologie, Erziehungswissenschaften beziehungsweise Sonderpädagogik (54 Prozent) und schließlich die Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften mit lediglich 40 Prozent Professorinnen und Professoren aus diesen beiden Herkunftsgruppen.
Mechanismen klassistischer Diskriminierung
Wie kommt es zu solch selektiven Benachteiligungen? Idealerweise sollte es doch so aussehen: Wer die notwendige Begabung mitbringt und bereit ist, sich anzustrengen, dem sollte im akademischen System auch der Erfolg beschieden sein. Die Realität straft die angebliche Meritokratie indes Lügen: Den "Mythos von den Leistungseliten", dass nur diejenigen an die "Spitze" kämen, die es tatsächlich verdienten, hat Hartmann schon 2002 im Titel seines gleichnamigen Werks demaskiert. Erfolg ist im Wesentlichen eine Frage der Passung zwischen persönlichen Charakteristika und Systemanforderungen – und als Mensch mit akademischer Sozialisierung kann man eher mit Passung rechnen als ein Arbeiterkind ohne studierte Vorbilder in der Familie, da im ersten Fall die Systemanforderungen von Menschen definiert werden, die einem ähnlich sind.
"Das System" – das sind unter anderem die Anreiz- und Belohnungsstrukturen. Das Los aller Erfolgsmetriken ist, dass sie irgendwann zum Selbstzweck werden. Für die Psychologie haben Abele-Brehm und Bühner untersucht, woran Berufungskommissionen ihre Entscheidung festmachen. Ganz vorn stehen die thematische Passung mit den wissenschaftlichen Aktivitäten des ausschreibenden Instituts, die Menge der (möglichst peer-reviewten) Publikationen, Qualität des Forschungsvortrags sowie erfolgreiche Akquise möglichst großer Drittmittelsummen. Ersteres lässt sich psychologisch nachvollziehen – gemeinsam erreicht man mehr, und lokale Profile ziehen wiederum Menschen an, die der betreffende Bereich besonders interessiert. Die bloße Menge der (peer-reviewten) Publikationen ist indes als Indikator wissenschaftlicher Qualität unzureichend – und auch das dadurch gewonnene Prestige ist primär ein systeminternes. Wer will, dass seine Forschungsergebnisse in der Gesellschaft ankommen, erreicht, überspitzt gesagt, mit der Springer-Presse deutlich mehr Impact als über den gleichnamigen Wissenschaftsverlag.
Bei Drittmitteln (ein Begriff, mit dem außerhalb des akademischen Betriebs kaum jemand etwas anfangen kann) zählt übrigens nicht nur die Menge. Dass nicht jeder Euro gleich ist, sondern dass seine Herkunft mehr zählt als das, was man damit erreicht, ist denjenigen schwer zu vermitteln, für die es nicht einmal selbstverständlich ist, überhaupt Geld zu haben. Der "Wettbewerbsgedanke" an sich hat auch weniger mit wissenschaftlicher als vielmehr mit wirtschaftlicher Qualität zu tun. Letzten Endes ist er darwinistisch: Survival of the fittest – das ist das Überleben derer, die am besten ins bestehende System passen. Erfolgreich im Wettbewerb sind vor allem Ideen, die hohe Erfolgsaussichten bergen. Risikofreude und Innovation fördert man mit derlei Sicherheitsdenken gewiss nicht.
Hinzu kommt noch die Konkurrenz um die begrenzten Lehrstühle:
Wer in diesem Wettbewerb bestehen will, darf sich keine Fehler leisten, sondern sollte möglichst von Anfang an die Regeln kennen und nach ihnen spielen. Wer schafft das? Kleiner Tipp: Die Arbeiterkinder sind es in der Regel nicht; und dass Einzelnen die Karriere manchmal dann doch gelingt, widerlegt nicht die Existenz des Problems. Es gibt wohl eine Art "kritische Unähnlichkeit", ab der man die Grenzen der zulässigen Diversität des Systems nicht mehr auslotet, sondern sich aus selbigem herauskatapultiert. Reibung erzeugt keine Nestwärme, sondern kann für die eigene Karriere dann durchaus brandgefährlich werden, so aus den Recherchen des Deutschen Hochschulverbandes zu verstehen. Mit zunehmendem Karriereverlauf zählt nicht mehr Leistung allein – von den "Professorablen" ist wohl niemand wirklich leistungsschwach –, sondern zunehmend der Habitus. Genießt man in der Promotionszeit noch die Freiheit der totalen Irrelevanz, so ändert sich dies spätestens dann, wenn das Hauen und Stechen um die Professuren beginnt und diejenigen, zu denen man strebt, bei so manchem Arbeiterkind pikiert die Nase rümpfen, weil der "Stallgeruch" nicht stimmt – im Zweifel wählen diese dann doch die Person, die ihnen ähnlicher ist, so schön sie Diversität vielleicht grundsätzlich fänden.
Was sich ändern muss: sich den Schuh der herkunftsbedingten Beschämung nicht anziehen
Die Hochschule (sprich: die Menschen, die an ihr arbeiten) kann das umfassende Versagen des Bildungssystems in puncto Chancengerechtigkeit nicht wettmachen; aber sie kann dazu beitragen, dass immerhin diejenigen, die es bis dahin geschafft haben, weniger aufgrund ihrer Herkunft beschämt werden. Öffentliche Hochschulen sind für alle da, und Bildung ist ein Recht – kein Privileg, das einem noch Privilegiertere zugestehen.
So wenig, wie strukturelle Probleme auf seiten der Betroffenen individualisiert werden sollen, soll dies auch auf der Gegenseite geschehen. Die wenigsten akademischen Entscheidungsträgerinnen und -träger werden sich morgens vor dem Gang in die Berufungskommission vornehmen: "Heute verhindere ich mal die Karriere eines Arbeiterkindes!" Es würde aber schon helfen, wenn sie ihre eigenen Befangenheiten (selbst-)kritisch reflektierten: Was genau stört mich an Bewerber beziehungsweise Bewerberin X’ Habitus, und was sagt das über mich selbst aus? Genügt unser Vorgehen in der Kommission den Qualitätsstandards, die man an gute Personalauswahl anlegen sollte, oder rationalisieren wir gerade persönliche Befindlichkeiten, Wünsche und Ängste? Ehrlichkeit gegenüber sich selbst erfordert Selbst(er)kenntnis und emotionale Reife. Wir mutmaßen, dass die Entwicklung dieser Qualitäten im Laufe des Aufstiegs im akademischen System nicht unbedingt im Vordergrund steht und dass insbesondere diejenigen, denen das konfliktarm gelang, wenig Notwendigkeit erfahren haben, sie zu entwickeln.
Gerade "Arbeiterkinder" mit ihrer doppelten Sozialisation sind unschätzbare Bindeglieder im Dialog zwischen Academia und der Gesellschaft insgesamt. Möglicherweise können sie gar die Demokratie stabilisieren. Darüber hinaus kann ihr potenziell kritischer Blick auf das System dazu beitragen, Missstände zu identifizieren und zu ändern. Wer von der meritokratischen Illusion profitiert (unter Umständen, ohne sich dessen bewusst zu sein), im Zweifelsfall gar Pfründe abgeben müsste, wird hierzu wohl weniger motiviert sein als jemand, der viel gewinnen kann. Aber Veränderung geht nur gemeinsam. Insofern gilt es, der Entsolidarisierung aktiv entgegenzuwirken. Sich den Schuh der herkunftsbedingten Beschämung nicht anzuziehen, sondern im Gegenteil stolz zu sein auf das, was man gegen Widerstände erreicht hat.
Als Arbeiterkind, das es geschafft hat, sich nicht mit denen gemein zu machen, die anderen den "Aufstieg" erschweren, sondern sich zu solidarisieren. Schon dem akademischen Nachwuchs, insbesondere dem aus Nichtakademikerfamilien, zu zeigen: Wir sind viele – und gemeinsam können wir Academia zu einem besseren, inklusiveren Ort machen, an dem Vielfalt mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist.