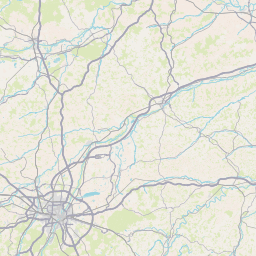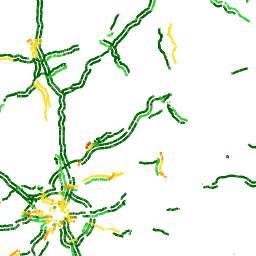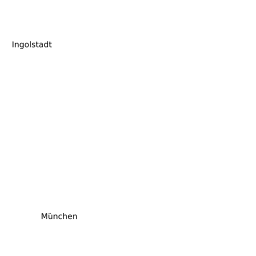Das Dunkle erkennen Depression und Burnout
Was ist eine Depression? Wie äußert sie sich, und was löst sie aus? Und was kann man als Betroffener oder aber auch Angehöriger tun? Antworten finden Sie hier.
Von: Veronika Wawatschek
Stand: 11.10.2022 |Bildnachweis

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen – aber auch zu denen, die am meisten unterschätzt werden.
Dabei kennen die meisten Menschen gute und schlechtere Tage. Stimmungsschwankungen gehören zum Leben dazu. Wenn allerdings Betroffene über Wochen nicht mehr aus dem Tief herauskommen, sich also depressiv, freud- und interessenlos fühlen und außerdem ihr Antrieb vermindert und sie sich sehr schnell schlapp fühlen und ihre Aktivitäten einschränken, außerdem schlecht oder kaum mehr schlafen, keinen Appetit mehr haben und oder an massiven Selbstzweifeln leiden, spricht man von einer Depression. Oftmals leidet nicht nur der Patient selbst, sondern auch seine Angehörigen massiv unter der Situation. Denn selbst eine sogenannte "leichte depressive Episode" nach der aktuellen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist nicht zu unterschätzen. Rechtzeitig und konsequent behandelt, bleibt es in der Regel aber bei einer einem einmaligen Ereignis.
Der Text beruht auf einem Gespräch mit Prof. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbadklinik Furth im Wald.
"Ich fühle mich heute depressiv" - das ist längst im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen. Gefühle von Traurigkeit kennt wahrscheinlich jeder. Ob es sich aber um die behandlungsbedürftige Diagnose der Depression handelt, hängt von der Anzahl der Haupt- und Nebensymptome, sowie der Dauer ab, wie lange diese Symptome bestehen.
- depressive, gedrückte Stimmung;
- Interessensverlust und Freudlosigkeit;
- Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit (oft selbst nach kleinen Anstrengungen) und Aktivitätseinschränkung.
- verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit;
- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen;
- Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit;
- negative und pessimistische Zukunftsperspektiven;
- Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen;
- Schlafstörungen;
- verminderter Appetit.
Depressive Stimmung, verminderter Antrieb sowie allgemeine Freud- oder Interesselosigkeit – das sind die Hauptsymptome, die die WHO für die Diagnose Depression beschreibt. Wie die Patienten diese Stimmung ausdrücken, ist oft sehr unterschiedlich: Manche sprechen von Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Andere haben eher das Gefühl, nichts zu fühlen – sich also weder freuen zu können, noch Trauer zu spüren. Daneben gibt es noch zahlreiche Nebensymptome – etwa Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, eine negative Zukunftsperspektive, ein schwaches Selbstwertgefühl, Konzentrationsprobleme oder Suizidgedanken. Sind diese Symptome über mehr als zwei Wochen vorhanden, spricht man von einer Depression. Der Zeitrahmen hängt allerdings stark von der Krankheitsdefinition ab und die hat sich im Laufe der Zeit gewandelt – einerseits aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, andererseits aber auch aufgrund gesellschaftlicher Trends.
"Ob eine Depression nun nach zwei oder vier Wochen attestiert wird, hängt neben dem verwendeten Diagnosesystem auch davon ab, wie viel Krankheit eine Gesellschaft zulässt, wie schnell der Betroffene wieder leistungsfähig sein muss, aber auch wie rasch sich das Hilfesystem für zuständig erklärt."
Prof. Reinhart Schüppel, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
In der Regel wird eine Depression anhand ihres Schweregrades diagnostiziert. Grob gesagt: Je mehr Symptome, desto schwerer die Erkrankung. Es gibt also leichte, mittelgradige und schwere Depressionen. Allerdings hat bereits eine leichte Episode für die Betroffenen erhebliche Lebenseinschränkungen zur Folge. Zwar funktionieren die Patienten gerade im Arbeitsalltag noch relativ gut. Zu Hause klappen sie aber regelrecht zusammen.
"Leichte Depression, das klingt wie leichte Kost – für die Betroffenen fühlt sich das aber alles andere als einfach an."
Prof. Reinhart Schüppel, Chefarzt Johannesbad Klinik Furth im Wald
Einem Patienten mit einer mittelschweren Depression ist es dann nicht mehr möglich, ein normales Leben zu leben. In der Regel braucht er für die Behandlung auch Medikamente. Und bei einer schweren Depression zieht der Betroffene buchstäblich die Vorhänge zur Außenwelt zu, weil er zu sehr mit sich selbst und dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit kämpft. "Ich bin nichts, ich kann nichts" - solche Aussagen bestimmen die Selbstwahrnehmung eines Menschen mit einer schweren Depression. Er fühlt sich gefangen in seinem Inneren.
Bundesweit zeigen mehr als zehn Prozent der Bevölkerung im Laufe eines Jahres Symptome einer Depression – nicht alle aber entwickeln tatsächlich eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Pro Jahr leiden rund acht Prozent der Erwachsenen in Deutschland an einer Depression, das entspricht gut fünf Millionen Menschen. Insgesamt erkrankt etwa jede vierte Frau und etwa jeder achte Mann einmal im Leben an einer Depression. Der Geschlechtsunterschied könnte aber auch dadurch begründet sein, dass Frauen sich leichter damit tun, über Gefühle zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Männer wählen dagegen oftmals eher den Weg in die Selbstmedikation, etwa die Flucht in den Alkohol. Außerdem kann sich bei Männern die Depression auch ganz anders zeigen, etwa in aggressivem Verhalten, das vordergründig nicht mit der Diagnose in Verbindung gebracht wird.
Im Grunde können Depressionen in jedem Alter auftreten. Oftmals stehen sie aber in Verbindung mit einschneidenden Lebensereignissen oder Übergängen im Leben. Nicht umsonst spricht man von der Midlifecrisis. Denn Menschen mittleren Alters sind etwas häufiger betroffen. Eine besondere Rolle spielt die Schwangerschaftsdepression oder auch die postpartale Depression – also die Wochenbettdepression. Hier scheinen die Hormone eine größere Rolle zu spielen. Im Alter dagegen gibt es oft Begleitsymptome wie Einsamkeit, Verlust von wichtigen Menschen oder auch der Verlust der eigenen Mobilität, die einer gesunden Seele eher nicht dienlich sind. Depressionen im Alter sind daher oft auch schwerer zu behandeln als in jungen Jahren.
Früher unterschied man zwischen endogenen und exogenen Depressionen – also Diagnosen, die durch ein äußeres Ereignis, etwa den Verlust des Partners oder des Jobs ausgelöst wurden, und solche Erkrankungen, die "hirnorganisch" bedingt schienen ohne äußeren Stressor. Von dieser Unterscheidung ist man inzwischen abgekommen. In der Regel kommen mehrere Faktoren zusammen.
Aus der klinischen Erfahrung hat sich gezeigt: Manche Menschen reagieren sehr stark etwa auf einen Todesfall. Bei anderen gleicht eine Depression dagegen eher einer Art "Verbitterungsstörung", also den Folgen einer fortwährenden oder über einen Lebensabschnitt aufsummierten Kränkung – ob nun beruflich oder privat. Die Betroffenen haben dann beispielsweise das Gefühl, immer den Kürzeren zu ziehen, mehr arbeiten, mehr kämpfen, sich mehr beweisen zu müssen als andere.
Bei wieder anderen findet man eine familiäre Häufung ohne externen Anlass. Hier wird die Rolle der Genetik diskutiert. Neuere Forschungen rund um sogenannte transgenerationale Traumata haben in diesem Zusammenhang gezeigt: Eine schwer belastende Erfahrung wirkt sich auf die Folgegeneration aus. Kriegserfahrungen z. B. ließen sich in der nachfolgenden Generation "epigenetisch" zeigen. Das heißt: Nicht die Gene an sich waren verändert, sondern das Ablesen der Gene hatte sich durch diese traumatischen Erfahrungen in der Nachfolgegeneration geändert.
"Das kann man am besten greifbar machen, wenn man sich die Gene mit einer CD-Sammlung vorstellt. Diese bleibt von Generation zu Generation erstaunlich konstant. Was sich ändert, ist, welche CD aufgelegt wird."
Prof. Reinhart Schüppel
Und so weiß man beispielsweise aus Tierversuchen. Mäuse, die schlecht behandelt wurden, geben ihre Ängstlichkeit an die Nachkommen weiter. Allerdings darf die Rolle der Gene und der Epigenetik nicht überschätzt werden.
"Man muss jeder Generation die Chance geben, nicht mit einer Hypothek, sondern mit neuen Möglichkeiten ins Leben zu starten."
Prof. Reinhart Schüppel
Oft wird bei einer Depression sehr intensiv nach Faktoren aus dem Innenleben der Betroffenen gesucht. Das hat auch seine Berechtigung. Aber aus den Jahren der Corona-Pandemie, wissen wir, dass Depressionen weltweit um 25 Prozent zugenommen haben – ein starker Hinweis, dass auch das Leben "außen" eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer solchen Erkrankung hat.
Ob und wann ein Betroffener behandelt wird, hängt vom eigenen Leidensdruck, oftmals aber auch von seinem Umfeld ab. Nicht selten schaffen es die Patienten selbst nicht, sich Hilfe zu holen. Und oft sind es dann die Angehörigen, die beim Hausarzt Rat suchen.
Die Behandlung einer Depression richtet sich nach dem Schweregrad. Bei einer leichten Episode reicht in der Regel Psychotherapie. Ab einer mittelschweren Depression sind auch Medikamente angezeigt.
Ob und welche Therapiemethode Wirkung zeigt, hängt nicht nur, aber auch vom Patienten selbst, aber auch der therapeutischen Beziehung ab. Einige Psychotherapiestudien gehen sogar davon aus: Die Effektivität liegt weniger an der therapeutischen Schule – also ob es sich um eine Gesprächspsychotherapie, eine tiefenpsychologisch fundierte oder analytische oder eine verhaltenstherapeutische Therapie handelt – denn vom Therapeut-Patienten-Verhältnis.
Dennoch unterscheiden sich die therapeutischen Methoden: Eine klassische kognitive Verhaltenstherapie setzt darauf, den Patienten wieder ins soziale Leben zu integrieren. Sport, Bewegung, kleine Tagesaufgaben gehören hier mit zum Programm. Außerdem werden krankmachende Gedanken hinterfragt. Mit dazu gehört auch die Wissensvermittlung: Was ist eine Depression? Warum fühlt sich der Patient so, wie er sich gerade fühlt?
Achtsamkeitsbasierte Methoden setzen auf Techniken aus der Meditation. Hier geht es weniger darum, negative Gedanken zu hinterfragen und auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen – also zu hinterfragen, ob der Patient doch nun wirklich absolut unfähig ist, so wie er es momentan denkt. Stattdessen soll der Patient lernen, solche Gedanken ziehen zu lassen "wie Wolken", sie kommen und gehen lassen und somit achtsamer, aber auch weniger streng und bewertend mit sich selbst umzugehen.
Tiefenpsychologische oder analytische Verfahren setzen eher darauf, die Ursache der Krankheit zu herauszufinden. Denn sie kann biographisch in schlimmen Erfahrungen in der Vergangenheit begründet sein, könnte aber auch in einem aktuellen Konflikt, vielleicht auf der Basis früherer Erfahrungen begründet sein.
Unabhängig vom Verfahren ist es wichtig, dass der Patient lernt und erlebt, er ist nicht nur Opfer seiner Diagnose, sondern er kann selbst sein Leben bis zu einem gewissen Maß zunehmend wieder gestalten, und sei es nur, dass er lernt, mit seiner Diagnose zu leben und sie zu akzeptieren.
Die Therapie mit Medikamenten basiert heute auf den Forschungsergebnissen zum Stoffwechsel im Gehirn, besonders zu Neurotransmittern, mit deren Hilfe Nervenzellen Informationen austauschen. Noradrenalin, Dopamin und Serotonin sind wichtige Vertreter solcher Botenstoffe. Der letztgenannte prägt die aktuelle Pharmakotherapie besonders.
Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI)
Früher wurden, abhängig von den Symptomen, nach ärztlicher Erfahrung entweder beruhigende Antidepressiva verschrieben, wenn jemand nicht schlafen konnte, oder antriebssteigernde Medikamente bei schweren Antriebsstörungen. Dabei mussten auch z. T. erhebliche Nebenwirkungen in Kauf genommen werden.
Heute gelten sogenannte Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) als Mittel der ersten Wahl in der Depressionsbehandlung. Sie haben relativ wenig Nebenwirkungen. Manche Patienten fühlen sich am Anfang etwas zittrig oder haben Schweißausbrüche. In Ausnahmefällen kann es bei Männern zu Potenzstörungen kommen. Bei einer schwereren Depression können die SSRI dafür sorgen, dass sich die Symptome "von sich aus" bessern, aber auch, dass der Patient es überhaupt schafft, an einer Psychotherapie teilzunehmen.
Die Serotoninwiederaufnahmehemmer sorgen dafür, dass der Botenstoff Serotonin – der für eine ausgeglichene Stimmung sorgt, länger an den Rezeptoren im Gehirn andockt. Die zugrundeliegende Wirkung der Medikamente aber beruht auf Veränderungen innerhalb der Nervenzellen – deshalb dauert es auch einige Tage bis Wochen, bis SSRIs wirken.
Inzwischen verfolgt man in der medikamentösen Behandlung auch nicht mehr das Prinzip der reinen Dosiserhöhung– einfach mehr von einem Medikament zu geben, wenn es scheinbar nicht wirkt. Stattdessen gibt man lieber noch ein weiteres Präparat dazu.
Neuroleptika wie Melperon werden eigentlich bei Psychosen oder Erregungszuständen eingesetzt. Manche Menschen mit Depressionen leiden aber auch unter starken Ängsten oder Wahnvorstellungen – etwa, dass sie glauben, an etwas schuld zu sein. In diesen Fällen können Neuroleptika helfen und auf einzelne Zielsymptome einwirken.
Benzodiazepine versucht man nur kurzzeitig zu geben. Sie haben ein hohes Abhängigkeitspotential, können aber gegen Suizidalität helfen.
"Bei Benzodiazepinen setzt man die Patienten quasi hinter eine Milchglasscheibe und das wäre langfristig kontraproduktiv. Denn eigentlich will man ja Menschen mit Depressionen die Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen und sie nicht herunterregulieren."
Prof. Reinhart Schüppel
Gerade depressive Patienten berichten auch von Suizidgedanken. Diese müssen unbedingt ernst genommen werden. Etwa 10.000 Menschen in Deutschland setzen solche Gedanken jedes Jahr leider noch in die Tat um.
Trotzdem müssen Angehörige, aber auch Therapeuten es nicht fürchten, wenn Patienten Suizidgedanken äußern. Wichtig ist, dass der Patient das Gefühl hat, er kann diese Gedanken äußern, besprechen und wird dafür nicht verurteilt. Dann können sich die Patienten auch auf eine Behandlung besser einlassen. Sobald die Gedanken geäußert sind, ist das "Gift" raus und man kann auch über die Eigenverantwortung der Patienten sprechen, ja sie sogar nutzen.
"Ich sage meinen Patienten immer: Ich will nicht nachts um vier Uhr aufwachen mit dem Gedanken, hoffentlich lebt der Herr XY noch. Deshalb müssen Sie mir helfen, dass ich schlafen kann und dass ich es schaffe, Ihnen zu helfen."
Prof. Reinhart Schüppel
Viele Angehörige von Menschen mit Depressionen kommen im Laufe der Erkrankung selbst an ihre Grenzen.
Denn bei psychischen Krankheiten ist Hilfe nicht immer einfach. Die Angehörigen brauchen einen sehr langen Atem. Oft schaffen es die Betroffenen nicht, sich beim Helfer zu bedanken oder bekommen dadurch zusätzlich ein schlechtes Gewissen, was zu einer weiteren Verschlimmerung der Symptome führen kann. Eine Abwärtsspirale!
Wichtig für die Angehörigen ist deshalb, dass sie lernen, erst mal auch gut für sich selbst sorgen. Pausen sind da unerlässlich. Denn Überlastung kann zu unterschwelliger Aggression dem Patienten gegenüber führen und das wiederum ist weder der Beziehung noch der Genesung zuträglich.
Das findet sich bei fast allen depressiven Erkrankungen: ein Stressor. Deshalb jeglichen Stress zu vermeiden aber ist ein Trugschluss. Stress ist nicht per se verkehrt. Ein gewisses Maß an Stress führt dazu, dass Herausforderungen überhaupt angepackt und gemeistert werden.
Dazu gehört etwa, dass Eltern eine altersgerechte Entwicklung ihrer Kinder unterstützen. Tendenziell sorgen Eltern heute eher dafür, dass Schwierigkeiten für die Kinder vermieden oder beseitigt werden. Damit nehmen sie Kindern potentiell eine Entwicklungsmöglichkeit. Kinder müssen sich auch in Konfliktsituationen als selbstständig und selbstwirksam erleben – etwa indem sie selbst eine Lösung des Konflikts herbeiführen und nicht nur die Eltern für sie.
Als Schutzfaktor vor psychischen Erkrankungen werden sichere Bindungen und ein soziales Netz genannt. Außerdem wird die Resilienz als Schutz vor Depressionen diskutiert – dieser Faktor scheint genetisch wie psychologisch bedingt zu sein. So scheinen Menschen, die Humor haben und weniger zum Katastrophisieren neigen, weniger anfällig für Depressionen zu sein. Ein gesunder Lebensstil – etwa eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung – können zusätzlich die Seele stabil halten.
Lange Zeit wurde darum gerungen, ob das Burnout-Syndrom ein eigenes Krankheitsbild ist oder nicht. Seit 2022 gibt es einen Kompromiss in Form des Diagnosekatalogs ICD11, der Burnout erstmals aufführt – allerdings nicht als eigene Krankheit, sondern in einem Kapitel von Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen können. Gelistet ist das Syndrom in der Unterrubrik "arbeitsbezogene Probleme". Damit ist gemeint, dass Burnout bisher am besten im beruflichen Kontext untersucht worden ist. Es gibt das Syndrom natürlich auch in anderen Zusammenhängen, wie Pflege von Angehörigen. Zu den ursprünglich definierten Symptomen gehören Erschöpfungsgefühle oder Gefühle des Ausgebrannt-Seins, eine negative Einstellung der Arbeit gegenüber bis hin zum Zynismus sowie das Gefühl, dass man in der Arbeit eigentlich nichts mehr schafft. Eine Altenpflegerin, die ihren Beruf ursprünglich mal mochte, tritt ihren Pflegebedürftigen dann mitunter aggressiv oder feindselig gegenüber. Ein Wissenschaftler, der eigentlich für sein Thema brennt, hat das Gefühl, seine Forschungen und Mühen sind sinnlos.
Das perfide daran: Ein Burnout-Syndrom tritt nicht plötzlich auf, es gleicht eher einem schwelenden Brand, einem schleichenden Prozess. Erste Hinweise gibt oft auch der Körper: Verspannungen, Schlafstörungen, allgemeine Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen können ein Hinweis sein, dass die Belastung gerade zu viel wird.
Dabei muss darauf hingewiesen werden: Auch, wenn ein Burnout im beruflichen Kontext genannt wird, kann er auch Hausfrauen, Ehrenamtliche oder Menschen treffen, die ein Hobby exzessiv betreiben.
"Wer für etwas brennt, kann deswegen auch ausbrennen."
Prof. Reinhart Schüppel, Johannesbadklinik Furth im Wald
Therapeutisch gesehen macht es durchaus Sinn, dem Symptomkomplex ein eigenes Unterkapitel zu widmen. Für viele Betroffene ist es leichter ein eigenes Ausgebrannt-Sein zu akzeptieren, denn depressive Symptome – auch wenn diese einem Burnout oftmals gar nicht so unähnlich sind.
"Lange Zeit war für viele Betroffene das Burnout-Syndrom die Fahrkarte zu sagen: Ich habe ein Problem in der modernen Berufswelt. Burnout ist sozusagen der kleine Bruder, die kleine Schwester der Depression. Stress kann zu einem Burnout-Syndrom führen und dieser wiederum eine Suchterkrankung, eine Depression oder eine Angsterkrankung zur Folge haben."
Prof. Reinhart Schüppel
Statistiken rund um das Burnout-Syndrom gibt es in großer Zahl, aber jede ist umstritten. Bereits Anfang der 2000er Jahre stellte die Internationale Arbeitsorganisation ILO ein deutlich gestiegenes Stresslevel am Arbeitsplatz mit den entsprechenden psychischen Folgen für die Arbeitnehmer fest. Manche Experten schätzen, dass jeder fünfte Berufstätige einmal im Erwerbsleben ausbrennt. Aus den Statistiken der Krankenkassen zeigt sich: die Zahl derer, die sich aufgrund eines Burnout-Syndroms krankschreiben lässt, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Ebenso ist die Zahl der Fehltage pro Patient aus diesem Grund gestiegen.
Betroffen davon sind alle Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Allerdings scheinen vor allem soziale Berufe – Lehrer, Sozialarbeiter, Pflegekräfte – sowie Polizisten und Menschen in Führungsverantwortung besonders gefährdet zu sein, einen Burnout zu entwickeln. Möglicherweise scheinen auch deshalb überdurchschnittlich viele Männer betroffen zu sein.
Stress an sich ist zunächst nicht negativ. Ohne ein gewisses Stresslevel würden Menschen es nicht wagen, Herausforderungen überhaupt selbst in die Hand zu nehmen. Wenn Kindern sämtliche Hürden im Leben genommen werden, beraubt man sie wichtiger Entwicklungsaufgaben.
Zu viel Stress allerdings hat negative Auswirkungen auf Körper und Seele. Denn wer andauernd unter Strom steht, hat auch ein hohes Maß an Stresshormonen im Körper. Ein dauerhaft erhöhtes Adrenalin-, Nordadrenalin- oder Cortisonlevel aber schädigt den Körper, kann auf den Magen schlagen, sich in Verstopfungen äußern, zu Herzrasen oder Herzstolpern führen, einen hohen Blutdruck zur Folge haben, sich in Atembeschwerden auswirken oder sogar einen Hörsturz verursachen.
Spätestens, wenn sich der Betroffene "kurz vor dem Nervenzusammenbruch" wähnt, sich zu nichts mehr aufraffen kann, sich andauernd erschöpft fühlt und sich die Symptome auch nach einem Wochenende oder einem Kurzurlaub nicht bessern, ist es Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen.
Zunächst ist es wichtig festzuhalten: Moderne Beschäftigungsverhältnisse sind oftmals alles andere als gesund für die Seele. Sie bieten im Gegenteil sogar vielfältige Möglichkeiten, einen Burnout zu entwickeln, sei es durch Leistungs- und Zeitdruck, durch unsichere Umstände oder durch die Erfordernisse einer globalisierten, digitalisierten und hochtechnisierten Arbeitswelt.
"Es gibt Beschäftigungsverhältnisse, da stehen Ihnen die Haare zu Berge."
Prof. Reinhart Schüppel
Das anzuerkennen ist für die Therapie und ein vertrauensvolles therapeutisches Verhältnis unerlässlich. Allerdings gilt es, immer auch den Eigenanteil anzuschauen.
"Für viele ist es zunächst wichtig, darüber zu reden, was ihnen angetan wurde, bevor man darüber redet, was man selbst zugelassen hat."
Prof. Reinhart Schüppel
Allerdings muss das Ziel einer Burnout-Behandlung sein, dass der Betroffene aus seiner Opferrolle herauskommt. Manche Beschäftigte würden von einer Gratifikationskrise in einen Burnout schlittern – da geht es dann eher um persönliche Kränkungen am Arbeitsplatz, denn um Überlastung. Immer wieder sind davon auch Menschen im öffentlichen Dienst betroffen, die scheinbar doch sichere und geachtete Arbeitsbedingungen haben, allerdings trotzdem leiden können, wenn sie z. B. bei der Beförderung mehrfach nicht bedacht wurden.
"Von der Kränkung zur Krankheit ist es oft nur ein kurzer Weg."
Prof. Reinhart Schüppel
Wichtig ist es für den Betroffenen zu erkennen: An der Arbeitswelt und an den Bedingungen an seinem Arbeitsplatz kann der er oder sie oft nur bedingt etwas verändern. Es ist deshalb ein wichtiger Schritt in der Therapie, wenn der Betroffene erkennt, was er selbst verändern kann – indem er beispielsweise an seinem Zeitmanagement arbeitet, am eigenen Leistungsanspruch oder lernt, sich abzugrenzen, Aufgaben zu delegieren oder "Nein" zu sagen. Unterstützend können auch Entspannungstechniken helfen oder die Reflexion darüber, was das richtige Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben ist. Es geht also auch darum, einen Blick für die Realität zu entwickeln.
Helfen kann dabei eine Gruppentherapie. Ein anderer Betroffener, der die Symptome und die Arbeitswelt kennt, kann den Blick für die eigenen Unzulänglichkeiten ganz anders öffnen und ansprechen, als es ein Therapeut tun könnte.
Medikamente werden in der Regel bei einem Burnout-Syndrom nicht gegeben.
Eine Arbeitswelt, die nicht krankmacht
Von einer Arbeitswelt, in der sich die Beschäftigten wohl fühlen und in der sie nicht krank werden, träumt wahrscheinlich jeder. In der Realität sieht es oft anders aus. Und trotzdem gibt es ein paar Grundbedingungen, die zur Stressreduktion am Arbeitsplatz führen und damit Burnout-Syndromen vorbeugen können:
- ein angenehmes Betriebsklima
- regelmäßiges Feedback an die Mitarbeiter
- erreichbare Ziele
- konkrete Ziele
- Freiraum und Selbstbestimmung
- die richtige Balance zwischen Herausforderungen und machbaren Aufgaben (auch ein sogenannter Bore-out, also die Unterforderung im Beruf, kann ähnliche Folgen wie die Überforderung haben)
Gesunde Arbeitsbedingungen hingen lange von äußeren Bedingungen wie Lärmschutz oder genügend Frischluftzufuhr ab. Heute geht es eher um innere, also psychosoziale Belange. Wie in jeder Beziehung geht es dabei um ein ausgeglichenes Geben und Nehmen sowie um die wichtige Frage: Wird denn das, was ich für meine Firma leiste, auch tatsächlich gesehen und erhalte ich die angemessene materielle und ideelle Anerkennung dafür?