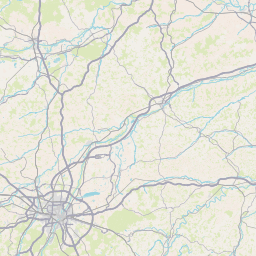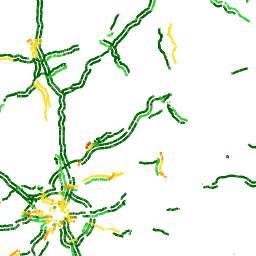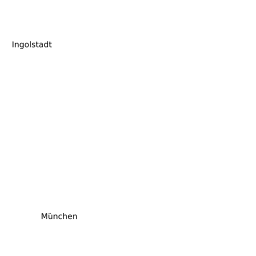Zwischen Zittern und Starre Die Parkinson-Krankheit
Maskenhaftes Gesicht, schleppender Gang, unkontrolliertes Zittern - daran erkennt man Patienten, die an der Parkinson-Krankheit leiden. Wie kann man sie behandeln?
Stand: 03.04.2024 |Bildnachweis

Experte
Die Parkinson-Krankheit ist eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Dabei gehen u.a. im Mittelhirn Nervenzellen zugrunde, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Da Dopamin aber für den reibungslosen Ablauf der Muskelbewegungen sorgt, führt ein Mangel zu den für Parkinson-Patienten typischen Beschwerden, dem Zittern, der Muskelsteifheit und der Bewegungsverlangsamung.
Veranstaltungshinweise
Am Freitag, den 11.04.2025 und am Samstag, den 12.04.2025 veranstaltet das LMU-Klinikum zwei Patiententage mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Informationen dazu entnehmen Sie bitte diesem Link.
Die Krankheit schreitet schleichend immer weiter fort. Parkinson ist bislang nicht heilbar, doch mit Hilfe verschiedener Medikamente können Parkinson-Patienten über viele Jahre gut behandelt werden. Außerdem raten Ärzte zu Physio-, Ergo- und Logopädie.
Chronisch degenerative Erkrankung
Bereits 1817 hat der Londoner Chirurg und Paläontologe James Parkinson die „Schüttellähmung“ in einem wissenschaftlichen Aufsatz beschrieben. Nach ihm wurde die Krankheit benannt.
"Parkinson ist eine schleichende, chronische Erkrankung, bei der Nervenzellen kumulativ geschädigt werden, das heißt Schädigungen anhäufen). Zwar sterben schon im normalen Alterungsprozess bei Gesunden einige diese Zellen ab, fällt die Zellzahl aber unter 50 Prozent, dann beginnen die ersten motorischen Symptome der Parkinson Krankheit offensichtlich zu werden."
Neurologe Prof. Günter Höglinger, LMU Klinikum
Das typische Erkrankungsalter für Parkinson liegt bei rund 60 Jahren, Männer sind genauso betroffen wie Frauen. Zwar gibt es auch jüngere Parkinson-Patienten im Alter von 40 Jahren, doch generell gilt: Je älter man wird, desto größer wird das Risiko. In der Altersgruppe der über-60jährigen ist ca. ein Prozent betroffen.
Da die Gesellschaft immer älter wird, nehmen die absoluten Zahlen der Parkinson-Patienten zu. Hinzu kommt, dass Mediziner die Krankheit heute gut diagnostizieren können und in einem früheren Stadium als vor 20 oder 30 Jahren erkennen. Vor allem in den hochentwickelten Ländern der Welt nimmt die Zahl von Parkinson-Patienten mehr und mehr zu.
Bei einer positiven Familienanamnese (Analyse von Krankheitsfällen im Stammbaum eines Patienten) kann man oft erkennen, ob Parkinson vererbt wurde oder nicht. Aber auch ohne familiäre Häufung kann eine genetisch bedingte Form einer Parkinson-Krankheit vorliegen, z.B. bei Patienten mit einem auffällig frühen Erkrankungsalter (z.B. unter 40). Liegt ein Verdacht vor, stellen Wissenschaftler mit Hilfe moderner gendiagnostischer Verfahren fest, ob eines der mittlerweile eindeutig identifizierten Parkinson-Gene mutiertVeränderungen trägt ist, die die Erkrankung hervorrufen können. Ist das der Fall, kann im Einzelfall das Risiko, Parkinson weiter zu vererben bei bis zu 50 Prozent liegen. Bei Patienten ohne weitere Krankheitsfälle in der Familie bzw. einem Krankheitsbeginn nach dem 40. Lebensjahr ist auch das Weitervererbungs-Risiko in der Regel gering.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass viele Parkinson-Patienten vor Krankheitsbeginn mit Pestiziden zu tun hatten. Dabei handelt es sich z.B. um Personen, die in der Landwirtschaft arbeiten, wie beispielweise Bauern, oder um auch Menschen, die auf dem Land leben. Auch in Experimenten konnte bestätigt werden, dass bestimmte Pestizide Parkinson hervorrufen können. Dementsprechend wird nun die Entwicklung einer Parkinson-Krankheit bei langjähriger Anwendung von Pestiziden auch in Deutschland als Berufserkrankung eingeordnet. Weitere Risikofaktoren für die Parkinson-Krankheit sind traumatische Hirnschädigungen bei Kontaktsportarten. Schläge auf den Kopf sollten daher vermieden werden (z.B. beim Boxen, Kopfball beim Fussball, Köpfer vom Zehn-Meter-Brett).
Heute ist bekannt, dass Personen, die rauchen und viel Koffein konsumieren, ein geringeres Risiko haben, Parkinson zu bekommen. Bisher weiß man nur, dass dieser Zusammenhang besteht, die Ursachen dafür sind jedoch noch nicht bekannt und werden in experimentellen Modellen und Studien untersucht. Ebenso reduziert häufige körperliche Aktivität im frühen und mittleren Lebensalter das spätere Parkinson-Risiko.
Die bekanntesten Anzeichen für Parkinson sind Zittern, Bewegungsverlangsamung und Muskelsteifheit, typischerweise auf einer Körperhälfte beginnend. Auslöser ist ein Mangel an Dopamin, dem Botenstoff, der für flüssige Bewegungsabläufe sorgt.
Zittern
Rund ein Drittel aller an Parkinson-Erkrankten zittert (anfangs nur auf einer Körperhälfte) vor allem dann, wenn der Arm oder das Bein in Ruhestellung ist. Bewegt man sich, dann lässt das Zittern kurzzeitig nach. In der Medizin bezeichnet man dies als Ruhe-Tremor.
Bewegungsverlangsamung
Zu den charakteristischen Parkinson-Symptomen zählt auch eine Verlangsamung der spontanen Bewegungen. Der Arzt bezeichnet dies als Bradykinese. Beispiele sind:
- Beim Gehen schwingt ein Arm nicht mehr richtig mit.
- Beim Reden wird kaum noch gestikuliert.
- Oft ist die spontane Gesichtsmotorik eingeschränkt: Die Mundwinkel bewegen sich z.B. beim Lachen kaum noch oder der Patient blinzelt selten. Das kann sich bis zur ausdruckslosen Gesichtsstarre entwickeln.
- Außerdem sprechen viele Parkinsonpatienten leise und monoton - das kann man durch gezielte Übungen und Hilfe von Logopäden verbessern.
- Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium verlangsamt sich das Gehen und Alltagstätigkeiten werden schwieriger.
Muskelsteifheit
Ungefähr zwei Drittel der Parkinson-Patienten leiden vor allem unter einer Bewegungsverlangsamung und Muskelsteifheit. Dies wirkt sich so aus, dass feinmotorische Beeinträchtigungen aller Art auftreten, z.B. das Hemd zuzuknöpfen, zu schreiben, sich zu rasieren, Klavier zu spielen oder Arbeiten im Haushalt zu verrichten. Der Arzt bezeichnet dies als Rigor.
"Manchmal ist es auch so, dass der Patient nur merkt, dass z.B. die Schultern schmerzen, weil die Muskeln sich dort versteifen. Deswegen geht er zuerst zum Orthopäden. Doch die Ursache der Schmerzen liegt nicht in den Gelenken oder im Knochen, sondern in den steifen Muskeln."
Prof. Günter Höglinger, LMU Klinikum
Doch schon lange bevor solche motorischen Probleme auftreten, beobachten Mediziner andere typische Anzeichen, sogenannte prä-motorische Zeichen:
Nachlassender Geruchssinn
Fast alle Patienten können schlechter riechen als früher. Vielen fällt das aber selber gar nicht auf. Außerdem kann nachlassender Geruchssinn auch durch andere Ursachen, etwa einen Unfall oder jahrelanges Rauchen. Im Rückblick stellt man jedoch fest, dass schon mehrere Jahre vor den motorischen Einschränkungen bei den meisten Parkinson Patienten der Geruchssinn betroffen war.
Stimmungsverschlechterung und Parkinson
Ebenfalls berichten viele Parkinson Patienten in der Frühphase von einer Stimmungsverschlechterung. Meistens, aber nicht immer handelt es sich dabei nicht um eine ausgeprägte Depression, eher um eine melancholische Grundstimmung. Das ist keine Reaktion auf die mit der Parkinson-Krankheit einhergehende motorische Einschränkung, sondern geht den Bewegungsproblemen meist schon voraus. Ursache dafür sind auch hier die durch Parkinson gestörten Neurotransmitter (Botenstoffe) im Gehirn.
Schlafstörungen können frühes Parkinson-Symptom sein
Das dritte wichtige nicht-motorische Symptom, das bei Parkinson schon früh auftritt, sind Schlafstörungen. Dabei leiden die Patienten aber in der Regel nicht unter Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, sondern
- sie bewegen sich in der Traumschlafphase (REM-Schlafphase) unbewusst heftig hin und her,
- leben ihre Träume aktiv aus und
- bemerken es selbst nicht einmal; ihre Angehörigen aber sehr wohl.
Oft dauert es nach den ersten Symptomen ein Jahr oder noch länger, bis ein Patient die Diagnose Parkinson bekommt, da die Erkrankung schleichend beginnt und oft mit allgemeinem „Altern“ verwechselt wird. Doch Parkinson sollte so früh wie möglich diagnostiziert werden, weil man die Beschwerden lindern kann. Meist merken die Patienten selber, dass etwas nicht stimmt. Für erfahrene Neurologen sind die körperlichen Symptome recht sichere Hinweise auf Parkinson. Zum Ausschluss anderer Erkrankungen werden oft noch Blutuntersuchungen und eine Kernspintomografie des Hirns durchgeführt.
Parkinsonpatienten leiden an Dopaminmangel, der sich entweder verhindern oder ausgleichen lässt. Deswegen gibt es verschiedene Medikamente.
Die meisten Parkinson-Medikamente sorgen prinzipiell für einen Ausgleich des reduzierten Dopaminspiegels im Gehirn, allerdings mit Hilfe verschiedener Wirkungsmechanismen.
Levodopa
Eine Vorstufe des körpereigenen Dopamins heißt Levodopa. Der Wirkstoff wird direkt vom Gehirn aufgenommen, dort zu Dopamin umgewandelt und bei Bedarf freigesetzt. Levodopa kann als Tablette eingenommen werden.
Dopamin-Agonisten
Dabei handelt es sich um Wirkstoffe, die ähnlich wie Dopamin wirken und vom Körper auch als solches erkannt werden.
"Wie ein Zweitschlüssel, der dasselbe Schloss aufsperrt, aktivieren diese Substanzen die gleichen Rezeptoren im Gehirn wie das Dopamin und wirken dadurch sehr ähnlich."
Neurologe Prof. Günter Höglinger
Dopaminabbau-Hemmer
Diese Gruppe von Medikamenten hält den Dopaminspiegel aufrecht, indem sie den Abbau von Dopamin im Körper hemmen. Man nennt sie MAO-B-Hemmer oder COMT-Hemmer. Meist kombiniert man diese Medikamente mit Levodopa.
Nebenwirkungen
Manchmal müssen Patienten eine Weile ausprobieren, welche Medikamente ihnen am besten helfen und was die wenigsten Nebenwirkungen hervorruft. Auftreten können:
- Müdigkeit,
- Übelkeit oder
- Blutdrucksenkung.
Darreichungsformen
Die meisten Wirkstoffe können als Tablette verabreicht werden. Manche wirken kurz und müssen mehrmals täglich genommen werden. Andere wirken länger und es reicht eine einzige Einnahme am Tag. Auch Pflaster gibt es, bei denen der Köper den Wirkstoff gleichmäßig durch die Haut aufnimmt. Und manche Parkinson-Patienten sprechen vor allem im fortgeschrittenen Stadium eher auf gleichmäßige Darreichung per Pumpe an.
Im Notfall
Für "Notfälle", z.B. Bewegungslosigkeit in der Fußgängerzone, benutzen manche Patienten eine schnell-lösliche Tablette, eine kurzwirksame Spritze unter die Haut, ein inhaliertes Levodopa-Spray, oder einen Film unter die Zunge. Welche Lösung im Einzelfall in Frage kommt, sollten Patienten vorab mit einem Neurologen besprechen.
Vor allem in der Frühphase der Parkinson-Krankheit sind die Medikamente sehr effizient: In den ersten ca. zehn Jahren wirken sie in der Regel sehr gut. Doch weil alle Medikamente nur die Symptome lindern und nicht das Problem beseitigen, schreitet die Krankheit trotz allem fort. Durch körperliche und geistige Aktivität, regelmäßige Physiotherapie und Anpassung der Medikation können die Patienten selbst mitwirken, das Fortschreiten der Symptome unter Kontrolle zu behalten.
"Im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf kommt es dazu, dass die Medikamente nicht mehr im ganzen Tagesverlauf ausreichend gut wirken. Es treten Wirkungsschwankungen auf. Man spricht dann von 'On- und Off-Phasen' mit guter bzw. schlechter Beweglichkeit. Außerdem kommt es im weit fortgeschrittenen Krankheitsstadium oft auch zu nicht-motorischen Problemen, wie Tagesmüdigkeit, nachlassender geistiger Leistungsfähigkeit, Depression oder Halluzinationen."
Prof. Günter Höglinger, LMU Klinikum
Pumpe oder Operation – das sind Therapiemöglichkeiten für Parkinson-Patienten, bei denen die Tabletten nicht genügen. Gut informierte Patienten können auch selbst während der Off-Phasen eine kleine Extradosis einnehmen.
Wenn bei einem Patienten die Medikamente nicht mehr ausreichend wirken, dann beginnen Neurologen eine Pumpen-Therapie oder chirurgische Alternativen zu erwägen.
Wenn bei einem Patienten die Medikamente nicht mehr ausreichend wirken, dann beginnen Neurologen eine Pumpen-Therapie oder chirurgische Alternativen zu erwägen.
Subkutane Pumpen
Mit Hilfe einer kleinen Pumpe und einer sehr feinen Nadel gelangt der Wirkstoff Apomorphin oder Foslevodopa gleichmäßig unter die Haut am Bauch. Der Wirkstoff geht auf diese Weise direkt ins Blut. Der Patient trägt die etwa 7 mal 5 cm große Pumpe an einem Gürtel oder Halsband mit sich herum. Bei Bedarf kann er selbst nachsteuern, um Wirkungsschwankungen zu vermeiden. Eine Operation ist nicht nötig.
Vorteil für den Patienten
Er kann die Nadel selbst anlegen und wieder herausziehen.
Pumpe per Magensonde
Auch die Vorläufersubstanz von Dopamin, die der Körper selbst in Dopamin umbaut, kann durch Infusion in den Körper gebracht werden. Dazu ist allerdings ein kleiner Eingriff notwendig: Im Rahmen einer Magenspiegelung wird durch die Bauchdecke ein kleiner Schnitt gemacht und dann eine künstliche Sonde in den Magen-Darm-Trakt geschoben, die im Dünndarm verbleibt.
"Mit dem kleinen Zugang durch Bauchwand kann man vergleichsweise gut leben, es bedarf aber einer etwas intensiveren Pflege. Auch hier trägt der Patient die Pumpe immer mit sich herum, die er unter der Kleidung verbergen kann."
Neurologe Prof. Günter Höglinger
Tiefe Hirnstimulation ("Hirnschrittmacher")
Reichen Medikamente nicht mehr, dann ziehen Ärzte einen neurochirurgischen Eingriff im Gehirn in Erwägung: Zwei Sonden werden im Gehirn implantiert, und zwar in Gebieten, die relativ tief im Gehirn liegen. Die Sonden geben ca. 130 Stromimpulse pro Sekunde ab und können dadurch die fehlerhaften Kreisläufe im Parkinson-Gehirn wieder optimieren.
Es gibt verschiedene Areale im Gehirn, die man beim Parkinson stimulieren kann. Die meisten Erfahrungen hat man mit dem sogenannten subtalamischen Kern.
"Mittlerweile stehen auch sogenannte adaptive Systeme zur Verfügung, die bedarfsgerecht stimulieren, wenn die Bewegungsstörungen im Tagesverlauf schwanken."
Neurologe Prof. Höglinger
Hirnschrittmacher im Alltag
Wie bei einem Herzschrittmacher, tragen Patienten mit einem Hirnschrittmacher ein kleines Kästchen unter der Haut unter dem Schlüsselbein. Das sorgt dafür, dass ständig hochfrequente Spannung an den Sonden im Gehirn anliegt. Die Struktur des Gehirns verändert sich dabei nicht, aber der Strom durchbricht wie eine Art Störsender das fehlerhafte Programm.
Wichtig: Für wen der Schrittmacher geeignet ist
Patienten über 70 Jahren wird in der Regel von diesem Eingriff abgeraten. Bei jüngeren Patienten ist die Chance deutlich besser, dass nach der Operation die Medikamente (und damit deren Nebenwirkungen) reduziert werden können und sich die Symptomatik verbessert.
Erfolge des Hirnschrittmachers
Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2013 hat Patienten untersucht, die bereits im frühen Krankheitszustand eine Tiefe Hirnstimulation erhalten haben. Das erfreuliche Ergebnis: Die Beweglichkeit und Lebensqualität der Betroffenen war deutlich besser als bei alleiniger Therapie mit Tabletten.
Die Initiative und Mitarbeit des Patienten ist in der Parkinson-Therapie wichtig. Patienten sollten ihren behandelnden Neurologen mindestens einmal im Jahr über ihren Gesundheitszustand informieren. Aber wenn die Medikamente nicht mehr ausreichend wirken oder Nebenwirkungen auftreten, sollten sie bereits früher den Arzt aufsuchen. Außerdem können Patienten mit Parkinson beispielsweise durch körperliche Aktivitäten wie Nordic Walking, Tanzen oder intensive Physio-, Ergo- und Logopädie den Verlauf ihrer Krankheit selbst positiv beeinflussen. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen, z.B. in einer Selbsthilfegruppe kann sehr hilfreich sein.
Über Morbus Parkinson wird nach wie vor intensiv geforscht. Das Ziel ist, die Parkinson-Krankheit möglichst früh zu erkennen, idealerweise bevor motorische Probleme auftreten, und in diesem Zustand zu heilen. Davon ist man aber aktuell noch weit entfernt. Hier eine kleine Auswahl an Arbeiten die derzeit durchgeführt werden.
Früherkennung: Schlüssel zur Entwicklung von vorbeugenden Parkinson-Therapien
Vom Beginn der Erkrankung im Körper bis zum Auftreten der ersten klinischen Symptome bei Parkinson oder anderen Bewegungsstörungen vergehen in der Regel Jahre oder gar Jahrzehnte. Dieses Zeitfenster bietet die Möglichkeit, die Krankheit zu erkennen, bevor sie die PatientInnen beeinträchtigt. Um diese Erkrankten ohne Symptome zu identifizieren, stehen der Wissenschaft inzwischen Riechtests, Schlafuntersuchungen, Hautbiopsie-Tests, Nervenwasser-Untersuchungen und die Gendiagnostik zur Verfügung. Kürzlich ist es gelungen, die Verklumpung des Eiweißes alpha-Synuclein, welches im Gehirn die Nervenzellen schädigt, zu diagnostischen Zwecken auch im Nervenwasser und in der Haut nachzuweisen. Damit steht die Wissenschaft nun an der Schwelle zur objektiven und besonders frühen Diagnosestellung der Parkinson Krankheit. Für diese Parkinson-Risikopersonen sucht die Wissenschaft derzeit nach Möglichkeiten, durch frühzeitige Intervention den Ausbruch der klinischen Symptome zu verhindern.
Intelligente Sensorsysteme
An vielen Zentren werden derzeit Sensorsysteme erprobt, das auch die kleinsten Veränderungen am Gangbild erkennt Merkmale wie z.B. Schritthöhe und -länge aufzeichnen. Das Gangbild kann Medizinern einen frühen Hinweis auf Parkinson liefern.
"Parkinson-Impfung"
Mittlerweile weiß man, dass das Eiweiß alpha-Synuclein bei der Parkinson-Krankheit verklumpt und sich im Gehirn der Patienten ausbreitet. Dies führt zu einer Fehlfunktion und zu einem Verlust von Nervenzellen, gefolgt von den typischen Parkinson Syndromen. In experimentellen Parkinson-Modellen konnte man zeigen, dass eine wiederholte Impfung mit Antikörpern gegen alpha-Synuclein diesen Mechanismus unterbrechen kann. An Parkinson-Patienten hat man mittlerweile auch zeigen können, dass diese Antikörper bei Menschen das alpha-Synuclein Eiweiß im Blut abfangen können. Im Rahmen einer internationalen großen Studie wurden auch erste Hinweise erzielt, die nahelegen, dass diese ‚Parkinson-Impfung‘ den Verlauf der Erkrankung reduzieren könnte. Diese Ergebnisse werden nun im Rahmen einer größeren internationalen Studie überprüft werden.
Zahlreiche neue Therapieansätze auf molekularer Ebene
Auf dem Gebiet der Therapieentwicklung ist die Forschung für PatientInnen mit Parkinson in Deutschland sehr aktiv. Z.B. gibt es Ansätze mit der neuartigen Antisense-Oligonukleotid-Therapie. Diese Substanzgruppe unterdrückt die Produktion fehlgefalteter Eiweiße auf der Basis defekter Gene („Gene-Silencing“). Das Verfahren wird nun bereits auch in Deutschland in klinischen Studien bei Parkinson-Syndromen eingesetzt. Ein anderes Beispiel für neuartige molekulare Therapiestrategien sind Untersuchungen mit Substanzen, die die Verklumpungen des alpha-Synucleins wieder auflösen sollen.
Warnung vor Heilsversprechen
Seit einigen Jahren gibt es Ansätze, Parkinsonpatienten mit Hilfe von Stammzellentransplantation zu therapieren. Unter wissenschaftlichen Rahmenbedingungen gab es einigermaßen erfolgreiche Tierversuche, doch bei Menschen waren die Ergebnisse nicht befriedigend, so dass dieser Ansatz nach wie vor kein Standardverfahren in der Parkinson-Therapie ist.
"Eine Stammzellentransplantation birgt Risiken und keinen sicheren Therapieerfolg. Wenn Patienten ein solches Verfahren angeboten wird, insbesondere wenn sie auch noch dafür bezahlen sollen, sollten sie sich dringend in einer neurologischen Spezialambulanz einer Universitätsklinik oder einer Parkinson-Spezialklinik beraten lassen."
Neurologe Prof. Höglinger
Die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) fördert die Erforschung der Parkinson-Krankheit und verbessert die Versorgung der PatientInnen. Organisiert sind in der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft Parkinson-ÄrztInnen sowie GrundlagenforscherInnen. Die Zusammenarbeit dieser beiden Zweige ist entscheidend für die Fortschritte in Diagnostik und Therapie.
Parkinson-Agenda 2030
Unter dem Titel der Parkinson-Agenda 2030 widmet sich die DPG verstärkt den beschriebenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen.
Es soll eine Sensibilisierung und Aktivierung der Gesellschaft für die Belange der PatientInnen mit Parkinson erreicht werden. Weiterhin unterstützt die DPG mit ihren Arbeitsgruppen die Erforschung der Ursachen, der Früh- und Differentialdiagnostik und neuer Therapiemöglichkeiten. Ein nationales Register für Parkinson und andere Bewegungsstörungen soll etabliert werden. Insbesondere soll auch mit Nachdruck die nationale Forschungslandschaft für die klinische Prüfung neuer Therapieansätze mit Patienten optimiert werden. Als wichtigen Baustein hierfür hat die DPG die Parkinson Stiftung initiiert.
Die Parkinson Stiftung setzt darauf, über die Krankheit umfassend zu informieren und die weitere Erforschung möglicher Therapieformen voranzutreiben. Die Stiftung wurde 2019 von der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. gegründet. Ihr Sitz ist in Berlin.
Mit den Mitteln des Stiftungsfonds NERVEN BEWAHREN möchte die LMU die Erforschung wegweisender Therapien in der Neurologie beschleunigen.
Das PARKLINK-Netzwerk bietet Menschen mit Parkinson-Syndromen eine individuelle und hochwertige Betreuung, indem globale Fortschritte in der Parkinson-Therapie heimatnah verfügbar gemacht werden.