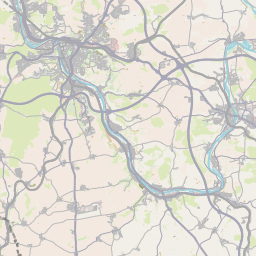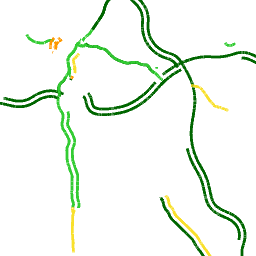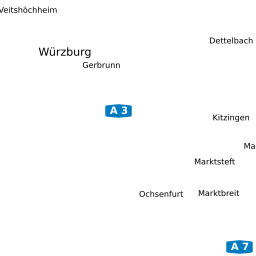"Wir, die Überlebenden" Erinnerungen von Tash Aw an die Brutalität des Kapitalismus
Es geht um Geld. Die Männer geraten Streit, am Ende ist einer der beiden, ein Wanderarbeiter aus Bangladesch, tot – erschlagen. Der Roman des aus Malaysia stammenden und heute in Frankreich lebenden Schriftstellers Tash Aw, erzählt von einer schrecklichen Eskalation. Zugleich beleuchtet er die Hintergründe dieses Verbrechens: den brutalen Kapitalismus im Südosten Asiens und eine Gesellschaft voller Gewalt.
Niels Beintker: Was hat Sie bewogen von Ah Hock und seiner Geschichte zu erzählen?
Tash Aw: Ich wollte von den Menschen erzählen, die ich kenne. Ah Hock verkörpert die meisten der Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin. Zum Beispiel viele meiner Cousins. Ich bin in diesen Kreisen groß geworden, auf dem Land. Und ich war einer der wenigen Glücklichen, die dann in die Metropole gezogen sind. Wir haben einen unvorstellbaren Wandel erlebt. In meiner Kindheit war Malaysia ein sehr armes Land. Denken wir heute an Malaysia, dann denken wir etwa an eine Mittelklasse. Das Land ist kein Industrieland im klassischen Sinn. Aber es gibt Wolkenkratzer, Infrastruktur und eine funktionierende Wirtschaft. Und das alles vollzog sich in gerade 25 Jahren.
Der Preis dafür ist enorm. Von außen ist das nicht zu erkennen. Ebenso wenig im Inneren. Der Wandel hat sich mit einer solchen Geschwindigkeit vollzogen, dass man ihn manchmal gar nicht bemerkt – auch wenn man mitten in ihm lebt. Den Menschen aus meiner Generation wurde beständig eingetrichtert: „Stellt keine Fragen! Kopf runter, hart arbeiten – und alles wird besser.“ In vielen Fällen hat das auch funktioniert. Jetzt aber sind wir an einem Punkt, an dem die Menschen begreifen: Egal, wie hart sie auch arbeiten, es wird sich nichts mehr ändern. Sie bleiben Fischer, Fabrikarbeiter oder Reinigungskräfte. Und auch ihren Kindern wird es nicht anders ergehen. Die Vorstellung sozialer Mobilität, mit der ich aufgewachsen bin, existiert nicht mehr. Nur die Reichen haben Einfluss. Und ihr Reichtum vermehrt sich immer mehr. Es ist der gleiche Prozess wie in Europa. Nur vollzog er sich eben in einer so viel kürzeren Zeitspanne.
Davon wollte ich erzählen. Von der Geschwindigkeit dieses Wandels. Und von seinen Opfern – die sich wiederum nicht als Opfer sehen. Sie denken, sie müssen nur hart arbeiten, wie jeder andere auch.
Wir erfahren im Roman von der tiefgreifenden Veränderung Malaysias – in der Region um Kuala Lumpur. Wir lesen von den Menschen, die Farmen für Meerestiere errichten – weil sie damit Geld verdienen wollen. Gleichzeitig erzählen Sie von den Fabriken, die die Umwelt verschmutzen, die Flüsse und das Meer – in ihnen werden die Konsum-Güter für den Westen hergestellt. Es geht um die Kehrseite des Kapitalismus. Warum ist es Ihnen wichtig, daran zu erinnern?
Für mich ist das zentral. Wir alle – im Westen wie auch in Asien – lieben es so sehr, an die große Illusion vom Wohlstand zu glauben. Wir sind auf gewisse Weise besessen von der Vorstellung eines glitzernden Asiens: Binnen kürzester Zeit sind Entwicklungsländer zu hochmodernen Staaten geworden. Und ich wollte die Realität zeigen: Für 95 Prozent der Menschen trifft das nicht zu.
Die Kosten dieser Entwicklung sind offensichtlich: die Natur wird zerstört. Ebenso gründen die asiatischen Wirtschaften darauf, umgehend den Konsumbedarf westlicher Kunden zu befriedigen. Die Meerestierfarmen, die Plastik-Produktion – alles dient den Verbrauchern in der westlichen Welt. Die wenigsten sehen diese Zusammenhänge. Und wer sie erkennt, glaubt, das stimme nicht. Wer im Westen sieht, wie es ist, kann sein Leben nicht mehr genießen. Vieles, was hier konsumiert wird, ist mit Schuld beladen: Nahrungsmittel, ebenso Textilien. Kleidung und Schuhe werden in Fabriken hergestellt, die die Flüsse und Meere verschmutzen.
Und auch die Menschen in Asien wollen das nicht wahrhaben. Denn wenn wir sagen, dass stimmt, müssen wir eingestehen, dass wir so viel geopfert haben. Aber für was? Das gilt auch mit Blick auf politische Fragen. Die Menschen haben auf so viele politische Rechte verzichtet – das Recht zu protestieren, das Recht frei zu wählen, das Recht auf gleichberechtigte Lebensumstände. Man hat ihnen erzählt: „Ihr könnt nicht beides haben – Geld und soziale Gleichheit. Das geht nur eines nach dem anderen.“ Fragt man arme Menschen, was ihnen wichtiger ist, dann wählen sie die materiellen Annehmlichkeiten: einen sicheren Job, die Aussicht auf Geld und auch auf Weiterbildung. Aber in einer langen Perspektive brauchen sie auch die Möglichkeit, eine Wahl zu haben, politisch und persönlich.
Ah Hock, die Hauptfigur im Roman „Wir, die Überlebenden“, hat einen Menschen erschlagen. Wir begegnen ihm lange nach der Tat und nach seiner Haftstrafe. Er schaut auf sein Leben zurück. Und er erzählt seine Geschichte Su-Min, einer Soziologin aus New York – in langen Monologen. Er hat chinesische Wurzeln. Inwiefern hat die damit verbundene Erfahrung – als ein Fremder betrachtet zu werden – seine Lebensgeschichte beeinflusst?
Beide – Ah Hock und die Soziologin Su-Min – haben, wie ich auch, einen chinesischen Hintergrund. Ihre Familien leben seit langem in Malaysia. Und beide sind auf ihre Weise Außenseiter. Auch wenn sie wissen: das ist unser Land, hier gehören wir hin. Gleichzeitig unterscheiden sie sich. Sie haben nicht die gleiche soziale Position. Su-Min hat mehr Geld und einen Hochschulabschluss. Sie ist dadurch vor all der Härte geschützt. Ah Hock leider nicht. Er ist ein Fremder, ein Ausgestoßener im eigenen Land. Ich wollte zeigen, wie es Menschen wie ihm geht: Er kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Er muss kämpfen, auch für die einfachsten Dinge im Leben – eine Arbeit, ein Dach über dem Kopf. Er hat kein Gespür für Zugehörigkeit. Wer für die grundlegenden Dinge sorgen muss, kann sich nicht um so etwas kümmern.
Wann immer er sich umblickt, erfährt er, wie die Gesellschaft versucht, ihn auszuschließen. Das Gefühl der Exklusion wird immer stärker als das der Zugehörigkeit. Weil Ah Hock in seinem Leben so viel Benachteiligung erfahren musste, lässt er das schließlich an dem Wanderarbeiter aus Bangladesch aus. Dieser ist auch ein Fremder, ein Migrant. Ah Hock handelt in der einzigen Form, die er kennt – und die er selber immer wieder erfahren hat. Gewalt bedingt Gewalt. Es ist das einzige, was Ah Hock in den Sinn kommt – als er auf jemanden trifft, der noch auf einer niedrigeren sozialen Stufe als er selbst steht.
Gewalt spielt im Roman eine große Rolle. Warum ist das so?
Gewalt ist allgegenwärtig in Asien: Physische Gewalt, soziale Gewalt, Klassen-Gewalt, rassistische Gewalt. Das ist das genaue Gegenteil von den Vorstellungen, die viele haben, wenn sie an Südost-Asien denken – eine freundliche Welt mit vielen Tourismus-Gebieten. Die Menschen in Südost-Asien wünschen sich, dass alle die, die von nicht von dort kommen, so denken. Sie – wir möchten nicht, dass Menschen im Ausland sagen, wir seien Opfer kapitalistischer und wirtschaftlicher Gewalt. Aber das sind wir. Das sind die Bedingungen, unter denen die meisten Menschen dort leben. Ich wollte die Ursprünge dieser Gewalt erkunden. Die Menschen werden nicht gewalttägig, weil sie das wollen. Ich glaube nicht, dass jemand morgens aufsteht und sagt: Ich will jemanden töten. Die Menschen handeln so, weil die Gesellschaft um sie herum ihnen mit Gewalt begegnet. Sie sind unfähig, anders zu reagieren.
Ah Hock erzählt Su-Min – und damit uns – seine Geschichte, drei Monate lang, von Oktober bis Januar. Er berichtet von seinen Erfahrungen, ebenso von Keong – neben Su-Min wäre das die dritte wichtige Figur im Roman. Und wir werden mit seinen Monologen zugleich konfrontiert mit der Kehrseite unseres Reichtums und unserer Freiheit im Westen: intensiv, langsam, manchmal ganz leise, manchmal schreiend, laut. Was vermag die Literatur mit Blick auf unsere Gegenwart und diese vielen großen Konflikte. Worin liegt ihre Macht?
Ich komme aus Asien und lebe in Europa. Die Kraft der Literatur besteht aus meiner Sicht darin, dass sie uns dazu bringt, uns mit Menschenleben auseinanderzusetzen, von denen wir sonst nichts wissen würden. Die Literatur beschäftigt uns, in dem Sinn, dass es ungemütlich wird, dass wir Dinge akzeptieren müssen, die nicht angenehm sind. In vielen Fällen ist es vorhersehbar, warum wir uns mit Literatur beschäftigen. Die meisten Menschen lesen von Schicksalen, die im Grunde ihre eigenen sind. Und das auf eine Weise, bei der wir uns wohlfühlen. Der größte Teil der Literatur ist eine Selbstreflexion von Angehörigen der Mittelklassen. Wir wollen uns gut fühlen. Und die Literatur scheint das zu ermöglichen.
Ich habe ein anderes Verständnis. Die Schriftsteller, die ich schätze, haben uns in die Lage gebracht, dass es unangenehm wird. Sie haben uns mit Dingen konfrontiert, die wir ablehnen. Wenn Menschen in Europa über Asien nachdenken, wollen sie ermutigt werden – sie wollen tröstliche Visionen lesen, sich erfreuen an der Güte, an der Exotik und an der Schönheit Asiens. Manchmal wollen sie auch von der Armut erfahren – aber auf eine Weise, die nicht wehtut. Ich will die Realität zeigen. Nicht nur für die Menschen im Westen, sondern ebenso für die in Asien. Sie sollen in die Lage kommen, über ihr Leben nachzudenken. Und die Menschen in Europa, die nur wenig über Asien wissen, sollen erkennen: unsere Welten sind miteinander verflochten. Wenn die Europäische Union Palmöl verbietet, verlieren Millionen Menschen in Asien ihre Arbeit. Wenn die EU sagt: Wir brauchen eine weitere Milliarde Gesichts-Masken, dann werden ein paar skrupellose Fabrikbesitzer in Asien sehr reich. Wie sollen wir in dieser Welt leben, wenn wir ignorieren, wie wir miteinander verbunden sind? Das müssen wir begreifen. Und das ermöglicht die Macht der Literatur.
Tash Aw wurde als Kind malaysischer Eltern 1971 in Taiwan geboren und wuchs in Kuala Lumpur auf. Er studierte Jura in Großbritannien, veröffentlichte mehrere Romane und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Commonwealth Writers’ Prize und dem Whitbread First Novel Award, und zweimal für den Man Booker Prize nominiert. Sein Werk ist in 23 Sprachen übersetzt. Tash Aw lebt vorwiegend in der Provence und kommentiert u. a. für die »New York Times« und die BBC Kultur und Politik im südostasiatischen Raum.
Tash Aw, Wir, die Überlebenden. Aus dem Englischen von Pociao und Roberto de Hollanda, Luchterhand, 416 S. € 24,-
Die Buchbesprechung lief am 10. Juli 2022 in der Sendung Diwan – Das Büchermagazin auf Bayern 2. Den Podcast zur Sendung können Sie hier abonnieren.