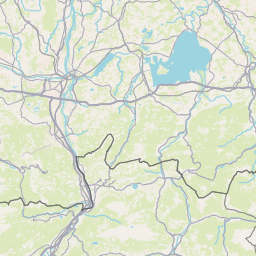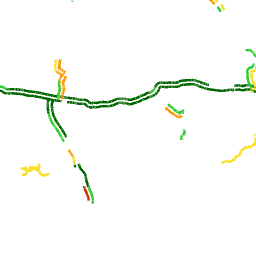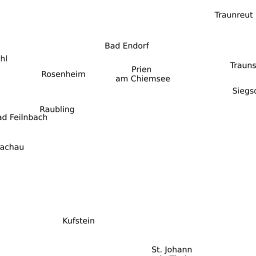Herbert Kapfer Nachruf auf Thomas Harlan
Ein Zeitungsbild, das sich einprägt, im Gedächtnis haften bleibt: der Sohn, Thomas Harlan, am Sterbebett seines Vaters, Veit Harlan, Filmemacher, der während der Nazizeit die Filme „Jud Süß“, „Immensee“ und „Kolberg“ drehte.
Die Harlans waren Teil der NS-Prominenz, standen mit der Familie des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels in freundschaftlicher Verbindung. Als eine selige Zeit, erinnert Thomas Harlan seine Kindheit in Berlin. Im Alter von acht Jahren wird er zu einem Besuch bei Adolf Hitler mitgenommen. Er erinnert sich an Ruderboote am Wannsee und seine erste eigene HJ-Marine-Uniform. Über Goebbels sagt er, er habe ihn „heiß geliebt“. Goebbels nahm eines Nachts den kleinen „Tommy“ mit und ließ für ihn das Kaufhaus Wertheim öffnen. „Es ist unvergesslich für einen Jungen, wenn jemand die schlafende Stadt weckt und sagt: Passt mal auf, der Thomas darf sich jetzt seine Eisenbahn aussuchen. Da waren die Eltern nichts dagegen.“
Sein Vater, Veit Harlan, sei ein Mann mit humanistischer Grundhaltung gewesen, den er oft strahlend und glücklich erlebt habe. Während der Dreharbeiten zu „Jud Süß“ habe der Vater ihm eine freundliche Postkarte geschickt, auf der stand, wie gerne die jüdischen Schauspieler mit ihm arbeiten würden. Veit Harlan habe zwar gemerkt, dass man etwas Perfides – Propaganda und Durchhaltefilme – von ihm wollte; dennoch wollte er den Film „Jud Süß“ so gut wie möglich machen. Doch der Geist, der am Ende hinter „Jud Süß“ stand, sei nicht der Geist seines Vaters gewesen.
Sein Vater habe ein Leben lang zu ihm gesprochen, nie mit ihm, sagt Thomas Harlan. Erst am Sterbebett war es zum ersten Mal eine ganze Woche lang möglich, mit dem Vater zu sprechen. Wenn er den Vater etwas fragte, habe dieser bisweilen mit einer Antwort gezögert und der Sohn meint in diesen Tagen des endgültigen Abschieds erkannt zu haben, wie Veit Harlan zu zweifeln begann am Selbstbild und am eigenen Werk. Großes Kino, nein Wirklichkeit: Veit Harlan stirbt in den Armen seines Sohnes Thomas, der seinen Vater und damit seine Herkunft zeitlebens ablehnte.
Jetzt, am 16. Oktober, ist Thomas Harlan in einem Lungensanatorium bei Berchtesgaden verstorben. Im Alter von 81 Jahren. Sein Leben war eine einzige Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater. Ein Leben, das nicht in wenigen Minuten nacherzählt werden kann. Wie der junge Harlan Deutschland 1948 verlässt, nach Frankreich auswandert, in den frühen fünfziger Jahren mit Klaus Kinski nach Israel reist, Gedichte schreibt, die Sowjetunion besucht und mit der Uraufführung seines ersten Theaterstücks „Ich selbst und kein Engel – Chronik aus dem Warschauer Ghetto“ einen Skandal auslöst. Wie er in den 1960 er Jahren in Polen lebend, mit Recherchen über die Vernichtungslager Kulmhof und Treblinka beginnt und wenig später als selbst ernannter „internationaler deutscher Revolutionär“ u.a. Chile und Bolivien bereist und filmisch die Nelkenrevolution in Portugal dokumentiert. Von 1978 bis 1984 arbeitet er an dem Film „Wundkanal“ und engagiert dafür den wegen gemeinschaftlichen Mordes an mindestens 6.800 Menschen zu lebenslangem Zuchthaus verurteilten SS-Obersturmbannführer Alfred Filbert für die Rolle des Täters. Dreharbeiten als Strafaktion: Der Mörder muss sich selbst spielen. Harlan konfrontiert ihn mit Kindern der Opfer- und Tätergeneration und lässt sich selbst dabei filmen. Der amerikanische Regisseur Robert Kramer dokumentierte mit dem Film „Notre Nazi“ Harlans Dreharbeiten. Die Uraufführung der beiden Filme 1984 in Venedig und bei der Berlinale 1985 führt zu heftigen Reaktionen und erneutem Skandal. Diese fiktionale und gleichzeitig dokumentarische Doppel-Performance, die historische NS-Verbrechen mit dem so genannten Deutschen Herbst in Verbindung bringt, sorgt für Verwirrung und Empörung. Die Wiederbesichtigung dieser beiden, auf DVD veröffentlichten Filme heute bestätigt, wie schonungslos Harlan mit dem Täter und sich selbst umging.
Und dann kommen einem selbst vielleicht Erinnerungen an die eigene Familie, die eigenen Angehörigen, das Nachttischfoto auf einer Kommode der Kindheit, das einen Ehemann, einen Vermissten, in SS-Uniform zeigt oder die markigen Worte eines Onkels, den bei Waldspaziergängen die Kriegsfantasien überkommen („und drüben der Iwan und wir immer reingefetzt mit dem MG“), und man fühlt sich vielleicht plötzlich selbst so, als wäre man Teil jenes filmischen Sozialexperiments „Notre Nazi“ und „Wundkanal“, eines Sozialexperiments, das bitte wer steuert? Wer ist verantwortlich? Wir alle, immer. Und immer gibt es – allen Behauptungen zum Trotz – eine Alternative, vielleicht auch nur die, sich zu verweigern und in einer Extremsituation, „Nein“ sagen zu können. In diesen Filmen hat der Filmemacher die Macht über den Täter und wird damit selbst zum Täter. Und man kann sehen wie aus berechtigter Anklage ein Verhalten entsteht, für das ich keinen anderen Begriff wüsste als den der tendenziellen Inhumanität. Ein Verhalten, das aus der intensiven Auseinandersetzung mit maßloser Unmenschlichkeit herrührt.
Thomas Harlan hat ein Leben lang versucht die Schuld seines Vaters abzuarbeiten und ist damit immer wieder gescheitert, als politischer Radikaler, als Filmemacher, als Autor, weil eine solche vom Sohn gefühlte, empfundene Schuld nicht abgearbeitet, dem Vater nicht abgenommen und aus der Welt geschafft werden kann. Es ist ein Scheitern an der Geschichte und gleichzeitig große Kunst. Erstaunlich ist, dass diesem in seiner Radikalität nur schwer zu übertreffenden filmischen Werk im letzten Lebensjahrzehnt Thomas Harlans ein ebensolches literarisches, erzählendes Werk noch folgen konnte. Im Jahr 2000, als der Autor 71 Jahre alt ist, erscheint sein erster Roman „Rosa“. Ein sprachgewaltiges, dichtes, verrätseltes und deshalb verwirrendes Werk, das seine Leser stark fordert, viele überfordert.
In diesem Jahr und mit diesem Werk beginnt auch die Zusammenarbeit mit der Redaktion Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks, die mit Hörspielen nach dem Roman „Heldenfriedhof“ fortgeschrieben wird. Der zeitliche Rahmen des Romans „Rosa“ und der beiden Hörspiele „Rosa – Die Akte Rosa Peham“ und „Die Reise nach Kulmhof“ erstreckt sich von 1942 bis 1993 und spielt mit verschiedenen Erzählebenen. Dokumente, Briefe, Berichte und Verhörprotokolle geben im Stakkato ungeheuerliche Geschehnisse preis. In den frühen sechziger Jahren stieß Thomas Harlan bei Recherchen über Kriegsverbrechen in Polen auf Gerüchte über das Dorf Kulmhof, an dem die Deutschen die Technologie des Massenmords mehrmals erprobten. Dreihunderttausend Menschen sind dort ermordet worden. „Rosa“ ist das Gegenteil einer Bilanz und alles andere als ein Fazit, der Text ist ein sprachlich-gedankliches Ringen mit einem grauenerregenden Stoff, mit einer Landschaft des Verbrechens: An diesem Ort, in Kulmhof wurden in den Jahren 1941 und 1942 Leichen vergaster Juden in Massengräbern im Wald verscharrt. Als sich die Gräber hoben und zu stinken begannen, grub ein Kommando die Leichen wieder aus, verbrannte sie und zermörserte die Knochen zu Mehl.
„Es gibt eine schreckliche Abnutzung der Beschreibungen von Katastrophen in der deutschen Sprache“, sagt Thomas Harlan. „Man mag die entsprechenden Begriffe nicht mehr hören, weil sie alles nur zukleistern: Wörter wie Holocaust, Auschwitz und selbst Jude. Deshalb kommt es darauf an, in eine Art Nullsituation zurückzukehren, von der aus man die überkommenen Sprachformen wegkehrt – und versucht, neu sprechen zu lernen.“ Diese Arbeit, neu sprechen zu lernen, hat Thomas Harlan bis zum Schluss nicht aufgegeben. Bis zuletzt arbeitete er an einem Buch mit dem Titel „Veit“, es wird gleichzeitig auch Harlans letztes Hörspiel werden, das der Bayerische Rundfunk produzieren wird. Ein Text, den er nicht mehr schreiben konnte, sondern diktieren musste und der direkte Zwiesprache mit dem Vater hält: „deswegen schreibe ich Dir, weil Dich niemand zu Deinem Verbrechen gezwungen hat, weil Du das, was Du getan hast, aus freiem Willen getan hast, weil es niemand war, der es getan hat, weil Du Dein Verbrechen gerne begangen hast.“ Und weiter: „Vater, ich bin bereit, Deine Schuld auf mich zu nehmen. Vergiss nicht, dass ich bis heute nicht wusste, dass ich bereit war, dass ich in Deiner Schuld war, dass Du sie einfordern kannst, dass ich sie begleiche, auch wenn Du nichts forderst, vergiss nicht, dass ich Dein Sohn sein will, dass es mir weh tut, zu sehen wie Du Dich quälst, vergiss nicht, quäle Dich nicht.