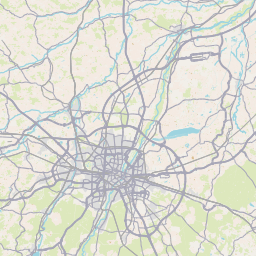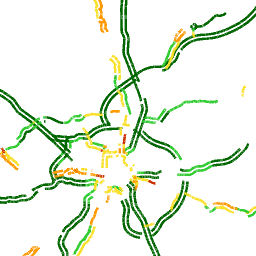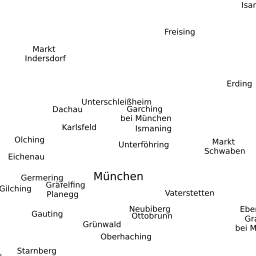4. Januar 1961 Grimmsches Wörterbuch endlich vollständig
Gut, dass es für das Projekt keinen realistischen Zeitplan gab. Im Jahr 1838 legten die Brüder Grimm los, um ein Deutsches Wörterbuch zu erstellen, das den gesamten Wortschatz des Neuhochdeutschen erfassen sollte, samt Etymologien und Belegen. Am 4. Januar 1961 erschien der letzte Band.
04. Januar
Dienstag, 04. Januar 2011
Autor: Armin Strohmeyr
Sprecher: Johannes Hitzelberger
Redaktion: Thomas Morawetz / Wissenschaft und Bildung
Sie hatten sich verschätzt: Als 1838 der Verleger Salomon Hirzel mit den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm einen Vertrag über die Erarbeitung eines deutschen Wörterbuchs schloss, ahnte keiner, dass bis zur Fertigstellung mehr als einhundertzwanzig Jahre vergehen würden. Am 4. Januar 1961 erschien der zweiunddreißigste und letzte Band des "Deutschen" oder "Grimmschen" Wörterbuchs mit insgesamt rund dreihundertzwanzigtausend Stichwörtern. Ein Projekt von nationaler Bedeutung, nicht nur, weil darin der gesamte deutsche Wortschatz seit der Erfindung des Buchdrucks wissenschaftlich beschrieben wird, sondern weil sich darin auch die nationale Geschichte vom Vormärz bis in die Zeit der deutschen Teilung spiegelt.
Es war nicht das erste Wörterbuch der deutschen Sprache. Doch hielten die Wörterbücher etwa von Adelung, Wolke und Campe nicht den philologischen Erfordernissen der nach 1800 entstandenen Germanistik stand. Diese versuchten zu reglementieren, indem sie umgangssprachliche oder sittlich "anstößige" Wörter eliminierten. Das Deutsche Wörterbuch hingegen sollte nicht nur den gesamten Wortschatz des Neuhochdeutschen erfassen, sondern auch Wortbedeutung, Gebrauch und Etymologie erklären und Belege aus Dichtung und diversen Fachdisziplinen anführen. Es ist damit ein historisches und wissenschaftliches Wörterbuch, das Sprache nicht als etwas Museales versteht, sondern als etwas Lebendiges, das einer ständigen Wandlung unterliegt.
Die bereits von Alter und Krankheit gezeichneten Grimms lebten in Berlin in einer gemeinsamen Wohnung, Tür an Tür lagen die Arbeitszimmer. Wilhelm bearbeitete den Buchstaben D, Jacob die Buchstaben A bis C, E und F. Wilhelm starb 1859, Jacob 1863. Das Deutsche Wörterbuch drohte ein Torso zu bleiben.
Doch in jener Zeit besann man sich auf die deutsche Sprache als nationales Erbe, und so machte sich Otto von Bismarck für die Fortführung und eine staatliche Finanzierung stark. Von da an leistete ein Stab von Wissenschaftlern unter Leitung der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Filialen in Göttingen und Berlin die gewaltige Arbeit. Das Deutsche Wörterbuch war mehrfach durch die historischen Zeitläufte gefährdet: In der Inflation von 1923 rettete eine Spende aus den USA das Projekt. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Archive in ein Bergwerk ausgelagert. Nach dem Krieg setzten die Forschungsstellen in Berlin-Ost und Göttingen ihre Arbeit parallel fort. Das Deutsche Wörterbuch war damit auch in der Zeit der deutschen Teilung eines der wenigen gemeinsamen nationalen Projekte.
Seit dem Abschluss des letzten Bandes werden die zum Teil fehlerhaften Erstlingsbände der Brüder Grimm neu bearbeitet. 2012 soll das Projekt endgültig auslaufen. Inzwischen ist das Grimmsche Wörterbuch nicht nur eine Anschaffung öffentlicher Bibliotheken. Eine wohlfeile Taschenbuchausgabe fand bei zahlreichen Bürgern begeisterten Absatz. Eine digitale Version auf CD-ROM mit praktischen Such- und Merkfunktionen kam 2004 auf den Markt.
Sprache verändert sich in unserer technologisch komplexen Zeit schneller denn je. Eine überfällige Neubearbeitung der Bände G bis Z wird es indes wohl nicht geben: Es fehlt an öffentlichen Geldern. Oder anders gesagt: Die deutsche Sprache besitzt in der Politik nicht mehr die Lobby von einst. Was Bismarck als nationale Aufgabe betrachtete, ist heutigen Politikern trotz der Klage über die deutsche Bildungsmisere nicht mehr einsichtig.