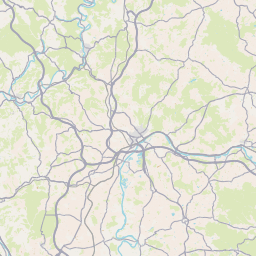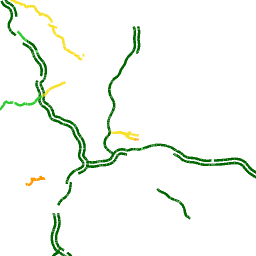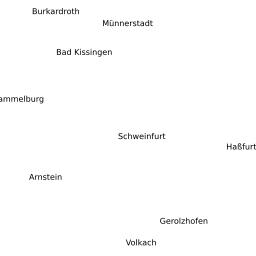Zum Sonntag Gesinnungsethik hilft in der Migrationskrise nicht
Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat diese Woche laut über eine Begrenzung der Zuwanderung nachgedacht und dafür laute Kritik geerntet. Hans-Joachim Vieweger teilt Gaucks Meinung. Es drohe die Gefahr der Überforderung der Gesellschaft hier.

Vor acht Jahren sagte Joachim Gauck als Bundespräsident zur damals aufkommenden Flüchtlingskrise: Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Nun hat der evangelische Christ Gauck noch einmal nachgelegt und angesichts der aktuellen Krise eine neue Entschlossenheit der Politik gefordert. Eine Strategie zur Begrenzung der Zuwanderung könne politisch geboten sein, sie sei womöglich auch nicht moralisch verwerflich.
Politiker und Kirchenvertreter sollten sich Gaucks Worte zu Herzen nehmen
Dass Gauck irgendwelchen Rechtsextremen nach dem Mund redet, darf man getrost ausschließen. Insofern sollten sich Politiker, aber auch Kirchenvertreter die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten zu Herzen nehmen. Viel zu lange wurde der Blick auf Flüchtlinge von Bischöfen und Synoden moralisch überhöht, viel zu sehr gesinnungsethisch argumentiert. Man könne doch als Christ Menschen nicht ertrinken lassen - basta, hieß es in der Debatte um den Nürnberger Pfarrer Matthias Dreher, der sich kritisch zur EKD-Seenotrettung geäußert hatte.
Helfer nicht überfordern
Dabei ist zu unterscheiden. Wer als Christ einem Hilfsbedürftigen begegnet, soll ihm, wie in der biblischen Geschichte von dem Mann, der unter die Räuber gefallen ist, helfen. Dazu gehört aber auch, die eigenen Fähigkeiten zu prüfen und sich nicht zu überfordern. In der Geschichte, die Jesus erzählt, bedeutet das, dass der Helfer, der sprichwörtlich gewordene barmherzige Samariter, den ausgeraubten und verletzten Mann erstversorgt und dann für seine weitere Behandlung zahlt.
Um wie viel mehr muss die Politik überschlagen, welche Möglichkeiten sie hat bzw. wo sie an Grenzen gerät. Das hatte Gauck schon 2015 betont, als er sagte: Man müsse die Gefahr der Überforderung benennen, um die politische Vernunft zu aktivieren, ohne das Mitgefühl auszusetzen.
Genau darum muss es jetzt gehen. Und das ist auch mit dem christlichen Glauben vereinbar. Denn die Bibel unterscheidet klar zwischen den Möglichkeiten des Einzelnen und der Verantwortung für ein Gemeinwesen. Und zu dieser Verantwortung gehört eben zu prüfen, welche Folgen politisches Handeln hat. Beispiel Seenotrettung. Auf den ersten Blick mag das eine Hilfe sein. Doch zugleich ist zu prüfen, ob durch die Seenotrettung nicht auch das Schlepperunwesen gefördert wird. Werden womöglich Menschen dadurch auf die lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer gelockt?
Ich will gar nicht behaupten, dass es hier eine eindeutige Antwort gibt, doch diese Frage ist - wie Gauck sagte - mit den Mitteln der politischen Vernunft zu klären und nicht gesinnungsethisch. Denn mit Gesinnungsethik kommen wir in der aktuellen Migrationskrise nicht weiter.
Ungebremste Zuwanderung hat fatale Folgen
Wer die ungebremste Zuwanderung zulässt, muss zumindest drei fatale Folgen zur Kenntnis nehmen. Erstens: Der eigentliche Sinn des Asylrechts, also der Schutz politisch Verfolgter, wird mehr und mehr ausgehöhlt. Zweitens: Die Kommunen sind längst an den Grenzen ihrer Belastung angekommen, die Integration der Zuwanderer, die bereits hier sind, wird durch diejenigen, die jeden Tag neu hinzukommen, erschwert. Und drittens wird durch die permanente Aufnahme von Migranten der Sog aus den Ländern des Südens immer größer. So etwas zu benennen, mag „unsympathisch“ klingen, gar „inhuman“, um noch mal Gaucks Worte aufzugreifen, doch es ist kein Gegensatz zum christlichen Glauben, der die politische Vernunft im Sinn der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre durchaus wertschätzt.
Marschies: EKD darf nicht zur NGO werden
Die Bibel gibt Orientierung, auch in der Politik, so hat es der Berliner Theologe Christoph Markschies, in diesen Tagen gesagt. Es wäre aber, so Markschies, ein Missverständnis, davon als Kirche unmittelbar Handlungsanweisungen für die Politik abzuleiten. In dieser Gefahr sieht der Theologe gerade die evangelische Kirche: sie dürfe nicht zu einer Nicht-Regierungs-Organisation werden, die primär mit politischen Zielen verbunden wird. Markschies bezog dies zwar vor allem auf die Klimadebatte und die Unterstützung der EKD für den globalen Klimastreik, seine Warnung kann meines Erachtens aber genauso auf die Migrationspolitik gemünzt werden.