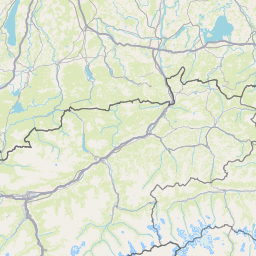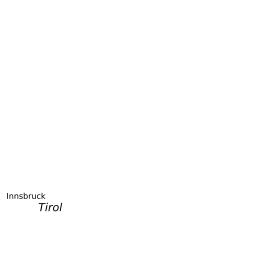Mit 1 von 5 bewerten
Mit 2 von 5 bewerten
Mit 3 von 5 bewerten
Mit 4 von 5 bewerten
Mit 5 von 5 bewerten
Durchschnittliche Bewertung: 4.875 von 5 bei 8 abgegebenen Stimmen.
Wenn die Sprache klemmt Stottern: Was passiert da? Was hilft?
In der Regel tritt es im Vorschulalter auf: Stottern. Bei manchen verschwindet es wieder, bei anderen nicht. Für viele, die stottern, ist es eine Belastung. Was hilft gegen Stottern? Wie kommt man damit zurecht? Was müssen Eltern beachten?
Von: Klaus Schneider
Stand: 15.11.2021 |Bildnachweis

Etwa ein Prozent der Bevölkerung hierzulande ist vom Stottern betroffen. Bei einem Großteil der Betroffenen beginnt es bereits im Alter zwischen zwei und vier Jahren. Bei den meisten Kindern, die stottern, geht es von alleine wieder weg (= Remission), weshalb man in den ersten Wochen mit einer Behandlung durchaus warten kann. Es gibt jedoch Gründe (z.B. Kind oder Angehörige leiden unter der Situation), rechtzeitig mit einer Therapie zu beginnen oder sich im Zweifel beraten zu lassen.
Experte:
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Mit beginnendem Schulalter schließt sich das Zeitfenster der Remission. Je früher man also dem Stottern gegensteuert, desto größer ist die Chance, stotterfrei zu werden. Und auch bei älteren Kindern und Erwachsenen gilt: Eine frühe Intervention ist wichtig, um Begleiterscheinungen zu verhindern.
Dem Text liegt ein Interview mit Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut an der Ludwig-Maximilians-Universität München, zugrunde.
Man weiß inzwischen sehr genau, was beim Stottern passiert. Man muss zwischen einem Kernsymptom und Begleitsymptomen unterscheiden.
Beispiel: Jemand will sagen: "Ich sitze am Tisch." Dieser Satz ist in der Satzplanung bereits fertig und abrufbereit. Was beim Stottern nun folgt, ist eine Übertragungslücke, eine Art Übertragungsfehler. Beim Menschen, der stottert, funktioniert die Übertragung nicht so, wie beim Nicht-Stotternden. Dadurch erleidet er einen Kontrollverlust bei einem bestimmten Wort.
Das Kernsymptom kann sich in unserem Beispiel über drei Möglichkeiten äußern:
Blockierung: Zwischen zwei Wörtern entsteht eine lange Pause: "Ich sitze am (lange Pause) Tisch."
Dehnung: Hängenbleiben an einem Laut: "Ich sssssssssssssssssssitze am Tisch."
Wiederholung: "Ich sitze am T-t-t-t-t-t-isch."
Problemhürde Silben-Nukleus
Viele – auch Betroffene – glauben oft, beim Stottern würde man am Wortanfang hängenbleiben, im Beispiel also beim "T" von Tisch. Interessant ist jedoch, dass sich bei genauer Betrachtung herausstellt, dass das so nicht stimmt. Stotternde bleiben immer am Silben-Nukleus hängen. Oder anders gesagt: am Übergang vom Konsonanten zum Vokal. Ausnahme: Beginnt ein Wort direkt mit einem Vokal (z.B. Apfel), kann man gleich am Wortanfang hängenbleiben.
Begleitsymptome: Sprechängste, Rückzugsverhalten
Menschen, die stottern, sind nicht krank. Aber man könnte gewissermaßen von einer Behinderung sprechen. Allerdings erschrecken viele, wenn sie den Begriff "Behinderung" im Zusammenhang mit Stottern hören.
"Ich sage dann immer: Genauso, wie ich als Brillenträger auch behindert bin, nämlich seh-behindert. Man muss jedoch auch klar sehen: Stotternde Menschen können als Folgereaktion in ihrer Lebensqualität sehr stark beeinträchtigt sein – zum Beispiel durch Sprechängste oder Rückzugsverhalten."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Es gibt einige hirnorganische Auffälligkeiten, die man bei erwachsenen stotternden Patienten festgestellt hat. Bei Kindern weiß man allerdings aufgrund mangelnder Untersuchungsmöglichkeiten noch zu wenig.
Mithilfe von PET-Scans (Positronen-Emissions-Tomographie, ein bestimmtes bildgebendes Verfahren) hat man genau untersucht, was im Gehirn passiert, wenn jemand stottert. Hier traten mehrere Auffälligkeiten zutage.
Eine Auffälligkeit ist, dass zusätzlich zur linken Gehirnhälfte, die normalerweise für die Sprachsteuerung zuständig ist, bei Stotternden auch die rechte Gehirnhälfte aktiv ist. Hier stellt sich die Frage: Behindern sich die Hirnhälften gegenseitig und führen dadurch zum Stottern, oder kompensiert die rechte Hirnhälfte Mängel der linken? Anders gefragt: Ist die Aktivität der rechten Gehirnhälfte Grund für das Stottern oder eine Folge davon?
Man nimmt inzwischen letzteres an, also dass die rechtsseitige Aktivität eher Folge ist.
Eine weitere Auffälligkeit, die man festgestellt hat: Die weiße Substanz im Bereich des Motorcortex – also die Region im Gehirn, die für feinmotorische Prozesse und Artikulation zuständig ist – ist bei stotternden Erwachsenen weniger durchlässig. Die weiße Substanz ist für die schnelle Übertragung der Information an die Artikulationsorgane verantwortlich:
"Sie möchten einen Film streamen. Der Server (also das Gehirn) hat bereits alle Informationen auf seiner Festplatte liegen. Die Datenleitung (das entspricht der weißen Substanz) ist nicht durchlässig genug, der Film fängt an zu ruckeln. Das Problem liegt aber nicht am Server, sondern an der Leitung."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Man weiß außerdem, dass Stottern variabel ist. Wäre Stottern immer nur eine Frage der Übertragung, müsste der Defekt ständig reproduzierbar sein und immer wieder auftreten. Das tut er jedoch nicht. Viele Menschen, die stottern und auch Angehörige berichten, dass das Stottern in angespannten Situationen stärker ist.
Anders gesagt: Stottern hat keine psychische Ursache!
ABER: Wenn ein Kind erlebt, dass andere lachen; wenn es also abwertende Reaktionen erfährt, können sich tatsächlich Ängste und Schamgefühle aufbauen. Auf psychosozialer Ebene können dann tatsächlich weitere Symptome entstehen.
Warum also fangen manche Kinder an zu stottern, andere nicht? Gibt es so etwas wie ein Stotter-Gen oder liegt es am sozialen Umfeld, dass Kinder auffällig über Worte stolpern? Sind sie vielleicht traumatisiert?
Genetik
Tatsächlich gibt es eine genetische Disposition zum Stottern. Der Anteil liegt mit 70 Prozent sogar sehr hoch. Wenn nahe Angehörige – zum Beispiel die Eltern oder die Großeltern – stottern oder gestottert haben, ist das Risiko für ein Kind, ebenfalls zu stottern, durchaus erhöht.
Traumata als Auslöser?
Man hört immer wieder, dass das Stottern auftrete, wenn ein bestimmtes traumatisierendes Ereignis eintritt – sei es, dass ein Geschwister geboren wird oder dass das Kind beim Klettern vom Baum fällt oder in einen rostigen Nagel tritt, dann ins Krankenhaus muss und seitdem stottert.
Viele Ereignisse oder auch das soziale Umfeld lassen einen zunächst vermuten, dass ein Zusammenhang bestehe, zumal er auch zeitlich sehr klar zu beobachten ist.
Vorsicht, Trugschluss!
"Würden alle Kinder, die vom Apfelbaum stürzen, oder die beim Pokémon-Spielen gegen einen Laternenpfahl stoßen, zu stottern beginnen, würden sehr viel mehr Kinder stottern."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Die zeitlichen Zusammenhänge, die viele erkennen, muss man also hinterfragen: Kann es vielleicht Zufall sein? Kann es vielleicht am Lebensumfeld liegen? Eltern, die ein zweites Kind bekommen, tun dies häufig zwei bis drei Jahre nach dem ersten Kind. Das ist jedoch genau das Alter, in dem 75 bis 80 Prozent aller stotternden Kinder eben damit beginnen.
Auslöser "unglückliche Kindheit"?
"Ich kann mir vorstellen, dass es in jeder Familie zu Krisen oder zu Spannungen kommt, die Kinder miterleben, auch in jungen Jahren – daher ist meine Antwort eher, dass der vermutete Zusammenhang zu einem Ereignis oftmals verwendet wird, um eine Erklärung zu finden, die aber nicht in einem kausalen Zusammenhang steht."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Entwarnung: Eltern sind nicht schuld!
Im Umkehrschluss bedeutet das: Eltern müssen sich keine Vorwürfe machen, sie hätten etwas falsch gemacht, wenn ihr Kind stottert.
"Dieser Punkt ist mir besonders wichtig. Deshalb erkläre ich das immer in aller Ausführlichkeit in Beratungsgesprächen mit Eltern: Sie haben keine Schuld daran. Das finde ich einen wichtigen Satz. Ich habe schon zig-fach erlebt, dass Eltern in Tränen ausbrechen und sagen: 'Oh Gott, und ich mache mir seit Jahren Sorgen darüber.'"
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Allerdings weiß man durchaus, dass besonders belastende Situationen (Traumata) Stottern auslösen können. Ob es jedoch diesen auslösenden Moment gab oder ob das Stottern zufällig mit einem anderen biographischen Ereignis zusammenfällt, kann niemand im Nachhinein herausfinden.
Im Zeitraum zwischen zwei und vier Jahren fangen 75 bis 80 Prozent aller Kinder, die stottern, damit an. Es kann aber bis zum zwölften Lebensjahr passieren und eher selten bei älteren Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen. Bei den meisten dieser Kinder hört das Stottern im Vorschulalter auch von selbst wieder auf. Bei einem Fünftel jedoch nicht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind im Vorschulalter das Stottern wieder verliert, ist also relativ hoch. Doch sollte man sich darauf nicht verlassen und schon gar nicht einfach abwarten. Dennoch sprechen manche Ärzte noch immer vom "Entwicklungsstottern."
"Dieser Begriff ist jedoch falsch. Es gibt ihn nicht. Wer von 'Entwicklungsstottern' spricht, meint das Phänomen, dass 80 Prozent der stotternden Kinder im Vorschulalter das Stottern wieder verlieren, das Stottern gehöre also zur Entwicklung dazu. Dieser Satz ist jedoch fatal, denn er impliziert: Stottern ist ganz normal, da muss man nichts tun. Das hat oft dazu geführt, dass Eltern beruhigt wurden und zu lange gewartet haben und dadurch wichtige Therapieschritte gerade in jungen Jahren verpasst haben."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Wenn das Stottern erstmalig auftritt und das Kind keinen Leidensdruck hat, und/oder auch die Eltern keinen Leidensdruck haben, sollten Eltern nach drei Monaten zu einem Beratungsgespräch kommen. In jungen Jahren kann man getrost bis zu sechs Monate abwarten. Manche Studien sagen sogar, dass man bis zu zwölf Monate abwarten könne. Allerdings können sich in diesen zwölf Monaten bei stark stotternden Kindern Folgesymptome zeigen (innere Belastung, hoher Kraftaufwand beim Versuch, über die Sprechblockade zu kommen). In diesem Fall ist eine frühere Kontrolle angebracht.
Man kann Stottern im Vorschulalter heilen, nicht zuletzt aufgrund der hohen Remission. Man vermutet, dass eine frühzeitige Therapie die Remission noch verstärken kann.
Man weiß beispielsweise, dass die sogenannte Lidcombe-Therapie eine hohe Wirksamkeit hat. In diesem Sinne kann man von einer "Heilung" sprechen, denn das Stottern ist dann komplett weg und tritt auch nicht mehr auf.
Lidcombe
Ein sehr systematisches Therapieprogramm im Train-the-Trainer-Prinzip. Eltern werden angeleitet, wie sie mit dem Kind interagieren und spielen können, um flüssiges Sprechen zu erzielen. Dieses flüssige Sprechen soll dann systematisch gelobt werden. Ein verhaltenstherapeutischer Ansatz mit hohem Wirksamkeitsnachweis durch viele Studien.
PCI (Palin-Parent-Child-Interaction)
In diesem englischen indirekten Therapieprogramm für Kinder im Vorschulalter liegt der Schwerpunkt auf den Interaktionen zwischen Eltern und Kind. Ziel ist es, die Anforderungen an das Kind zu senken und die Fähigkeiten zu erhöhen.
Modifikationsansatz nach Van Riper
Hier wird direkt am Stottern gearbeitet, indem Sprechtechniken vermittelt werden, wie man beispielsweise das Stottern vereinfachen kann (man eliminiert also nicht das Stottern an sich, sondern erlernt Techniken, damit besser umzugehen). Ein weiteres Element dieses Ansatzes ist, die erworbenen Begleitsymptome sowie die psychosoziale Belastung abzubauen.
Fluency-Shaping-Methode
Hier wird die ganze Sprechweise so verändert, dass das Stottern nicht mehr auffällt (beispielsweise durch verlangsamtes, weiches und gebundenes Sprechen).
Methoden-kombinierte Ansätze
Hier werden Methoden aus Fluency-Shaping und Modifikation kombiniert.
Erfolge
Die Lidcombe-Methode hat einen guten Wirksamkeitsnachweis, allerdings liegt das auch an der guten Studienlage. Auch beim Fluency-Shaping gibt es Erfolgsnachweise.
Beim in Deutschland (und auch weltweit) am weitesten verbreiteten Ansatz, nämlich dem Modifikationsansatz nach Van Riper, liegen hohe Erfahrungwerte in der klinischen Praxis vor. Wichtig bei der Therapieentscheidung ist zudem, dass für den Einzelfall eine passende Therapieform gefunden wird.
Mit dem Schulalter bis hin zum beginnenden Jugendlichenalter schließt sich das Fenster der Heilung. Zwar gibt es einzelne Berichte, dass das Stottern auch im Erwachsenenalter weggegangen sei. Aber es handelt sich tatsächlich um wenige Einzelfälle. In der Regel hat sich das Stottern bei Erwachsenen bereits chronifiziert.
Hier muss man zwischen mehreren Arten von Stottern unterscheiden:
- originäres (früher: „ideopathisches“) Stottern: wird in der Kindheit erworben, trifft auf die meisten Menschen, die stottern, zu
- psychogenes Stottern: Aufgrund von psychischen Erkrankungen kann Stottern auch im Erwachsenenalter entstehen
- neurologisch bedingtes Stottern: Stottern im Erwachsenenalter aufgrund von neurologischen Erkrankungen
Was umgangssprachlich als Stottern bezeichnet wird, meint immer das originäre Stottern, das bereits im Kindesalter auftritt.
Das ist eine Frage, die sich auch viele Eltern stellen - gerade dann, wenn das Kind mit drei oder vier Jahren zu stottern beginnt. Manche Eltern sprechen es lieber nicht an, aus Angst, das könnte das Stottern vielleicht noch verstärken.
Georg Thum hält es für die beste Lösung, ein Tabu gar nicht erst aufkommen zu lassen. Man sollte immer versuchen, möglichst offen mit dem Thema umzugehen, möglichst ohne ein Drama daraus zu machen. Untersuchungen belegen, dass selbst sehr kleine Kinder mit zweieinhalb, drei Jahren ihr Stottern bemerken und wahrnehmen.
"Es gibt einen Mythos, der leider noch immer weit verbreitet wird, dass Kinder das in diesem Alter nicht wahrnehmen würden. Das stimmt nicht. Es gibt Untersuchungen, die genau das Gegenteil belegen."
Georg Thum, akademischer Sprachberater
Zu spüren, dass sie stottern, ist für die Kinder belastend.
"Ich erkläre den Eltern immer: Wenn Sie auf der Parkbank sitzen und Ihr Kind beim Spielen beobachten, das Kind stolpert, hat eine Schramme am Knie, fängt an zu weinen. Was machen Sie? Natürlich gehen Sie hin, sprechen das an, nehmen das Kind vielleicht in den Arm, pusten, trösten es, kleben vielleicht ein Pflaster drauf und ermutigen es dann, weiter zu spielen."
Georg Thum, akademischer Sprachberater
Eltern gehen in so einem Fall also auf das Problem ein, bieten eine Konfliktlösung an, spenden Trost und zeigen auch einen Weg auf, wie es weitergehen kann. Das alles ist wichtig für die Frustrationstoleranz, auch um das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken.
"Gleiches wäre beim Stottern wünschenswert. Wer das Stottern ignoriert, würde übertragen auf obiges Beispiel statt Trost zu spenden, nachdem das Kind gestürzt ist, weiter in die Zeitung schauen und versuchen, den Sturz zu ignorieren, aus Angst, das Kind könnte sich dann erst recht in den Sturz hineinsteigern."
Georg Thum, akademischer Sprachberater
Die richtige Vorgehensweise bei Kindern
"Genauso zu reagieren, wie bei einem Sturz: Das Stottern ansprechen. 'Ach Mensch, da bleiben die Wörter hängen, Du kriegst das Wort nicht raus.' Auch Erklärungsversuche können helfen: 'Das passiert manchmal, mir ist das auch schon mal passiert. Andere Kinder haben das auch.' Auch positive Worte können unterstützen: 'Ich finde es toll, wie viel Du mir erzählst.'"
Georg Thum, akademischer Sprachberater
Die richtige Vorgehensweise bei Erwachsenen
"So, wie man sich anderen gegenüber auch verhält. Hier kann man gar keinen speziellen Tipp abgeben."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Denn, um es mit Paul Watzlawick zu sagen: "Man kann nicht nicht kommunizieren." Wenn jemand das Stottern ignoriert oder so tut, als würde er es nicht merken, wird der Stotternde das auch bemerken. Manchmal ist auch zu hören, man solle Stotternde nicht anschauen. Das ist falsch. Denn das erschwert die Kommunikation zusätzlich und führt zu unnötigen Peinlichkeiten.
"Wenn ich mit jemandem spreche, der stottert, würde ich zunächst auf den Inhalt hören, würde genauso den Blickkontakt halten, würde abwarten, bis der Satz zu Ende ist, würde nicht unterbrechen, würde auch nicht den Satz vervollständigen, auch wenn eine Vermutung naheliegt, wie er weitergehen könnte. Das würde man auch bei nicht-stotternden Menschen als unhöflichen Akt empfinden."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
"Wenn ich mit jemandem spreche, der extrem starke Symptomatik zeigt, der – was selten vorkommt – bis zu 30 Sekunden oder länger an einem Block hängen bleibt, kann man nachfragen, ob es dem Stotternden helfe, wenn man selbst das Wort sagt. Manche werden sagen ja, manche werden sagen nein."
Georg Thum, akademischer Sprachtherapeut
Also offen ansprechen und beispielsweise sagen: "Das Stottern ist gerade sehr stark," und nachfragen: "Was würde Ihnen helfen?".
Betroffene, ob Eltern von stotternden Kindern oder auch stotternde Jugendliche oder Erwachsene, können sich Hilfe holen oder auch mit anderen austauschen. Hier finden Sie einige Anlaufstellen und Infoseiten:
Stotterberatungsstelle der LMU München
Telefon: 089/2180-5120
Telefonzeiten:
Montag: 9.00-17.00 Uhr
Dienstag: 9.00-16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00-13.00 Uhr
Donnerstag: 8.30-10.30 Uhr
Freitag: geschlossen
Mail: beratung-shp@edu.lmu.de
Homepage:
http://www.edu.lmu.de/shp/beratungsstelle/index.html
Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe e.V. (BVSS)
Bundesweites Netzwerk mit Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen
Telefon: 0221 – 139 1106
Mail: info@bvss.de
Homepage:
http://www.bvss.de
Spezielles Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene: Flow
In Deutschland bilden sich derzeit gerade sogenannte Flow-Gruppen. Das sind Selbsthilfegruppen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 29 Jahren.
Darüberhinaus bekommt man Beratungen auch bei Ärzten oder niedergelassenen Sprachtherapeuten, die sich mit Stottern auskennen.
AWMF-Leitlinie Redeflussstörungen
Hier finden Sie die Leitlinie zu Redeflussstörugen.