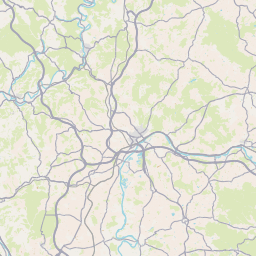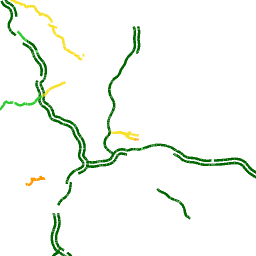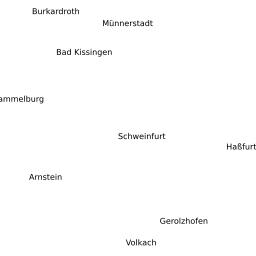Wieder frei Luft holen Was Atemphysiotherapie bewirken kann
Physiotherapeutische Atemtherapie ist ein wesentlicher Bestandteil der nichtmedikamentösen Behandlung von Erkrankungen der Atmungsorgane. Verschiedene manuelle Anwendungen, Atem- und Bewegungstechniken unterstützen Patientinnen und Patienten bei der Wiederherstellung ihrer bestmöglichen Atemfunktion.
Von: Susanne Dietrich
Stand: 19.04.2022 |Bildnachweis

Atemphysiotherapie kann durch den Hausarzt, Internisten oder Lungenfacharzt verordnet werden und wird von den Krankenkassen erstattet.
Expertin:
Sabine Weise, Atemphysiotherapeutin in München, langjährige Lehrkraft an der staatlichen Berufsfachschule für Physiotherapie an der LMU München, Mitinitiatorin und Dozentin der Fortbildungsreihe "Atemphysiotherapie" der AG Atemphysiotherapie im Zentralverband für Physiotherapie
Ambulant wird Atemphysiotherapie in Physiotherapiepraxen angewendet. Stationär kommt sie in Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken und Palliativstationen zum Einsatz, aber auch in Pflegeeinrichtungen und Hospizen.
Ein Therapieschwerpunkt liegt in der Vermittlung von Selbsthilfetechniken zur Verbesserung der Atmung. So sollen Betroffene auch im Alltag eine bestmögliche Kontrolle über die krankheitsbedingten Einschränkungen und damit vor allem Lebensqualität zurückerlangen.
Der Text beruht auf einem Gespräch mit Sabine Weise, Mitinitiatorin und Dozentin der Fortbildungsreihe "Atemphysiotherapie" im Zentralverband für Physiotherapie.
Um das Blut mit Sauerstoff zu versorgen, arbeiten zwei sehr unterschiedliche Organsysteme zusammen. Auf der einen Seite die Lunge als eine Art Chemiefabrik, in der die Sauerstoffaufbereitung des Blutes stattfindet – auf der anderen Seite die sogenannte Atempumpe, die mit der Atemmuskulatur Luft in die Atemwege pumpt. Beide Organsysteme sind gleichermaßen lebenswichtig. Störungen des einen Systems ziehen stets auch Störungen des anderen Systems nach sich.
"Zur Atempumpe zählen neben dem Zwerchfell und weiteren Atemmuskeln auch die Atemhilfsmuskulatur im Hals- und Schultergürtelbereich und die Ausatemmuskulatur in Bauch und Rücken. Die Skelettanteile Wirbelsäule, Rippen und Becken geben der Atempumpe Stabilität. Aber auch das Atemzentrum im Stammhirn und die peripheren Nerven, die die Muskeln innervieren, gehören zur Atempumpe. Das Atemzentrum steuert und reguliert nach unserem Bedarf Atemtiefe und Atemfrequenz. Bei verschiedenen funktionellen Problemen im Bereich der Atempumpe kann die Atemphysiotherapie Unterstützung bieten."
Sabine Weise
Die Atempumpe ventiliert täglich im Durchschnitt 20.000 bis 30.000 Liter Luft durch die Atemwege und ist für deren Reinigung über den Hustenmechanismus verantwortlich. Ein wesentlicher Teil der Atempumpe ist das Zwerchfell, eine Muskel-Sehnen-Platte, die Brust- und Bauchhöhle voneinander trennt.
"Die Muskelfasern des Zwerchfells sind ähnlich angeordnet wie die Speichen eines Schirms. Sie haben ihren Ursprung am unteren Rippenrand und an der Lendenwirbelsäule und setzen im Zentrum des Zwerchfells an einer Sehnenplatte an. Das Zwerchfell ist mit der Lunge gleitend verbunden. Wenn seine Muskelfasern sich kontrahieren, zieht sich das Zwerchfell nach unten in Richtung Bauchraum zusammen. Durch den Unterdruck zwischen Lungenfell und Zwerchfell wird die Lunge mit nach unten gezogen – bei Ruheatmung sind das ungefähr zwei bis drei Zentimeter, bei tiefer Atmung sind es zehn bis zwölf Zentimeter."
Sabine Weise
Bei der Ausatmung entspannen sich die Muskelfasern des Zwerchfells. Durch die elastischen Kräfte der Lunge wird das Zwerchfell wieder in seine Ausgangsposition tief in den Brustkorb gezogen.
"Ein entspanntes Zwerchfell ragt wie eine hohe Kuppel bis zur vierten Rippe in den Brustkorbraum. Bei Zwerchfellatmung werden die Bauchorgane nach vorne verdrängt. So können wir die Atembewegungen des Zwerchfells durch das Heben und Senken der Bauchdecke wahrnehmen."
Sabine Weise
Die Bewegung des Zwerchfells hat Auswirkungen auf viele Körperbereiche. Dabei entstehen nicht nur im Brustkorb, sondern auch im Bauchraum wechselnde Druckverhältnisse. Sog und Druck wirken sich zudem auf die Blutgefäße, Lymphbahnen und Bauchorgane aus. Außerdem zieht der Unterdruck über die Venen das Blut zurück ins Herz. Auch das vegetative Nervensystem und die Verdauungsorgane werden durch die Zwerchfellbewegungen stimuliert und angeregt.
Bei Menschen mit einer sogenannten obstruktiven Atemwegserkrankung kommt es vor allem bei der Ausatmung zu einer übermäßigen Verengung (Obstruktion) der Atemwege, sodass die Luft oft nur unvollständig ausgeatmet werden kann. Das ist beispielsweise bei Asthma bronchiale oder COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) der Fall.
Asthma bronchiale kann in der Regel medikamentös gut und erfolgreich behandelt werden. Allerdings gibt es manche Patientinnen und Patienten, bei denen Medikamente nicht wirkungsvoll helfen. Sie haben häufig eine gesunde Lunge, aber das Empfinden, nicht ausreichend Luft zu bekommen. Ursache ist oft ein verändertes Atemmuster, durch das Symptome wie Lufthunger, Atemnot und vegetative Beschwerden ausgelöst werden.
"Diesen Menschen mit einer sogenannten dysfunktionalen Atmung können wir in der Atemphysiotherapie wieder ein natürliches Atemmuster beibringen. Sie müssen beispielsweise lernen, wieder durch die Nase statt durch den Mund und mit dem Zwerchfell locker in den Bauch statt mit der Atemhilfsmuskulatur in den oberen Brustkorb zu atmen. Auch üben sie, ihre Ausatmung zu kontrollieren, um das Kohlendioxyd in ausreichender Höhe im arteriellen Blut zu halten und es nicht zu stark abzuatmen."
Sabine Weise
Unter COPD werden die Krankheitsbilder chronisch obstruktive Bronchitis und Lungenemphysem zusammengefasst. Als Ursache steht das Rauchen an erster Stelle. Ein zentrales Symptom der chronisch obstruktiven Bronchitis ist Husten mit Auswurf. Betroffene empfinden trotz beginnender Lungenschädigungen meist nur geringe körperliche Einschränkungen.
Das Lungenemphysem (Emphysem = Blase) entwickelt sich im späten Verlauf der Erkrankung. Infolge fortschreitender Entzündungsprozesse verlieren die kleinsten Atemwege und Lungenbläschen an Elastizität und Stabilität. Sie werden überdehnt und teilweise zerstört. Aus unzähligen feinst strukturierten "Lungenbläschentrauben" entwickeln sich große schlaffe Blasen, vergleichbar mit einem ausgeleierten Luftballon. Diese Veränderung des Lungengewebes wird als strukturelle oder absolute Überblähung bezeichnet. Sie ist irreversibel. Entzündungshemmende und bronchialerweiternde Medikamente können nur temporär Erleichterung bringen.
Verliert die Lunge ihre Elastizität, kann sie sich bei der Ausatmung nicht mehr verkleinern und deshalb das Zwerchfell nicht mehr zurück in seine Ausatmungsposition ziehen. Dies hat gravierende Folgen für die Atemmechanik.
"Bei diesen Patientinnen und Patienten verbleibt die Lunge während der Ausatmung weit gestellt in Einatemposition. Sie haben nach der Ausatmung nicht die bei gesunden Menschen üblichen durchschnittlich drei Liter Luftvolumen in der Lunge, sondern erheblich mehr. Bei manchen Patienten sind es mehr als sechs Liter. Ist die überblähte Lunge am Ende der Ausatmung noch mit derart viel Luftvolumen gefüllt, bleibt kaum Raum für eine erneute Einatmung."
Sabine Weise
Die irreversible strukturelle Überblähung des Lungengewebes kann zusätzlich durch eine sogenannte dynamische Überblähung verstärkt werden. Sie entsteht insbesondere bei körperlicher Belastung, wenn Betroffene bei der Ausatmung versuchen, die Luft mit ihrer Bauchmuskulatur aus den Atemwegen zu pressen. Der dabei entstehende Druck im Brustkorbinnenraum presst die instabilen Atemwege zusammen. Durch diese Obstruktion können sie sich nicht mehr voll entleeren. So bleiben große Mengen Restluft in den kollabierten Atemwegen gefangen. Diese zusätzliche dynamische Überblähung verstärkt die bestehende Atemnot. Auf diese dynamische Überblähung kann die Atemphysiotherapie Einfluss nehmen.
Eine zentrale atemphysiotherapeutische Technik gegen eine dynamische Lungenüberblähung ist die sogenannte PEP-Atmung. PEP steht für "positive expiratory pressure", was so viel bedeutet wie "positiver Ausatemdruck". Dabei wird gegen einen Widerstand ausgeatmet, was einen schnellen Druckabfall in den schlaffen Lungenstrukturen verhindert. So werden die "ausgeleierten" kleinen Atemwege durch eine Luftschienung stabilisiert, ein Kollaps wird abgewendet und Restluft kann entweichen.
Den PEP-Atemdruck kann man beispielsweise durch das Ausatmen gegen einen körpereigenen Widerstand wie eine eng und bündig um den Mund gehaltene Faust oder die leicht geschlossenen Lippen erzeugen.
"Die bekannteste PEP-Technik ist die sogenannte Lippenbremse. Dabei legt man die Lippen locker aufeinander und lässt die Luft langsam entgleiten. Man macht das dann richtig, wenn sich die Wangen leicht aufblähen."
Sabine Weise
Den PEP-Druck misst man in Zentimeter Wassersäule. Durch die Lippenbremse wird ein Druck von etwa drei bis fünf Zentimeter Wassersäule aufgebaut. Möchte man tiefere Lungenareale erreichen, wird jedoch ein höherer positiver Ausatemdruck von 15 bis 30 Zentimeter Wassersäule benötigt. Dafür könnte man beispielsweise einen etwas gekürzten und geknickten Strohhalm oder ein spezielles PEP-Gerät verwenden.
Gegen eine dynamisch überblähte Lunge hilft – kombiniert mit der PEP-Atmung – eine optimale Zwerchfellposition am Ende der Ausatmung. Das kann unter anderem durch einen Lagewechsel in Rück- oder Bauchlage erreicht werden. In Rückenlage lässt sich der Effekt zusätzlich durch eine Gewichtsauflage von drei bis sieben Kilogramm auf der Bauchdecke verstärken. Dafür kann man beispielsweise einen Sandsack (zum Beispiel Vogelsand) oder einen Gewichtsgürtel verwenden.
"Diese Selbsthilfetechnik sollte immer in Kombination mit einer PEP-Atmung erfolgen. So kann man sich im Alltag immer wieder zwischendurch für zehn bis zwanzig Minuten Momente der Entlastung schaffen. Gleichzeitig ist diese Technik ein Training für das Zwerchfell, das durch den Schub der Bauchorgane und des Gewichtes in seine natürliche Ausgangsstellung in Richtung Brustkorb geschoben wird. Von hier aus kann es sich wieder zusammenziehen und die Lunge weiten."
Sabine Weise
Wenn die Lunge sich nicht ausreichend ausdehnen kann, spricht man von restriktiven Lungenerkrankungen. Bei diesen Erkrankungen kann unter anderem das feine und hochelastische Lungengewebe selbst betroffen sein, das sogenannte interstitielle Lungenparenchym. In dieses elastische Gewebe sind die Atemwege, Lungenbläschen und das Lungenblutgefäßsystem eingebettet. Zu diesen interstitiellen Lungenerkrankungen zählen bestimmte Formen der Lungenentzündung (Pneumonie) und die Lungenfibrose, die über 200 verschiedene Ursachen und auch unterschiedliche Verlaufsformen haben kann.
Bei der Lungenfibrose führen Umwandlungsprozesse des Lungenparenchyms zur Versteifung der Lunge und zum fortschreitenden Funktionsverlust der Lungenbläschen. Durch die Versteifung und Schrumpfung des Lungengewebes kann die Lunge nur noch mit hohem Atemmuskelaufwand auseinandergezogen werden. Diese permanent hohe Atemarbeit verursacht eine chronische Atemnot mit Sauerstoffmangel und schränkt die Lebensqualität der Betroffenen stark ein. Heilbar ist Lungenfibrose nicht. Der Verlauf der Erkrankung lässt sich mit neuen Medikamenten verlangsamen.
Weiterhin schränken auch Erkrankungen der Atempumpe die Ausdehnung der Lunge ein. Dazu zählen beispielsweise neuromuskuläre Erkrankungen, bei denen die Lunge durch eine schwächer werdende Atemmuskulatur nicht mehr ausreichend belüftet werden kann. Darüber hinaus zählen Einschränkungen durch Skoliosen oder auch durch Schmerzen nach Unfällen und Rippenfrakturen sowie Brustkorb- und Bauchoperationen zu diesem Behandlungsfeld.
"Bei restriktiven Lungenerkrankungen muss die Atemarbeit erleichtert und die Brustkorbbeweglichkeit positiv beeinflusst werden. Außerdem sollten die Lungenareale, die durch lange Liegezeiten verschlossen sind – beispielsweise durch eine Lungenentzündung – wieder besser belüftet werden."
Sabine Weise
Besonders nach künstlicher Beatmung und nach Operationen sollten die minderbelüfteten Areale der kleinen Lungenbläschen oder Bronchiolen regelmäßig durch Atemvertiefung, Mobilisierung und Umlagerung geöffnet und mit Sauerstoff versorgt werden.
Bei vielen Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen (etwa bei Mukoviszidose, COPD oder Bronchiektasie) sammelt sich in den Atemwegen zäher Schleim, der zu wiederkehrenden Entzündungen bis hin zu Lungenentzündungen führen kann.
Um dieses häufig infizierte Sekret zu verflüssigen, sollten Betroffene täglich zu Hause, aber auch vor der Atemphysiotherapie-Behandlung eine Feuchtinhalation durchführen – zur Verflüssigung von zähem Schleim eignet sich beispielsweise eine drei- bis sechsprozentige Kochsalzlösung. Es gibt aber auch oszillierende PEP-Geräte, die neben der PEP-Wirkung durch einen Schwingungseffekt zu einer Sekret-Verflüssigung beitragen.
"Bei der täglichen Inhalation wenden Patientinnen und Patienten zusätzlich Selbsthilfetechniken an. Dazu zählt beispielsweise die sogenannte 'Autogene Drainage', die durch eine zunehmende Einatmungsvertiefung und eine Kombination aus entspannter und forcierter Ausatmung das Sekret mobilisiert und transportiert."
Sabine Weise
Während der Atemphysiotherapie können die betroffenen Atemwege dann durch eine Kombination aus manueller Anwendung und Atemtechnik gereinigt werden – etwa durch die sogenannte ROTA-KOM-PEP-Technik. ROTA-KOM-PEP steht für Rotation, Kompression und PEP-Atmung. Dabei werden die atmungssynchronen Weitenschwankungen – also das Zusammenziehen und Wieder-Ausdehnen – der Atemwege durch eine Brustwirbelsäulen-Rotation und eine Rippenkompressionstechnik unterstützt. Auf diese Weise wird das Sekret aus den kleinsten peripheren Atemwegen mobilisiert und in die zentralen Atemwege – also in Richtung große Bronchien und Luftröhre – transportiert, sodass es abgehustet werden kann.
"Die atemphysiotherapeutischen Techniken zur Sekret-Mobilisation sind wirkungsvoll und für die Patientinnen und Patienten sehr erleichternd. Nach einer Behandlung können sie häufig für einige Tage deutlich freier atmen. Wenn Betroffene regelmäßig auf diese Weise von Atemphysiotherapeuten unterstützt werden, kann es sein, dass sie über einen längeren Zeitraum kein Antibiotikum einnehmen müssen."
Sabine Weise
Wer durch die Nase ein- und ausatmet, unterstützt die sogenannte "Mukoziliäre Clearance", den effektiven Selbstreinigungsmechanismus der Schleimhaut der oberen Atemwege und der Bronchien, der auch Flimmerepithel genannt wird. Bei der Atmung durch den Mund kühlen die Bronchien aus und die wichtigen Schleimschichten trocknen aus. Das Selbstreinigungssystem wird ineffektiv und längerfristig geschädigt und kann seine Schutzfunktion für die Atemwege nicht ausführen. Deswegen ist die Nasenatmung essenziell, um die Atemwege gesund zu halten.
"Die Nase ist ein fantastisches Gerät. In diesen fünf Zentimetern befindet sich eine Luftaufbereitungsanlage, die die Luft auf Körpertemperatur erwärmt und fast zu hundert Prozent anfeuchtet, sodass in der Lunge eine wunderbar aufgewärmte und feuchte Luft ankommt, die zudem noch gereinigt ist. Denn einen Großteil von Schadstoffen, Schmutz- und Feinpartikeln fängt die Nase ab."
Sabine Weise
Ein gut funktionierendes Flimmerepithel hält nicht nur Schmutzpartikel fern, sondern schützt auch vor Viren und Bakterien. Nikotin, Teer, bestimmte Medikamente, Schadstoffe und Kälte wirken sich negativ auf das Flimmerepithel aus und vermindern seine Wirksamkeit. Ist das Bronchialsystem gesund, erfährt es alle 20 Minuten eine Komplettreinigung. Die Pflege der Nasenatemwege ist ein wichtiger Therapiebaustein in der Atemphysiotherapie.
Husten ist für viele Menschen mit Atemwegserkrankungen ein Kraftakt und häufig mit Einbußen der Lebensqualität verbunden. In der Atemphysiotherapie lernen Betroffene Selbsthilfetechniken, um den Hustenreiz zu unterdrücken beziehungsweise die Hustenbelastung zu reduzieren. Dazu zählen neben der PEP-Atmung und einer dosierten körperlichen Belastung unter anderem die Umstellung von der Mund- auf die Nasenatmung und das Einüben einer Sprechdisziplin mit genug Atem- und Sprechpausen.
"Den Hustenreiz kann man neben heißen Getränken und Bonbonlutschen auch durch Druck- und Flussunterschiede in den Atemwegen mindern, indem man zum Beispiel durch die leicht verengte Nase oder durch einen Fausttunnel ein- und ausatmet und dabei zwischendurch Speichel schluckt."
Sabine Weise
Leiden Betroffene an instabilen zentralen Atemwegen, kann die Technik des PEP-Hustens helfen, einen Kollaps der großen Atemwege zu vermeiden. Das Husten gegen einen Widerstand wie den Fausttunnel kann instabile Atemwege offenhalten. Zusätzlich sorgt eine Körperposition mit aufgerichteter Wirbelsäule und stabilem Bodenkontakt der Füße dafür, dass die Bauchmuskulatur während des Hustenprozesses effektiv arbeiten kann.
"Man kann den Hustenstoß aber auch aktiv unterstützen, indem man zum Beispiel das Brustbein während des Hustens nach unten zieht oder den Bauch in Richtung Zwerchfell drückt oder beides miteinander kombiniert."
Sabine Weise
Jede Bewegung der Brustwirbelsäule hat einen Effekt auf die Rippen und den gesamten Brustkorb und damit auf die Atempumpe. In der Atemphysiotherapie lernen Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen deswegen auch, Brustwirbelsäule und Brustkorb schonend zu mobilisieren.
"Dabei sind vor allem drei Bewegungsrichtungen hilfreich: Zum einen die Drehung der Brustwirbelsäule, während das Becken stabil bleibt. Das Zweite wäre die Seitneigung und die dritte Bewegungsrichtung wäre die Beugung und Streckung, also ein Rundwerden und Wiederaufrichten des Brustkorbs."
Sabine Weise
Um das Zwerchfell zu trainieren, kann man in Rückenlage ein Gewicht auf den Bauch legen und langsam und gleichmäßig gegen diesen Widerstand anatmen – eventuell in Kombination mit dem Tönen eines Vokals. Beispielsweise könnte man mit einem ruhigen, auf einem Ton gehaltenen A oder O ausatmen.
Aber auch ein Training der gesamten Skelettmuskulatur – insbesondere der vorderen Oberschenkel-, Waden- und Hüftstrecker-Muskulatur – ist für Menschen mit Atemwegserkrankungen wesentlich. Denn wenn diese Muskeln zu schwach sind, muss bei körperlicher Aktivität verstärkt geatmet werden. So bewegt man sich möglicherweise immer weniger und setzt eine Spirale der Inaktivität in Gang, die sich negativ auf den gesamten Gesundheitszustand auswirkt.
"Deswegen ist das tägliche Muskeltraining ein wichtiger Therapiebestandteil. Dabei sollte man vor allem die Muskulatur trainieren, die gegen die Schwerkraft arbeitet, zum Beispiel indem man sich vor einen Stuhl wie an eine Ballettstange stellt und leichte Kniebeugen macht oder auf die Zehenspitzen kommt und die Fersen anschließend wieder langsam zum Boden absenkt."
Sabine Weise
Menschen, die sich gestresst fühlen, atmen oft nicht in der sogenannten Atemruhe-Lage. Diese liegt dort, wo die elastischen Kräfte der Lunge und die elastischen Kräfte des Brustkorbs sich ausgleichen.
"Wenn ich entspannt ausatme, mache ich eine kleine Zwischenpause auf dieser Atemruhe-Lage. Dann sollten noch drei Liter Luft in meiner Lunge sein. Atme ich allerdings immer zu tief aus, verändere ich das Gasgemisch in meinen Lungenbläschen, was eine Art Hyperventilation zur Folge haben kann. Oder wenn ich gestresst bin, zu wenige Atempausen zulasse und nicht wieder runterkomme auf meine Atemruhelage, bewege ich mich in Richtung dysfunktionale Atmung. All das sind Stressatmungsfaktoren, die wir atemphysiotherapeutisch behandeln können."
Sabine Weise
Patientinnen und Patienten mit stressbedingten Atemproblemen können die sogenannte Zwerchfellatmung einüben, also lernen, ruhig durch die Nase und in den Bauch zu atmen und dabei die Bauchdecke weich werden zu lassen. Auch Methoden zur gezielten Atementspannung können hier helfen.
"Hyperventilation kann auch krankheitsbedingt sein, wenn beispielsweise Lungengewebe zerstört ist. Aber ganz häufig sind es eben Stress, Angst und Sorgen, die zu dieser Stressatmung führen."
Sabine Weise
Bei der atemphysiotherapeutischen Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten kommt es zunächst darauf an, ob sie an der augenblicklich grassierenden Omikron-Variante erkrankt sind, die besonders die oberen Atemwege angreift, oder an einer der früheren Virusvarianten (Wild-, Alpha-, Beta- oder Delta-Typ). Diese früheren Virustypen lösen oft eine schwere Pneumonie aus und können sich über die Blutbahn an bestimmten Zell-Rezeptoren vieler Organe andocken und dort Entzündungsreaktionen und Organschäden auslösen.
Omikron-Infizierte fühlen sich zwar während der Akuterkrankung zumeist unwohl und klagen über grippeartige Symptome, haben jedoch seltener Langzeitprobleme. Menschen, die an der Corona-Urvariante oder am Alpha-, Beta-, und Delta-Typ erkrankt sind, berichten jedoch häufiger von Beschwerden, die über einen längeren Zeitraum andauern, also von Post-Covid-Symptomen.
"Die Post-Covid-Patienten, die wir als Atemphysiotherapeuten in Behandlung haben, sind einmal Menschen mit schwerer Lungenbeteiligung, die teilweise langzeitbeatmet waren. Sie müssen mit Husten, Atemnot und extremem Kraftverlust ihrer Skelettmuskulatur wieder zurück in den Alltag finden. Da kann man atemphysiotherapeutisch eine Verbesserung der Lungenbelüftung und der Atemwegsreinigung anstreben und die Funktion der Atempumpe und der geschwächten Atemmuskulatur verbessern. Außerdem kann man den Patienten im Extremfall beibringen, mit der geringeren Lungenkapazität ihren Tag zu bewältigen."
Sabine Weise
Darüber hinaus suchen aber auch zahlreiche Patientinnen und Patienten Atemphysiotherapie-Praxen auf, die einen eher milden Krankheitsverlauf hinter sich haben, aber unter Post-Covid-Beschwerden wie Konzentrationsstörungen, Kurzatmigkeit oder Fatigue leiden, also unter schneller Erschöpfbarkeit und Krankheitsgefühlen nach Belastung.
"Bei diesen Post-Covid-Betroffenen beobachten wir häufig eine dysfunktionale Atmung. Ihnen kann es helfen, Nasen- und Zwerchfellatmung, aber auch Entspannungstechniken einzuüben. Außerdem ist es für sie wichtig zu lernen, mit der eingeschränkten Leistungsfähigkeit umzugehen und sich ihre Kräfte im Tagesverlauf gut einzuteilen."
Sabine Weise
Wer sich vertieft über Atemphysiotherapie informieren möchte, kann die Internetseiten der Deutschen Atemwegsliga besuchen. Dort findet man auch eine deutschlandweite Adressliste mit Physiotherapeuten, die sich auf die Atemphysiotherapie spezialisiert haben. Hilfreiche Informationen stellen darüber hinaus die AG Atemphysiotherapie, der Verein für Reflektorische Atemtherapie und die AG Lungensport in Deutschland zur Verfügung.