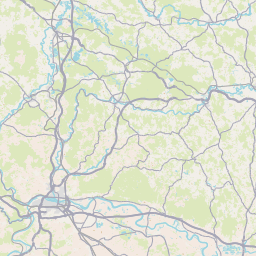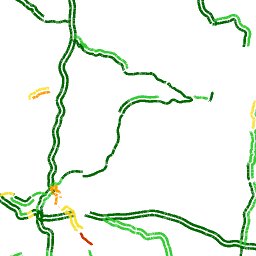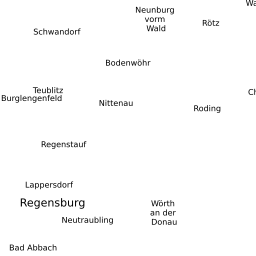Wetter Bauernregeln - wie verlässlich sagen sie das Wetter voraus?
In Zeiten, in denen es noch keine Wettervorhersage im Radio, Fernsehen oder Internet gab, war es vor allem für Bauern überlebensnotwendig, die Zeichen der Natur zu deuten. Ein plötzliches Unwetter konnte schon mal die gesamte Ernte zerstören. Im Bauernkalender wurden diese Naturbeobachtungen in Wetterregeln gefasst. Wetterexperte Dr. Michael Sachweh erklärt, welche Bauernregeln eine hohe Treffsicherheit haben und welche nicht.

Es gibt wohl kaum einen anderen Berufsstand, der in seinem Wirken und Erfolg so vom Wetter abhängig ist wie bei denjenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten.
So wundert es nicht, dass sich gerade die Bauern, die für Aussaat und Ernte das richtige Wetter brauchen, schon seit jeher mit der Deutung der Wetterentwicklung der kommenden Tage, Wochen und Monate beschäftigten.
Bauern sahen aufgrund ihrer Erfahrung in dem Wetter bestimmter Kalendertage einen Hinweis auf die Wetterentwicklung. Sie glaubten, dass sich das Los des künftigen Wetters oft an einem bestimmten Tag entscheidet. Deshalb nannten sie diese Tage auch "Lostage".
Die Blütezeit der Bauernregeln war das Mittelalter. Da half beim Blick in die Wetterzukunft nur die langjährige Erfahrung der Menschen, die einen Großteil ihres Lebens unter freiem Himmel zubrachten und zugleich existenziell vom Wetter abhängig waren. Mit ihrem Wetterwissen konnten die Bauern die Bestellung der Felder und die Erntezeiten besser planen.
Der bäuerliche Berufsstand wies die innigste Verbindung mit dem täglichen Wetter auf. Daher vertrauten bald auch Garten- und Weinbau, die Fischerei und andere wetterabhängige oder -interessierte Teile der Bevölkerung seinen Wetterregeln. Diese wurden vom Großvater an Kinder und Enkelkinder mündlich oder in Gestalt aufgezeichneter Merksätze weitergegeben, später auch in sogenannten Volkskalendern veröffentlicht.
Damit die kalendergebundenen Wetterregeln länger im Gedächtnis haften bleiben, wurden sie oft in Reimform formuliert. Insgesamt sind heute mehr als 500 solcher Bauernregeln bekannt.
Beispiele für Bauernregeln
- Januar: "Ist bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch keiner mehr dahinter." (6. Januar)
- Februar: "Ist's an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein, wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit." (2. Februar)
- März: "Auf Märzenregen dürre Sommer zu folgen pflegen."
- April: "Gewitter am Georgiustag, dann folgt gewiss grimmig Kälte nach." (23. April)
- Mai: "Weht im Mai der Wind aus Süden, ist uns Regen bald beschieden."
- Juni: "Regnet es am Siebenschläfertag, es noch sieben Wochen regnen mag." (27. Juni)
- Juli: "Sind um Jakobi die Tage warm, gibt's im Winter viel Kält und Harm." (25. Juli)
- August: "Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, es noch zwei Wochen sein mag." (15. August)
- September:"Kommt der Michel heiter und schön, wird's vier Wochen so weitergeh'n." (29. September)
- Oktober: "Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein, ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will."
- November: "Wenn die Gänse an Martini auf dem Eise geh'n, muss das Christkind im Schmutze steh'n." (11. November)
- Dezember: "Wenn's auf Weihnacht ist gelind, sich noch viel Kält' einfind."
Kritik an den Bauernregeln
Auch wenn die Bauernregeln ein fester Bestandteil unseres überlieferten Kulturgutes sind, immer noch publiziert werden und einige von ihnen in aller Munde sind, ist ihre praktische Bedeutung heutzutage sehr überschaubar. Das hat verschiedene Gründe.
Unpräzise Formulierungen:
Zum einen zeichnen sich heutige Wetterprognosen für die nächsten Tage, mitunter auch für die nächste Woche, durch eine hohe zeitliche und regionale Treffsicherheit aus. Auch die Prognosen für ganze Jahreszeiten kommen allmählich aus ihren Kinderschuhen heraus.
Da können die Bauernregeln, die weniger oft zutreffen und zudem recht unpräzise formuliert sind, nicht mithalten.
Dies führte sogar zu Spottreimen auf die Bauernregeln, wie etwa: "Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter - oder es bleibt, wie es ist."
Oft nur regionale Gültigkeit:
Zudem ist es für Bauernregeln typisch, dass sie oft nur regional gültig sind. Ihre beste Treffsicherheit haben sie in den Regionen, in denen sie entstanden sind. Kein Wunder, jede Gegend hat ihre eigene "Wetterküche". Deshalb haben Wetterregeln, die beispielsweise in den Alpentälern entstanden sind, nur eine geringe Gültigkeit in Mainfranken - und umgekehrt. Solange die Regeln vom Vater zum Sohn weitergegeben wurden, blieben sie in der Region und behielten damit ihren Wert. Doch als die Bauernregeln durch Buchdruck und Zeitungen eine größere Verbreitung fanden, wurden sie zunehmend von Menschen anderer Regionen wahrgenommen, wo sie keine Gültigkeit hatten. Das minderte ihre Treffsicherheit - zumal rückblickend auch kaum mehr rekonstruiert werden konnte, wo sie ihren Ursprung hatten.
Gregorianische Kalenderreform:
Auch die Gregorianische Kalenderreform trug dazu bei, dass die Treffsicherheit der Bauernregeln sank.
In dem Jahr 1582 hinkte der bislang gültige Julianische Kalender zehn Tage hinter der astronomischen Wirklichkeit hinterher, so dass der Papst per Dekret entschied: "Nach dem heutigen 4. Oktober folgt morgen der 15. Oktober".
Das Problem mit Blick auf die Bauernregeln: Eine ganze Reihe von Regeln stammt aus der Zeit des Julianischen Kalenders. Die auf bestimmte Kalendertage gemünzten Lostage passten nun mit einem Mal nicht mehr, sie gelten infolge der Gregorianischen Kalenderreform in Wirklichkeit erst zehn Tage später. Ein bekanntes Beispiel ist die sehr alte Siebenschläfer-Wetterregel vom 27. Juni (Siebenschläfertag). Sie zählt zu den wenigen brauchbaren Bauernregeln, gilt aber seit 1583 in Wirklichkeit für die Tage um den 7. Juli herum.
Klimawandel:
Auch der Klimawandel entwertet die Bauernregeln. Dieser bedeutet nämlich nicht nur einen Trend zu wärmerem Wetter. Er führt auch zu einer Veränderung bestimmter Wetterlagen und ihrer jahreszeitlichen Schwerpunkte. Zum Beispiel ist der früher ziemlich zuverlässige, mit den "Eisheiligen" verbundene Kälterückfall Mitte Mai inzwischen so selten geworden, dass diese Lostage von manchen Medien schon spöttisch "Heißheilige" genannt wurden.
Witterungsregelfälle
Neben den vielen Bauernregeln im klassischen Sinne existieren einige kalendergebundene Wetterregeln, die auch von den Meteorologen ernst genommen werden. Man nennt sie Witterungsregelfälle oder Singularitäten. Dabei handelt es sich um bestimmte Zeiten im Jahr, zu denen sich immer wieder der gleiche Witterungstyp einstellt beziehungsweise an denen die Witterung einen entscheidenden Hinweis auf die Witterung der folgenden Wochen gibt.
Eisheilige:
Namenspatronen sind Heilige aus der Frühzeit des Christentums: Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und Sophia (15. Mai). Eine der Merkregel lautet: "Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist."
Bis Ende des letzten Jahrhunderts waren die Eisheiligen besonders im Gartenbau eine vielbeachtete Singularität. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind jedoch Kälteeinbrüche, die Mitte Mai noch Frost bringen, im Zuge des Klimawandels selten geworden.
Schafskälte:
Eine weitere Singularität im Kalender ist die Schafskälte vom 10. bis 20. Juni. Schönstes Sommerwetter im Juni ist kaum von längerer Dauer. Davon zeugt der Merkspruch: "Menschensinn und Juniwind ändern sich sehr oft geschwind".
Der Grund für diese Wettersingularität ist, dass einerseits die Erwärmungskraft der hochstehenden Sonne bereits stark ist, andererseits sind die Gewässer des Atlantiks im Frühsommer noch ziemlich kühl. Da aus thermodynamischen Gründen dieses Nebeneinander von warm und kalt oft zu einem Vorrücken der Kaltluft in Richtung Warmluft führt, sind empfindliche Kälterückschläge nach einer Phase warmen Sommerwetters im Juni nichts Ungewöhnliches. Die größte Wahrscheinlichkeit für wechselhaftes und kühles Tiefdruckwetter gibt es in der Mitte des Monats
Namensherkunft Schafskälte:
Da zu dieser Zeit viele Schafe frisch geschoren sind und in der Kälte deshalb bitterlich frieren, heißt diese Singularität Schafskälte.
Siebenschläfer:
"Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt", lautet die sehr alte Regel aus der Zeit des Julianischen Kalenders. Meteorologisch trifft sie erstaunlich oft zu, muss aber aufgrund der Gregorianischen Kalenderreform nicht dem eigentlichen Siebenschläfertag am 27. Juni,sondern der Woche um den 7. Juli herum zugeschrieben werden. In dieser Zeit soll sich das Wetter der kommenden Wochen entscheiden.
Vor allem im Süden Deutschlands trifft die Siebenschläfer-Regel zu 70-75 Prozent zu, also in drei von vier Jahren. Der Grund dafür ist, dass es sich oft Anfang Juli entscheidet, ob die atlantischen Tiefdruckgebiete mit ihren Fronten und verhältnismäßig kühler Luft Europa langfristig erobern können. Ist das um den 7. Juli herum der Fall, bleibt es oft die folgenden Wochen so. Überwiegt in dieser Siebenschläfer-Zeit aber trocken-warmes Hochdruckwetter, so haben wir Grund zur Freude, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sonnenschein und Wärme bis zum Ende des Sommers bleiben.
Hundstage:
Diese Zeit besonders beständiger und hochsommerlich warmer Witterung mit viel Sonnenschein beginnt am 23. Juli und endet am 23. August. Natürlich ist in unserer unbeständigen Klimazone nicht jedes Jahr auf sie Verlass. Die Regel besagt nur, dass die Wahrscheinlichkeit für länger anhaltendes Hochsommerwetter mit Hitzewellen während dieser Zeit am größten ist. Im Gegensatz zu den Eisheiligen konnten die Hundstage dank des Klimawandels in ihrer Häufigkeit zulegen.
Namensherkunft Hundstage:
Die Bezeichnung Hundstage leitet sich vom Sternbild des Großen Hundes ab und stammt aus dem Altertum. Die alten Ägypter und später auch die Griechen und Römer erlebten stets die heißeste Zeit des Jahres, wenn das Sternbild des Großen Hundes am nächtlichen Himmel aufging. Der gesamte Aufgang nahm etwa 31 Tage in Anspruch und dauerte von der letzten Woche im Juli bis zur letzten Woche im August. Heute hat sich die Sichtbarkeit des Sternbildes, weil Kalender und astronomische Gegebenheiten anders sind als damals, um viele Wochen verschoben, weshalb man heute eigentlich nicht mehr Hundstage zu dieser Singularität sagen dürfte.
Altweibersommer:
Der Altweibersommer ist der zuverlässigste Witterungsregelfall des ganzen Jahres. Beim Übergang des Spätsommers zum Herbst gelingt dem Sommer oft in der zweiten Hälfte des Septembers, manchmal bis in die erste Oktoberwoche hinein, ein glänzendes Comeback. Besonders in Süddeutschland steigt die Wahrscheinlichkeit für beständige Hochdruckwetterlagen in dieser Zeit auf bemerkenswerte 75 bis 80 Prozent. Nicht zufällig findet die Münchner Wiesn während des Altweibersommers statt.
Namensherkunft Altweibersommer:
Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. "Weiben" ist der althochdeutsche Begriff für (Spinn-)Weben: morgens glänzen die dünnen, taufeuchten Fäden der gerade Ende September sehr aktiven Spinnen in der Sonne silbrig. Oder diese glänzenden Spinnweben erinnern an das Haar älterer Frauen.
Weihnachtstauwetter:
Die letzte Singularität im Jahr ist das sogenannte "Weihnachtstauwetter". Besonders in früheren Zeiten war es so, dass Mitte Dezember skandinavische Kaltluft für den ersten richtigen Wintereinbruch mit Eis und Schnee sorgte. Zu der Jahreszeit sind die Atlantiktiefs mit ihren milden Luftmassen aber oft sehr stark. Und so dauert es nicht lange, bis ein Vorstoß der Atlantikluft von Westen her den Schnee zum Schmelzen bringt. Und das passiert ausgerechnet zu Weihnachten, wie die Statistik belegt. Diese Singularität sorgt also dafür, dass weiße Weihnachten zumindest im Flachland eher die Ausnahme als die Regel sind.
Das war bereits vor dem Klimawandel so, erst recht aber in der heutigen Zeit.
Da aber heutzutage in tiefen Lagen auch in den Wochen vor Weihnachten kaum Schnee liegt, gibt es nichts mehr zu tauen. Insofern ist Weihnachtstauwetter in Zeiten des Klimawandels keine treffende Bezeichnung mehr. Weihnachtlicher Wärmeeinbruch würde jetzt eher passen.