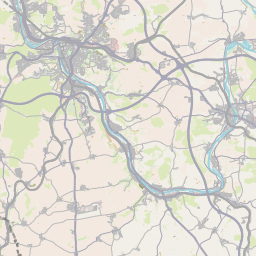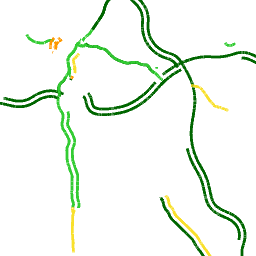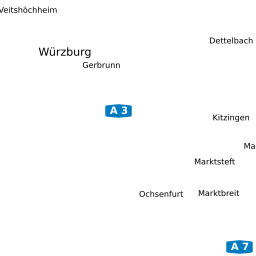Psychokardiologie Wenn die Seele das Herz krankmacht
Kopfschmerzen, Multiple Sklerose, Parkinson und Bandscheibenvorfall - Nervenzellen sind an vielen Krankheiten beteiligt. Doch auf den ersten Blick ist das nur schwer zu erkennen. "Ich bin genervt!" oder "Das geht mir auf die Nerven!" - alltägliche Stoßseufzer. Doch was hat das mit dem Nervensystem zu tun?
Von: Uli Hesse
Stand: 23.07.2024 |Bildnachweis

Kopfschmerzen, Multiple Sklerose, Parkinson und Bandscheibenvorfall - Nervenzellen sind an vielen Krankheiten beteiligt. Doch auf den ersten Blick ist das nur schwer zu erkennen. "Ich bin genervt!" oder "Das geht mir auf die Nerven!" - alltägliche Stoßseufzer. Doch was hat das mit dem Nervensystem zu tun?
Experte:
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig, Forschungsleiter für Psychokardiologie an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Technischen Universität München sowie am Institut für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München.
Herz und Seele beeinflussen sich gegenseitig. Vor allem Depressionen und chronische Erschöpfung sind entscheidende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wirken sich auf Verlauf und Behandlungserfolg aus.
Dem Text liegt ein Interview mit Prof. Dr. med. Karl-Heinz Ladwig, zugrunde, Forschungsleiter für Psychokardiologie an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Technischen Universität München sowie am Institut für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München.
Herz und Seele beeinflussen sich gegenseitig: Niedergeschlagenheit, Ängste, Ärger und Stress können das Herz-Kreislauf-System beeinflussen und dadurch Krankheiten langfristig auslösen oder verschlechtern. Aber Herzkrankheiten können wiederum auch zu Depressionen führen.
Das Fach Psychokardiologie kombiniert Wissen aus der Psychosomatik, Psychologie, Soziologie, Arbeitsmedizin und Kardiologie um herauszufinden, inwieweit die Seele den Verlauf und die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflusst.
Psychokardiologie: Historie
Die Amerikanerin H. Flanders Dunbar gilt als Pionierin; sie untersuchte die Zusammenhänge zwischen Herz und Psyche bereits in den 40er Jahren an einer New Yorker Klinik. Den größten Einfluss hatten allerdings große internationale Studien, bei denen - eigentlich nur nebenbei – seelische Befindlichkeiten abgefragt wurden. Die wichtigste ist die Framingham-Herz-Studie, eine Langzeitstudie, die seit 1948 die Zusammenhänge zwischen Herzkrankheiten und unterschiedlichsten Risikofaktoren untersucht.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Die koronare Herzkrankheit entsteht, wenn fett- und kalkhaltige Ablagerungen die Herzkranzgefäße verengen und der Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird. Koronare Herzkrankheiten sind die häufigste Todesursache in Deutschland; etwa ein Fünftel aller Menschen sterben daran. Studien haben ergeben, dass Depressive ein erhöhtes Risiko haben, einen Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Bein- und Beckenarterien zu erleiden.
Risikofaktoren
Die körperlichen Risikofaktoren für die Entstehung einer Herzkrankheit sind seit langem bekannt. Wer raucht, zu viel wiegt und sich nicht bewegt, riskiert langfristig eine Herz-Kreislauf-Erkrankung; dazu kommen nichtbehandelte Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Diabetes.
"Mehrere Studien seit 1984 am Helmholtz Zentrum ergaben ein ähnlich hohes Herzrisiko für Depressionen wie für die klassischen Risiken Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht und hoher Cholesterinspiegel."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Einfluss auf den Verlauf
Aber die Seele kann auch den Verlauf dieser Herz- und Kreislaufkrankheiten beeinflussen. Depressive Patienten haben häufig eher einen ungesunden Lebensstil, und ihre Herzerkrankungen verlaufen daher im Allgemeinen schwerer. Nach der Diagnose haben sie größere Schwierigkeiten als seelisch weniger stark beanspruchte Menschen, ungesunde Gewohnheiten aufzugeben und die Behandlung wie vorgesehen durchzuhalten.
Krankheit macht depressiv
Aber eine Herz-Kreislauf-Erkrankung kann natürlich auch umgekehrt aufs Gemüt schlagen: Niedergeschlagenheit, Zukunftsängste um Familie und Beruf, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, bevorstehende Operationen, Medikamente mit starken Nebenwirkungen sowie chronische Schmerzen – all das kann zu einer Depression führen, die wiederum die Behandlung erschwert. Ein Teufelskreis, dem Patienten nur entkommen, wenn Seele und Körper ganzheitlich behandelt werden.
Die Grundlage der modernen Psychokardiologie ist der eindeutige Zusammenhang zwischen koronarer Herzerkrankung und Depression sowie Ängsten.
Am meisten gefährdet sind Menschen, die niedergeschlagen sind und sich ausgebrannt fühlen. Depressionen und chronische Erschöpfung führen zu einem Teufelskreis aus sozialer Isolation, ungesundem Lebensstil und negativem Selbstbild, der nicht nur das Krankheitsbild verschlechtern kann, sondern auch die Behandlung gefährdet.
Eine "Depression" bei Herzpatienten beschreibt ein anderes Krankheitsbild als es die Psychiatrie verwendet. Beim Herzen geht es um Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit. Die klassische psychiatrische Depression umfasst dagegen innere negative Bewertungen, Selbstvorwürfe oder eine Aggressivität, die sich gegen einen selbst richtet.
Diagnose
Erfahrenen Ärzten gelingt es mit zwei Fragen festzustellen, ob ein Patient depressiv ist und damit ein erhöhtes Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat:
- "Haben Sie im letzten Monat oft unter Gefühlen von Niedergeschlagenheit, Depressionen oder Hoffnungslosigkeit gelitten?"
- "Haben Sie im letzten Monat oft unter geringem Interesse oder Freudlosigkeit gelitten?"
Wer beide Fragen verneint, leidet mit großer Wahrscheinlichkeit (96 Prozent) nicht an einer Depression. Wer auch nur eine von beiden bejaht, der leidet mit 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit an einer Depression.
Versteinerung statt Trauer
Depressive Menschen gelten als "traurig". Aber das Schlimme ist, dass Depressive gar nicht mehr Trauer fühlen können. Sie sind eher ausgebrannt und wie versteinert, obwohl sie sich eigentlich danach sehnen, wieder ein Gefühl zu haben.
"Sie fühlen sich wie abgetrennt von der Welt, und können sich weder über ein süßes kleines Kind mit einem Luftballon freuen, noch bei einer traurigen Situation mitleiden. Das alles berührt sie nicht mehr richtig."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Depression beeinträchtigt den Behandlungserfolg
Depressive rauchen eher zum Zeitpunkt ihrer Herz-Kreislauf-Diagnose und es fällt ihnen schwerer als anderen, es aufzugeben. Im Vergleich zu sogenannten Gesunden nehmen sie auch weniger regelmäßig die verschriebenen Medikamente ein – beispielsweise, weil sie sich entscheiden, eine Dosis auszulassen oder sie vergessen, sie einzunehmen.
Teufelskreis
Depressiv Erschöpfte kehren seltener an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie sind einsam, sozial isoliert und finden es schwierig, intime Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das wirkt sich natürlich auf das Selbstbild aus. Dazu können Potenzstörungen aufgrund der depressiven Neigung und der Herz-Kreislauf-Erkrankung kommen, so dass sich daraus ein sozialer und psychischer Teufelskreis entwickelt.
Wie kann eine psychische Erkrankung den Herzmuskel beeinflussen? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Zum liegt das an schädlichen Verhaltensmustern, zum anderen an chronischem Stress. Diese beiden Faktoren schädigen Blutgefäße und Kreislauf und damit auch das Herz.
Schädliche Verhaltensmuster
Depressive Menschen verhalten sich eher gesundheitsschädlich – sie rauchen häufiger, ernähren sich eher ungesund, bewegen sich nicht genügend und ziehen sich zurück, so dass das Herzkreislaufsystem geschädigt wird.
Aber auch nach einem Infarkt nehmen sie nicht mehr Rücksicht auf ihre Gesundheit: sie fangen sehr viel häufiger wieder das Rauchen an als andere, achten generell weniger auf sich und gehen rücksichtsloser mit sich selbst um.
"Ein nicht-depressiver Patient joggt zum Beispiel auch im Wald bei Regen. Von einem Depressiven kann man das nicht erwarten, weil er so in seinem negativen Denken verfangen ist, dass er sich selbst zu solch gesundheitsförderndem Verhalten nicht motivieren kann."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Akuter Stress
Auf Gefahrensituationen reagieren Menschen instinktiv mit dem Kampf- oder Fluchtreflex. Manchmal ist beides nicht möglich; doch Stresshormone werden trotzdem ausgeschüttet.
Diese führen dazu,
- dass die Gefäße eng werden,
- dass der Blutdruck steigt,
- dass man eine andere Schmerzempfindlichkeit bekommt,
- aber auch dazu, dass sich das Blut verdickt – damit man bei einer Verletzung nicht verblutet.
Alle diese akuten Erregungsmechanismen können zum Herzinfarkt führen.
Chronischer Stress
Viele Menschen stehen ständig unter Strom, aber eben nicht so, wie man sich das vorstellt: Ärger in der Arbeit, dann raucht man mehr und macht abends vor dem Fernseher eine Tüte Chips auf. Stattdessen stressen sie sich mit einer inneren Beschäftigung mit sich selbst. Diese ist sehr schmerzhaft und nimmt den Körper permanent in Anspruch. Auch hier werden dieselben Stresshormone ausgeschüttet, aber über einen sehr langen Zeitraum, und sie schädigen das Herz ganz extrem. Diese Vermittlungswege zwischen körperlichen und seelischen Prozessen sind wissenschaftlich sehr gut belegt.
Neue Forschung: Entzündungsprozesse
Zwischen Entzündungsprozessen und Depression gibt es eine Wechselwirkung. Depression und Erschöpfung können eine Mikro-Entzündung hervorrufen. Aber umgekehrt können Entzündungen auch zu einer Depression führen.
Jeder kennt das: Wenn eine Erkältung im Anmarsch ist, fühlt man sich irgendwie unwohl und reizbar. Dieses Krankheitsgefühl wird durch Entzündungsprozesse hervorgerufen, und hat eine biologisch sinnvolle Funktion im Heilungsprozess.
"Stellen Sie sich den Hofhund auf dem Bauernhof vor, der vom Traktor angefahren wurde und sich dann verwundet auf die Tenne zurückzieht, dort mehrere Tage schläft und keinen Hunger hat. Er trägt mit seinem Verhalten dazu bei, dass diese Wunden wieder heilen, und das sind ähnliche Verhaltensweisen wie bei einer Depression."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Eine Erkältung zieht beispielsweise eine örtlich begrenzte Immunreaktion nach sich. Bei chronischer seelischer Belastung, Stress, Depressionen und eben Herzerkrankungen geht es dagegen um winzigste Entzündungsherde und eine permanent erhöhte Entzündungsbereitschaft. Diese lässt sich durch die üblichen Medikamente nicht beeinflussen, da sie unter der Wirkungsschwelle liegt.
Studien belegen, dass Menschen mit koronaren Herzerkrankungen durch die Gabe von Entzündungshemmern geholfen werden kann. Aber möglicherweise wirken sie auch gegen die zugrundeliegende Depression.
Gestresste Manager-Typen seien besonders gefährdet – das glaubten Forscher früher. Nun ist klar, dass unbewältigte Lebenskrisen entscheidend sind.
Optimistische "Stehaufmännchen" haben die besten Heilungschancen bei koronaren Herzkrankheiten. Wer Lebenskrisen und Schicksalsschläge nicht mehr bewältigen kann, ist dagegen besonders gefährdet.
Der frühere Risiko-Patient: Typ A
In den 80er Jahren ging man vom sogenannten Typ A als Risikopatient aus. Man stellte sich einen leistungsorientierten Manager vor, der andere dominiert, nicht ausreden lässt und im Stehen isst. Immer auf dem Sprung, nicht gerade sympathisch und Herzinfarkt-gefährdet. Große Studien ergaben aber, dass dieses Verhalten kein größeres Herz-Kreislauf-Risiko voraussagt. Im Gegenteil, diese Patienten hatten sogar eine bessere Überlebenschance.
"Unsere Erklärung ist, dass dieser Menschentyp irgendwann Gegenwind bekommt, zum Beispiel durch Kollegen, die sich das nicht mehr länger gefallen lassen, und dann nicht mehr so weitermachen kann. Irgendwann kommt so ein Mensch dann in eine Situation wo er nicht mehr kann."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Der neue Risikopatient: Der Mensch in der Lebenskrise
Dieser Manager-Typ erleidet nicht wegen des täglichen Stresslevels seinen Herzinfarkt, sondern ein Knick in der Lebenslinie ist entscheidend: eine Lebenskrise wie Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes, ein Todesfall oder vielleicht nur ein Umzug in eine andere Stadt. Er ist bereits so erschöpft, dass er einfach nicht mehr kann und braucht mehr und mehr Energie und Lebenskraft, um den Status Quo aufrechtzuerhalten. Typisch ist, dass Herz-Kreislauf-Gefährdete Arbeit mit nach Hause nehmen, weil sie nicht mehr fertig werden, obwohl sie früher alles schnell geschafft haben. Das ist der neue Risikopatient.
Der zweite Schlag als Auslöser
Viele merken erst, dass sie nicht mehr können, wenn ein zweiter dramatischer Schlag dazu kommt. Wenn man nach einer Scheidung den Arbeitsplatz verliert, oder in einen massiven Konflikt gerät, den er oder sie nicht mehr bewältigen kann. Im Alter wird man außerdem dünnhäutiger und reagiert stärker auf Stress. Dies alles führt bei den depressiv-erschöpften Herzpatienten zu einer kritischen Mischung, so dass sie in einer akuten Stresssituation viel stärker reagieren als die sogenannten Gesunden.
Gesunde "Stehaufmännchen"
"Dagegen beobachten wir bei Patienten, die eher 'optimistische Stehaufmännchen' sind, bei EKG-Messungen einen Stress-Puffer. Sie regen sich einfach nicht so auf, können mehr einstecken."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Die Herzkrankheiten werden meist medikamentös behandelt. Gegen die zugrundeliegende Depression helfen Psychotherapie und Entspannungsübungen sowie als Prävention eine ausgewogene Work-Life-Balance.
Die Psychokardiologie versucht, die Selbstheilungskräfte der Patienten zu aktivieren. Ihr Ziel ist es, die chronische Stressbelastung, Depression und Angst zu verhindern und dadurch das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu senken. Die ganzheitliche Behandlung wird möglichst individuell auf die jeweilige private, soziale und medizinische Situation des Patienten abgestimmt.
Behandlungselemente
Die Psychokardiologie empfiehlt, eine Kombination verschiedener Behandlungen einzusetzen, um Seele und Körper ganzheitlich zu heilen:
- Medikamente, um Herz und Kreislauf wieder zu regulieren: Dazu gehören in der Regel blutdrucknormalisierende Mittel, Beta-Blocker, Aspirin zur Blutverdünnung, blutfettsenkende Medikation und ACE-Hemmer.
- Lebensumstellung: Ernährungsberatung, Entspannungsübungen und Bewegung sind wichtige Behandlungselemente
- Eine Rückkehr zur Arbeit kann ebenfalls therapeutisch wirken.
- Wichtig ist auch die Psychotherapie: In umfassenden Gesprächen wird die individuelle Situation des Einzelnen genau analysiert. Dann werden Strategien zur Bewältigung bestehender Probleme entwickelt.
Psychotherapie oder Medikamente?
Forscher überlegten sich: Wenn Depressionen und seelische Erschöpfungszustände so eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen – könnte dann die Behandlung der Depression durch Therapie oder Psychopharmaka genauso effektiv sein wie Herzmedikamente? Die US-amerikanische gab daher mehrere Mega-Studien in Auftrag.
"Dabei stellte sich heraus, dass weder Psychotherapie noch Psychopharmaka alleine gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen. Das lag unter anderem daran, dass diese Studien es häufig nicht geschafft haben, die Depressivität zu senken. Und zwar interessanterweise, obwohl der Schweregrad der Depression bei Herz-Patienten häufig vergleichsweise niedrig ist."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Klassische Depressionen erkennt man an Aussprüchen wie "Ich mag nicht mehr leben. Ich betrachte mich als Versager." Doch Herzpatienten sind eher leicht depressiv und vor allem erschöpft, daher sind sie so schwer zu behandeln.
Eigentlich wollten die Forscher herausfinden, welche Behandlung am besten hilft. Doch es kam etwas ganz Anderes dabei heraus: Es kommt auf den Patienten an. Wer positiv auf die Depressions-Behandlung anspricht – egal welche – und aktiv mitmacht, hat die besten Erfolgschancen. Wer dagegen nicht mitmacht und die Behandlung ablehnt, hat die schlechtesten Überlebenschancen – sogar noch schlechter als Patienten, deren depressive Erschöpfung nicht behandelt wird und die "nur" Herzmedikamente erhalten.
"Diese amerikanischen Studien sind sehr wichtig, weil sie zeigen, dass die Überlebensrate von Patienten deutlich steigt, wenn ihre Depressionen abnehmen. Und das beweist wiederum, dass Depressionen ein toxischer Risikofaktor bei Herz-Kreislauf-Krankheiten sind."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Entspannung
"Ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die als erstes Qi Gong und Meditationsübungen empfehlen. Aber ich habe mich vom Saulus zum Paulus gewandelt, weil wir sehen, dass das ein ganz wichtiges Prinzip bei der Behandlung ist."
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig
Alle Entspannungstechniken beeinflussen den sogenannten Parasympathikus, also den Teil des Nervensystems, der beruhigt. Wenn man es schafft, ihn anzusprechen – über Therapien, Meditation, Bewegung - gehen die typischen Mini-Entzündungen zurück.
Work-Life-Balance
Wie können wir frühzeitig die Warnsignale erkennen, bevor es zu einem Knick in der Lebenslinie kommt, und selbst unser Leben stärker ausbalancieren und verbessern? Es ist wichtig, immer wieder eine Lebensbilanz zu ziehen und private wie berufliche Anforderungen und Entspannung miteinander zu kombinieren. Nur so lassen sich Warnhinweise auf Stress, Erschöpfung und leichte Depressionen frühzeitig erkennen.
Klassische Prävention
Die alten Regeln für ein gesundes Leben gelten auch hier: Ausgewogene Ernährung, genügend Bewegung und viele soziale Kontakte im Privatleben. Das gilt vor allem für Männer, die sich nur auf den Beruf konzentrieren.
So halten Sie Seele und Herz gesund:
- Finden Sie eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben.
- Seien Sie aktiv, bewegen Sie sich und suchen Sie sich ein Hobby.
- Pflegen Sie soziale und private Kontakte.
- Entspannen Sie sich regelmäßig.
- Schaffen Sie sich bewusst schöne Momente im Alltag.