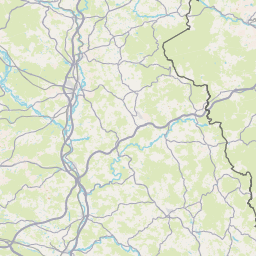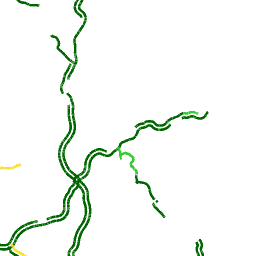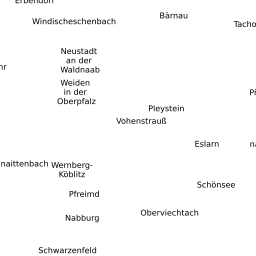27. März 1968 Einführung des Numerus Clausus
Was man universitär aus seinem Leben macht, bestimmt die Abiturnote. Weil möglichst viele studieren sollen, es dann aber zu Engpässen kommt in Sachen verfügbarer Studienplätze, führt die Bundesrepublik Deutschland den Numerus Clausus ein. Ab da wird es vollends diffus. Autorin: Silke Wolfrum
27. März
Donnerstag, 27. März 2025
Autor(in): Silke Wolfrum
Sprecher(in): Edith Saldanha
Redaktion: Susi Weichselbaumer
"Bildung für alle!", war mal der Slogan der bundesdeutschen Nachkriegspolitik. Geradezu übermütig wurde "Das größte Glück der größten Zahl" ausgerufen und dann wollten auch tatsächlich ganz viele junge Menschen studieren! Nur – wo? Die Universitäten waren bereits ab den 50er Jahren heillos überlaufen, von unerträglichen Zuständen war die Rede. Besonders schlimm war es bei den naturwissenschaftlichen Fächern, Medizin, Pharmazie und Psychologie. Um irgendwie durchzukommen überlegte sich jede Uni ihre eigenen Kriterien, nach denen sie ihre Studenten aufnahm oder nicht. Wer da durchblickte, bewies bereits allergrößte Studierfähigkeit.
Zulassungschaos
Um dem frustrierenden Kuddel-Muddel ein Ende zu bereiten, beschloss die Westdeutsche Rektorenkonferenz am 27. März 1968 die Einführung des Numerus Clausus, kurz NC. Er bedeutete so viel wie "Das größte Glück für die kleinste Zahl". Denn jetzt entschied vor allem die Abiturnote, ob man einen Studienplatz erhielt oder nicht. Die Folge: Viele Studienplätze blieben unbesetzt. Richtig gehört! Die Studentinnen und Studenten meldeten sich jetzt nämlich geradezu panisch an so vielen Unis wie möglich gleichzeitig an und das führte letztlich dazu, dass viele Plätze gar nicht vergeben wurden. 70 Proezent der Bewerber für ein Medizinstudium wurden Anfang der 70er Jahre abgelehnt.
Nicht mit uns!
Klar, dass die sich das nicht gefallen ließen. Es kam zu einer Klagewelle, Protesten und Demonstrationen.
"Bei der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix", stand da zum Beispiel auf den Plakaten. Besonders kreativ war der Künstler Joseph Beuys, damals Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Als dort 1971 142 von 232 Bewerbern für ein Lehramtsstudium per Zulassungsverfahren abgelehnt wurden, verkündete er die Verschmähten in seiner Klasse aufzunehmen und besetzte dafür mit ein paar Studenten das Sekretariat der Akademie. Wissenschaftsminister Rau ließ ihn nach einigem Hin und Her gewähren. Als Beuys das gleiche Spiel ein Jahr später wiederholte, folgte der Rausschmiss. Von Polizisten begleitet verließ Beuys erhobenen Hauptes die Akademie und war seinen Job erstmal los.
Aber: Im gleichen Jahr erließ das Bundesverfassungsgericht das so genannte Numerus-Clausus-Urteil. Es sollte den NC in sinnvollere Bahnen lenken. Unausgeschöpfte Studienplätze geht gar nicht, hieß es da in etwa. Also wurde die ZVS gegründet, die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, von Studenten gefürchtet und als "Studentenzwangsverschickung" betitelt. So richtig den Durchbruch brachte das also auch nicht.
2017 bezeichnete das Bundesverfassungsgericht den Numerus Clausus als teilweise unvereinbar mit dem Artikel 12 des Grundgesetzes, in dem es heißt: "Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. " Es folgten Reformen. Heute heißt die ZVS SfH, Stiftung für Hochschulzulassung und ihr Portal "Hochschulstart.de" sorgt weiter für Verwirrung.
Die Einführung des NC wurde damals übrigens als zeitlich befristete Notmaßnahme vorgestellt. Im Studienfach Medizin liegt der Numerus Clausus heute bei 1,0.