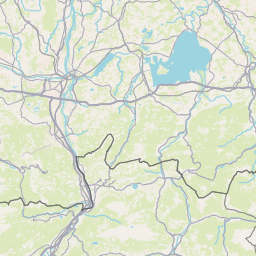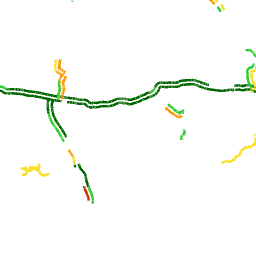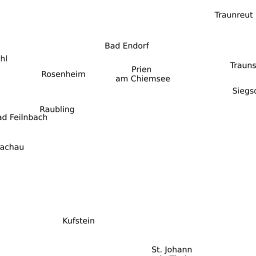Echte Gänsehautgefühle
| Psychologie | MS, RS, Gy |
|---|
Sind wir alle Junkies? Sieht ganz so aus. Sonst würden wir uns nicht so schrecklich gern fürchten. Kein Wunder: Beim lustvollen Rendezvous mit der Angst rauschen die Hormone. Der Adrenalinkick macht glücklich. Und schreit nach mehr.
"Diese rasende Angst! Noch nie im Leben hatte ich so viel Schiss, wie in diesem Moment!" Torsten steht in der Gondel eines Bungeekrans, 50 Meter über dem Münchner Olympiasee, nur einen Schritt vom Nichts entfernt. Er weiß, dass nichts passieren kann, dass ihn Gurte und Seile sichern. Trotzdem: Die Beine zittern, der Puls rast, das Herz pumpt wie verrückt. Dann macht er die Augen zu, lässt sich einfach fallen. In diesem Augenblick explodiert das Adrenalin in seinen Adern. "Der Wahnsinn, reines Glück, einfach nur Glück." Die Euphorie presst ein irres Schreigemisch aus ihm heraus: "Das war noch ein Rest von Panik, aber eigentlich nur Jubel, ein einziges, riesiges Jauchzen!" Sekunden später ist alles vorbei. Langsam pendelt Torsten aus, dann wird er sachte auf den Boden abgelassen. "Wenn man mich heute fragt, wie es war, dann weiß ich nur noch, dass es ein hammergeiles Erlebnis war. Diesen Kick hast du vielleicht beim ersten Kuss, sonst nirgendwo."
Rendezvous mit der Furcht
Der erste Kuss ist unvergesslich. Genauso unvergesslich, wie der elektrisierende Lebenskuss, den uns ein Moment überstandener Gefahr oder gar Todesnähe beschert: Wir haben überlebt! Wir leben! Was für ein Glück, wenn uns das bewusst wird. Wenn wir tatsächlich einmal mit allen Nerven, Adern und Fasern unseres Körpers spüren, was sonst eine achtlos akzeptierte Selbstverständlichkeit ist. Um diesen prickelnden Lebenskitzel wahrzunehmen, brauchen wir Situationen und Erfahrungen, die starke Gefühle auslösen. Liebe ist so eine Erfahrung. Sex auch. Oder Trauer. Und vor allem Angst. Angst ist ein sehr mächtiges, sehr scharfes, lebendiges Gefühl. Ein Kontrastmittel, das die Grenze zwischen Bedrohung und Sicherheit, zwischen Leben und Tod markiert, das uns zeigt, wie zerbrechlich wir sind, wie sehr wir nach Sicherheit gieren.
Eine Frage der Biochemie
Liebe, Sex, Trauer, Angst - all diese starken Gefühlsmomente haben eines gemeinsam: Wir müssen sie nicht denken, sie sind einfach da. Sie überschwemmen uns, sie fluten unseren Körper mit Hormonen und Botenstoffen, mit chemischen Substanzen, deren Wirkung wir unmittelbar spüren. Was wir als Angst wahrnehmen, ist der Effekt eines ganz besonderen Hormon- und Opiatcocktails. Sobald unser Gehirn eine Bedrohung registriert, weist es das Nebennierenmark an, Adrenalin zu bilden und ins Blut auszuschütten. Im Bruchteil einer Sekunde versetzt das Stresshormon den Körper in höchste Alarmbereitschaft. Es mobilisiert schlummernde Energiereserven, fährt den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel, die Sauerstoffaufnahme, die Herz- und Atemfrequenz hoch. Die Muskelaktivität steigt, alle Sinne sind hellwach und messerscharf. Mit dem Adrenalinschalter knipst das Hirn kurzfristig alles aus, was wir nicht zur Flucht oder zum Kampf benötigen; jetzt zählt nur das, was wir zum Überleben, zum Rennen, Retten, Fliehen oder zum Zuschlagen brauchen. Ist die Gefahr überstanden, spendiert uns das Hirn zur Belohnung ein paar beschwingende Endorphine. Die Opiate aus der körpereigenen Hormonküche lösen Glücksgefühle aus und sorgen für wohlige Entspannung.
Lust als Lohn der Angst
Geplant war das Ganze als Notfallprogramm, um das Überleben der Spezies zu sichern. Aber der Kick, den uns das geile Gemenge aus anregendem Adrenalinstoß und euphorisierendem Endorphinabsacker schenkt, ist einfach zu schön. Viel zu schön, um ihn für Saurier, Säbelzahntiger und andere Katastrophen zu reservieren. Wir lieben starke Gefühle, wir suchen, gieren nach ihnen. Wir wollen diese Erregung und Erregtheit, wir wollen sie in vielen Formen und in jedem Alter. Kleinkinder juchzen, wenn sie hochgeschmissen und aufgefangen werden, Halbwüchsige genießen tollkühne Mutproben, Erwachsene treiben Extremsport, rasen auf der Autobahn oder stürzen sich am Gummiseil aus großer Höhe. Aber egal ob Bubenwagnis, Freiklettern im Gebirge, Achterbahnfahren oder Bungeespringen, letztlich geht es immer nur um eines: Die Lust der Grenzüberschreitung, die Lust an heftigen Emotionen, die Lust an der Angst und Lust als Lohn der Angst.
Schrecken auf Probe
Zum Genuss wird das Ganze durch einen simplen Trick: Anders als in der Realität ist es um die Überlebenschancen in den meisten freiwillig aufgesuchten Grenzsituationen bestens bestellt. Ausgetüftelte und regelmäßig TÜV-geprüfte Sicherheitssysteme machen die Gefahr beherrschbar. Das bisschen Restrisiko steuert lediglich die nötige Würze bei. Wir wissen also, dass wir auf der sicheren Seite sind, dass nichts passieren kann. Und trotzdem tut uns das Gehirn den Gefallen, das künstliche Wagstück und das fingierte Risiko wie einen Ernstfall zu behandeln. Wir genießen das Rendezvous mit der Angst, das imaginierte Abenteuer, den vollen körperlichen Effekt des Alarm- und Belohnungssystems ohne die Unannehmlichkeit realer Gefahr.
Das wohlige Gruseln zwischendurch
Um den lustvollen Reiz emotionaler Wechselgüsse, um Gänsehaut und Nervenkitzel auszukosten, müssen wir noch nicht einmal das Haus verlassen. Das Ganze funktioniert auch - und vielleicht sogar besonders gut - im Sitzen und Liegen, in der anheimelnden Wohligkeit eines gut geheizten Zimmers. Nirgendwo können wir uns der Angstlust bequemer und quasi idealtypischer hingeben als beim Lesen einer Grusel- und Gespenstergeschichte oder beim Betrachten eines Thrillers. Auf weiche Polster gebettet und in warme Decken gehüllt aalen wir uns besonders gern in künstlichen Schrecknissen und fiktiven Ängsten. Auch hier spielt unser Gehirn anstandslos mit und steuert den begehrten Hormoncocktail bei. Wir erleben die Angst physisch real: Die Hände werden feucht, die Nerven sind zum Zerreißen gespannt, der Atem fliegt, das Herz rast. Alles wie echt! Aber wir wissen immer auch, dass die Situation beherrschbar bleibt, dass alles nur ein Spiel, nur ein Buch oder ein Film ist, dass wir sicher aufgehoben und geborgen sind. Wir wissen stets, dass wir die Situation jederzeit verlassen können, dass wir jederzeit das Buch zuklappen und den Fernseher ausschalten können. Licht an, Gefahr gebannt!
Schrecken als Erziehungswerkzeug
Das Spiel mit der Angst ist keine Erfindung der Gegenwart oder gar der Filmindustrie. Märchen etwa erzählen seit jeher von grausigen, schrecklichen und blutigen Begebenheiten. Sie tun das nicht aus schierer Lust am Makabren und Furchterregenden. Sie tun es, um Kinder zu lehren, dass sich Angst und Gefahr, das Böse und Schlechte durch Mut und Klugheit besiegen lassen. Auch die Kunst setzt seit jeher auf starke Effekte, um das Gemüt des Lesers, Betrachters und Zuschauers zu erschüttern. Um vordergründige Unterhaltung und bloßen Nervenkitzel ging es dabei nie. Der durch Bilder, Bücher und auf der Bühne erzeugte Schrecken wollte die Menschen läutern, belehren, bessern. Er sollte verstockte Seelen für das Gute öffnen, üble Gedanken und Gesinnungen austreiben, die Verirrten, Unwissenden und Unbedachten vor den Folgen ihres verwerflichen oder auch nur unangemessenen Handelns warnen. Erst die im 19. Jahrhundert aufkommenden Schauergeschichten verfolgten ein anderes Ziel: Sie boten eine Möglichkeit, die durch den tiefgreifenden Wandel des Menschenbildes und der frühindustriellen Lebensweise ausgelösten Verstörungen auszudrücken. Doch welchem Zweck dienen die Horrorvarianten der Gegenwart? Helfen uns Slasher- und Splatterfilme dabei, unseren Alltag zu bewältigen und mit den Schrecken der Gegenwart besser zurecht zu kommen? Zeigen uns "Halloween" oder das "Texas Chainsaw Massacre" nützliche Wege und Möglichkeiten auf, mit unseren tief sitzenden Ängsten fertig zu werden?
Harmloser Kult oder gefährliche Kippfigur?
Aber vielleicht geht es ja einfach nur darum, immer noch härtere, blutigere, grausamere und explizitere Schauerkost abzuliefern, um ordentlich Kasse zu machen. Trend und Konsumverhalten stärken diesen Verdacht: Noch jeder neue Horrorstreifen steigert das visuell zelebrierte Grauen, die Schraube wird stets nur angezogen, niemals gelockert. Im Internet brechen Videos, die echte oder glaubhaft echt nachgestellte Brutalitäten, Gewaltexzesse und Unfälle zeigen, sämtliche Klickrekorde. Im Film haben ausufernde Gewaltorgien und immer schockierende Details in HD das gepflegte Gruseln, die wohlige Gänsehaut, den feinsinnigen, raffiniert gebauten und augenzwinkernden Nervenkitzel abgelöst. Nur der spektakuläre Tabubrecher räumt ab, nur die nächste Eskalationsstufe zählt, ein geistiger Nähr- und Mehrwert über das Hochdrehen der Angstlust hinaus ist weder gewollt noch geboten. Kein Zweifel: Damit der Kick sich einstellt und die Hormone rauschen, muss die Schreckensdosis permanent hochgefahren werden. Was uns gestern noch die Haare aufstellte, entlockt uns heute nur noch ein müdes Gähnen. Aber was bedeutet das? Verroht nur das Genre durch sinkenden Hemmschwellen und gewandelte Sehgewohnheiten, oder verrohen wir mit ihm? Niemand kann wirklich sagen, wie viel Grauen wir unbeschadet aufnehmen und verarbeiten können. Niemand kann sagen, ob und wann die Situation kippt und vor allem wohin. Die Diskussion um die Schädlichkeit, die sozialen und psychischen Folgen des extensiven Konsums von virtuellem Horror ist ebenso alt wie offen. Es ist aber gut möglich, dass am Ende die wirklichen Zombies ihr Unwesen schon längst nicht mehr hinter, sondern vor dem Bildschirm beziehungsweise Monitor treiben.