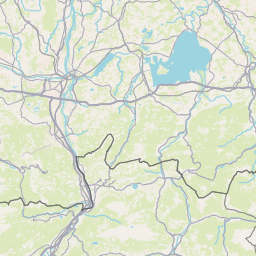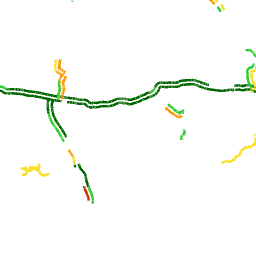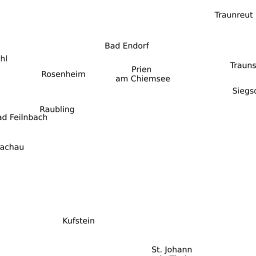Interview mit Blacktivistin Michaela Dudley "Wenn Empathie und Empörung miteinander einhergehen, kann sich etwas bewegen"
Welche Auswirkungen haben die weltweiten Proteste nach dem grausamen Mord an George Floyd? Können sie etwas Großes in Gang bringen? Darüber hat Malcolm Ohanwe mit der Diversity-Beraterin und Blacktivistin Michaela Dudley gesprochen.

Zündfunk: Die ganze Welt zeigt sich betroffen über die tödliche Polizeigewalt, die in den vereinigten Staaten passiert. Sehr viele Leute sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen. Wie haben Sie die ganze Debatte empfunden?
Michaela Dudley: Das sind Wellen der Empörung, die weltweit emporschlagen. Menschen rund um den Globus sind wahrhaftig entsetzt, wütend, traurig. Wenn Empathie und Empörung miteinander einhergehen, dann kann sich etwas bewegen. Das weiß ich als Blacktivistin, als LGBTQ-Aktivistin und Transfrau, Kabarettistin, Journalistin, Jurist-Doktorin und einfach als Mensch. Aber die Richtung muss stimmen und es muss auch nachhaltig sein.
Es ist sehr begrüßenswert, dass Millionen von weißen und anderen nicht-schwarzen Menschen mit auf die Straße gehen. Obwohl sie nicht eins zu eins spüren können, wie es ist, auch nur fünf Minuten lang schwarz zu sein, können sie die Brutalität nicht tatenlos mit ansehen. Ich möchte sie aber auch dafür sensibilisieren, dass die Gewalt sich nicht nur auf physische Gewalt beschränkt. Ich habe zum Beispiel noch eine Sache in Erinnerung: Das Bild des demokratischen Gouverneurs George Wallace, als er mit ausgestreckten Armen am Tor einer Universität stand – und da gab es Hilfsprogramme wie Affirmative Action noch lange nicht – als er schwarzen Studenten den Zutritt verwehrte. Das war für mich auch Gewalt. Denn knapp einhundert Jahre zuvor war es in den gleichen Südstaaten verboten, den schwarzen Sklaven das Lesen beizubringen.
Ist dieser Protest jetzt anders als früher?
Ich kann eindeutig sagen: Jein. Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da, dass mehr daraus wird. Aber trotzdem: Alles dauert. Selbst, wenn man das Gefühl hat: Hey, es könnte nicht eindeutiger sein, was sich hier abspielt. Es dauert trotzdem. Ich glaube aber in der Tat, dass das Potenzial da ist. Die Menschen haben jetzt in der Corona-Krise Zeit dafür gehabt, über die Gesellschaft nachzudenken. Und auch viele weiße Menschen aus der Mittelschicht merken, wie prekär ihre Situation ist. Stichwort: Intersektionalität. Diese Gesellschaften basieren auf Diskriminierung. Und diese Diskirminierung ist omnipräsent und allumfassend.
Wir müssen begreifen, dass diese Probleme, die wir heute nach wie vorhaben und vielleicht umso besser wahrnehmen, dass sie wirklich sehr tief in den Strukturen der Gesellschaft verwurzelt sind. Und die Gesellschaft steht auf dem Nacken anderer Menschen. Die Anhaltspunkte für Solidarität sind also in jedem Fall gegeben.
Sehr viele weiße Menschen oder nicht-schwarze Personen sind ja im Moment ein bisschen überfordert, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen. Wie soll ich mich solidarisch zeigen? David Guetta hat zum Beispiel Martin Luther King in seinem DJ-Set zitiert. Manche Influencerinnen malen sich ihr Gesicht jetzt dunkel an, um zu zeigen: Wir sind alle Menschen!
Also erstmal würde ich dringend davon abraten, Blackfacing als Lösung zu betrachten. Das vorab. Wir lieben diese Solidarität, aber die sollte auch ein bisschen durchdacht sein. Eine Debatte über Blackfacing ist natürlich ein anderes Thema. Aber vorab: Bitte das bloß nicht! Wir brauchen mehr Dialog. Wir müssen uns intensiver miteinander unterhalten und dürfen nicht aneinander vorbeireden. Wir suchen gerne solidarische Weiße, aber wir brauchen keinen White Savior. Wenn wir mehr miteinander diskutieren würden, wenn wir die Möglichkeit hätten, mehr aus unseren alltäglichen Erfahrungen zu erzählen, wäre das schon genauso wichtig. Ähnlich wichtig, wie das Betrachten der Gewaltvideos, aber irgendwie wichtiger. Denn viele weiße, die durch die Videos durchaus entsetzt sind, begreifen immer noch nicht, wie der Alltag eines Menschen mit dunklerer Hautfarbe wirklich aussieht.
Die Mikroaggressionen, denen wir ständig ausgesetzt sind – das sind Sachen, worüber man reden soll. Wie man behandelt und betrachtet wird, wenn man ein Geschäft betritt. Wie man auf der Straße angeschaut wird. Und dann die Menschen, die sagen: Hey, ich bin kein Rassist, aber… die brauchen wir nicht. Wir brauchen Solidarität, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Menschen, die zuhören. Und das wissen wir zu schätzen, dass es so viele gibt.