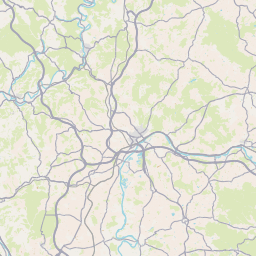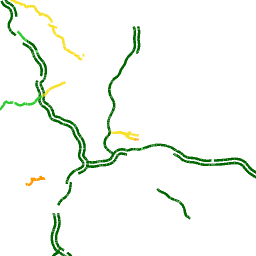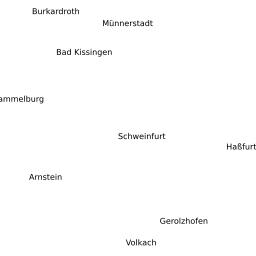Das neue Game Of Thrones? Warum die Serie „Shogun“ in Sachen kultureller Aneignung vieles richtig macht
Seit Wochen überschlagen sich die Kritiken vor Freude: Die Disney+-Serie „Shogun“ spielt in Japan im 16. Jahrhundert und gilt schon jetzt als das neue „Game Of Thrones“ – aber ist dem wirklich so? Ferdinand Meyen verrät euch, ob der Hype hält, was er verspricht.

„Shogun“ ist keine Serie wie jede andere. Nur ein Beispiel: Das Seh-Erlebnis ist auch ein Lese-Erlebnis, denn selbst wenn man bei Disney+ die Sprache vorher auf Deutsch einstellt, hört man dennoch Japanisch: Um authentisch zu bleiben, haben die Macher*innen auf eine Synchronisation verzichtet. So muss man die ganze Zeit Untertitel mitlesen. Außer, „der Wilde“ ist mit dabei.
Der Wilde, das ist John Blackthorne, gespielt vom zuletzt noch eher unbekannten Indie-Sänger Cosmo Jarvis. John ist ein englischer Seefahrer, der im Auftrag der Holländer um 1600 nach Japan kommt. Als er vor der Küste Schiffbruch erleidet, werden er und seine Mannschaft gefangen genommen. Sie geraten in einen Machtkampf, der zwischen den japanischen Fürsten tobt.
YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

Shogun - Trailer - Ab 27. Februar exklusiv auf Disney+ streamen | Disney+
Serien-Recycling – aber wie!
„Shogun“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von James Clavell. In den 80ern wurde es schonmal verfilmt. Jetzt also das Serien-Recycling – aber wie! Vier Folgen gibt es bis jetzt, jeden Dienstag kommt eine neue dazu. Und die werden mit Lob überhäuft. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Die fantastische Serie ‚Shogun‘ sieht nicht nur toll aus, sie rüttelt auch die Vorstellungen von kultureller Überlegenheit ordentlich durcheinander.“ Und in der Taz heißt es: „Der Kritiker und Pionier des Postkolonialismus Edward Said formulierte, wie der westliche Blick den arabischen Kulturraum exotisiert und verfälscht. Nichts anderes passiert mit der Popkultur in Japan. Solche Fehltritte leistet sich ‚Shogun‘ nicht. Ein großes Serien-Highlight.“
Klischee adé
Ja, wer die postkoloniale Brille bei „Shogun“ aufsetzt, hat seinen Spaß. Nichts mit dem Klischee, dass der Eroberer aus dem Westen die Kultur in die Welt hinausträgt. Hier sehen wir das Gegenteil. Es ist der Kolonialist, der in Japan zunächst als „Wilder“ gilt, und der schwer beeindruckt ist von dieser fremden Gesellschaft. Die Darstellung Japans ist bis ins kleinste Detail durchgeplant und das sieht richtig gut aus. Die Serienmacher haben sich von Historikern beraten lassen, alles soll so authentisch wie möglich wirken. Und die Figuren begegnen sich auf Augenhöhe. Engländer und Japaner kommen sich sich von Folge zu Folge immer näher und profitieren voneinander. Es wirkt fast wie eine Art Ethik der kulturellen Aneignung, so wie sie der Pop-Theoretiker Jens Balzer beschreibt: „Ich würde gerne mal vorschlagen, die Perspektive umzudrehen: Also nicht zu sagen: Man darf dieses nicht und man darf jenes nicht. Kulturelle Aneignung ist der Motor aller Kulturen. Ohne kulturelle Aneignung würde es nichts von dem geben, was uns popkulturell begeistert, fasziniert und voranbringt.“
Kein neues „Game-Of-Thrones“
Dieser Perspektivwechsel gelingt bei „Shogun“ wie bei kaum einer anderen Serie. John Blackthorne und der Fürst Toranaga zum Beispiel werden nach und nach Freunde und schauen sich voneinander Dinge ab. Zu Unrecht wird die Serie von vielen als das neue „Game Of Thrones“ bezeichnet. Vermutlich, weil wir auch hier viel Nacktheit, Sex und Blut sehen. Männer werden in kochendes Wasser geworfen oder von Kanonenkugeln zerfetzt. Aber politisch ist die Serie im Gegensatz zur George-RR-Martin-Saga blankes Seppuku, im Japan des 16. Jahrhundert der rituelle Selbstmord.
Komplexitätslevel: Klassensprecherwahl
Ich hätte gerne erfahren, wie die unterschiedlichen Fürsten regieren, welche politischen Ziele sie verfolgen. Welche Vision haben sie für Japan und mit welcher Strategie gehen sie vor? Aber „Shogun“ gleicht einer Seifenoper. Da ist der eine Fürst, der zu den Christen gehört, ein anderer hat Lepra, der nächste war mal ein gefürchteter Krieger. Komplexitätslevel: Klassensprecherwahl. Dabei weiß man doch gerade dank der postkolonialen Theorie, dass auch frühere Gesellschaften zu mehr differenziertem Denken in der Lage waren als „Wer ist Freund, wer der Feind?“ Schade, dass Shogun abgesehen von ein paar schlauen Gedanken zu kultureller Aneignung politisch wenig zu bieten hat. Dabei hätte Shogun das Potenzial, mehr zu sein als bloß Popcornkino. Dann hätte ich die Untertitel auch gerne mitgelesen.