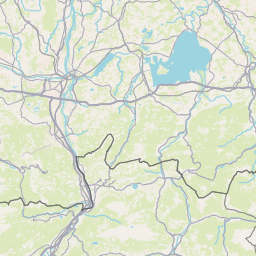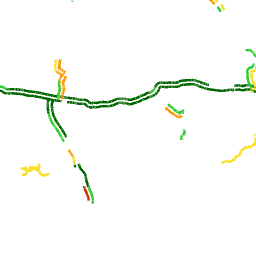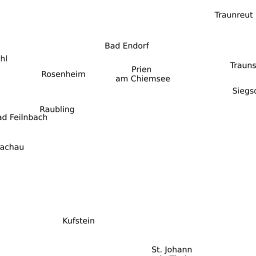Filmregisseur Michael Verhoeven im Porträt Der Mann für die vernachlässigten Themen
Tabuisierte Nazi-Vergangenheit, Transsexualität, die Liebe eines katholischen Pfarrers - der in München lebende Filmregisseur und Schauspieler Michael Verhoeven hatte nie Berührungsängste bei "schwierigen" Themen. Am 5. Juli erhält der 73-Jährige, der mehr als 30 Filme drehte, den "Bernhard-Wicki-Filmpreis Die Brücke".

Schon zu Beginn seiner Karriere als Regisseur sorgt er für einen Paukenschlag. 1970 dreht er "o.k.", seinen fünften Film, eine experimentelle Arbeit gegen den Vietnamkrieg. Auf der Berlinale löst sie einen Eklat aus. Der US-amerikanische Jury-Präsident George Stevens, Filmemacher und ehemaliger Offizier, fühlt sich brüskiert. Daraufhin soll "o.k." zunächst als deutscher Wettbewerbsbeitrag aus dem Programm gestrichen werden. Doch die meisten anwesenden Regisseure solidarisieren sich mit Verhoeven und ziehen ihrerseits ihre Filme zurück.
Die Jury gibt entnervt auf, die Berlinale wird - zum bisher einzigen Mal - abgebrochen. Die Juroren der deutschen Filmförderung denken anders: Ein Jahr später wird "o.k." der Bundesfilmpreis zuerkannt.
Vom Dr. med. zum Filmregisseur
Danach konzentriert sich Verhoeven voll aufs Filmemachen, 1973 gibt er den Arztberuf - er hat 1969 zum Dr. med. promoviert - auf. Mit seiner Rolle in "o.k." beendet der 1938 in Berlin geborene Spross einer Film- und Theaterdynastie vorerst auch die Schauspielerei. Als 16-Jähriger hatte er in "Das fliegende Klassenzimmer" (1954) debütiert. Es folgten unter anderem Auftritte in "Der Pauker" (1958), "Keine Nacht ist ohne Morgen" (1962), "Das Haus in Montevideo" (1963) und "Lausbubengeschichten" (1964).
Große Beachtung findet Verhoeven 1977 durch seinen Film "Gefundenes Fressen" mit Heinz Rühmann und seinem damaligen Schwager Mario Adorf, der zu jener Zeit mit Verhoevens Schwester Lis verheiratet ist. Der endgültige Durchbruch kommt mit "Die weiße Rose", in der er die Geschichte der gleichnamigen Münchner Studentengruppe, die im Untergrund gegen Hitler agitierte, erzählt. 1982, als der Film herauskommt, hat das Thema Nationalsozialismus längst noch nicht die mediale Konjunktur, die es heute hat.
Stöbern im braunen Nachkriegssumpf
Bildergalerie
Widerstand gegen das Nazi-Regime ist auch Thema seines Films "Das schreckliche Mädchen" (1990): Sonja, gespielt von Lena Stolze (auch Sophie Scholl in "Die weiße Rose"), nimmt an einem Aufsatzwettbewerb "Meine Heimatstadt im Dritten Reich" teil und versucht, nach lokalen Kämpfern gegen die braunen Machthaber zu suchen. Doch in der Kleinstadt will man davon nichts wissen, Sonja stößt auf Feindseligkeit. Die Geschichte basiert auf dem Fall der Anna Elisabeth Rosmus, die nach ähnlichen, ebenfalls zunächst blockierten Recherchen in Passau herausfand, dass nicht wenige Persönlichkeiten der Stadt aktive Nazis waren. "Das schreckliche Mädchen" wird für den "Oscar" in der Kategorie "Bester ausländischer Film" nominiert.
Aufsehen erregt auch 1993 Verhoevens TV-Produktion "Eine unheilige Liebe", in dem es um die Zuneigung eines jungen Pfarrers zu einer Kunstlehrerin geht. 1999 nimmt sich Verhoeven eines im Film ansonsten kaum bearbeiteten Themas an: Transsexualität. Der ARD-Film "Enthüllung einer Ehe" schildert das Schicksal eines verheirateten Lehrers mit nicht eindeutiger geschlechtlicher Identität.
Hüter der alten Kinos
Für das Fortbestehen des Kinos sorgt Verhoeven auf eine besondere Art, in dem er sich die Rettung traditionsreicher Häuser auf die Fahnen geschrieben hat. So besitzt Verhoeven seit 1992 das "Toni" am Berliner Antonplatz und seit 1995 das "Filmtheater am Friedrichshain" im Bezirk Prenzlauer Berg.