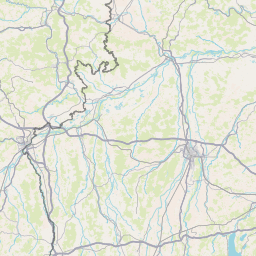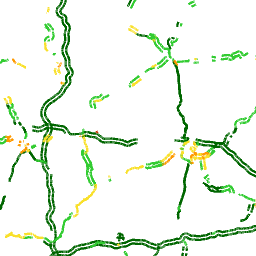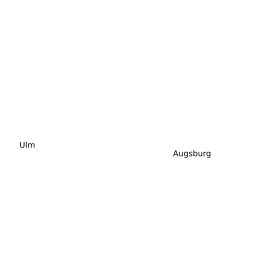Anarchie, Staat und Recht Hintergrund
Ist der Staat eine Notwendigkeit?
Menschen leben in Staaten zusammen. Das prägt unsere Erfahrung und scheint unumgänglich zu sein. Staaten unterscheiden sich stark, können demokratisch verfasst oder mörderisch repressiv sein, doch eines haben sie gemeinsam: Ohne Recht und Ordnung geht es nicht. Sobald es eine institutionalisierte Zentralgewalt gibt, muss diese über Zwangsmittel verfügen, um ihren Machtanspruch durchzusetzen. Auch freiheitlich geprägte Staaten haben eine Polizei und eine Armee, ein schriftlich fixiertes Recht, Gerichte, Gefängnisse.
Eine Selbstverständlichkeit? Nein. Dass es auch anders geht, beweisen bis heute Stammesvölker in Afrika, die zumindest im öffentlichen Raum keine dauerhaften Hierarchien kennen. Möglicherweise zeugt ihre Lebensweise noch heute davon, wie Menschen in vorgeschichtlichen Phasen gelebt haben. Staatliche Gebilde sind jüngeren Datums, es gibt sie erst seit 4.000 - 5.000 Jahren, die Menschheitsgeschichte ist dagegen bereits zwei Millionen Jahre alt.
Die Vielfalt der sozialen Beziehungen, die sie im Lauf dieser langen Geschichte entwickelt haben, ist größer, als wir ahnen. Es lohnt sich, sie ins Gedächtnis zu rufen. Das Gegebene, das so selbstverständlich Scheinende, ist keineswegs immer das einzig Wahre. Brauchen Menschen wirklich Herrschaftsapparate, Zwangsmittel, Sanktionen, Repressionen? Geht es nicht ohne?
Die Staatsphilosophie von Thomas Hobbes
Nein, auf keinen Fall, behauptet Thomas Hobbes, ein bedeutender und wirkungsmächtiger Philosoph und Staatstheoretiker aus dem 17. Jahrhundert, in seinem Hauptwerk "Leviathan". Menschen brauchen Gesetze, einen Staat, einen Souverän, dem sie sich unterordnen können, sonst fallen sie übereinander her, sonst herrscht der Krieg aller gegen alle. Warum? Weil Menschen sich im Grunde ziemlich ähnlich sind. Ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander.
Diese Beobachtung könnte auch erklären, warum Menschen dazu neigen, Solidarität und Mitgefühl zu entwickeln. Das liegt Thomas Hobbes jedoch fern, das entspricht nicht seiner Lebenserfahrung, die von einem mörderischen Bürgerkrieg geprägt war. Die Ähnlichkeit von Menschen führt für ihn zu Rivalität, zu Machtkämpfen. Alle begehren dieselben Güter, jeder will mehr haben als der andere, alle Menschen wollen Macht, denn Macht eröffnet die Option, Güter zu erwerben und erworbene Güter zu behaupten. "Ich erkläre als eine allgemeine Neigung der Menschheit einen dauernden rastlosen Wunsch nach Macht und immer mehr Macht, der erst mit dem Tod aufhört. Und der Grund hierfür ist immer, dass der Mensch auf einen intensiveren Genuss hofft, als er schon besitzt, oder dass er nicht mit einer mäßigen Macht zufrieden sein kann, sondern weil er die Macht und die Mittel, die er gegenwärtig hat, nicht ohne die Erwerbung von mehr sichern kann."
Es gibt nur einen Weg, um der Hölle von Mord und Totschlag zu entrinnen, die durch das ungezügelte Machtstreben jedes Einzelnen entstehen würde: Macht wird übertragen, auf eine Person oder eine Personengruppe, der sich alle unterordnen. Für Hobbes gibt es nur Souverän und Untergebene. Eine Despotie, die mit starker Hand und notfalls auch mit Gewalt für Ordnung sorgt, ist ihm lieber als der Terror ungeordneter Verhältnisse. Hobbes’ Staatsphilosophie ist das Symptom einer Krise: Ihre Hauptelemente, Furcht, Sicherheit, Machtstreben, sind eine Reaktion auf Bürgerkrieg und Chaos, spiegeln eine aus den Fugen geratene Zeit, sind geprägt von Sehnsucht nach Sicherheit und Ordnung um fast jeden Preis.
Die Bedeutung der Menschenrechte
Aber ist der Mensch wirklich "des Menschen Wolf", um mit Hobbes zu sprechen, gepolt auf Dominanz und Unterwerfung? Strebt er nicht auch nach Verständigung und Ausgleich, nach Einfühlung, nach solidarischem Miteinander?
Der Menschenrechtsgedanke, der sich langsam, aber sicher in modernen Gesellschaften nach westlichem Muster Bedeutung verschafft hat, zeugt davon, dass Menschen die Nähe, den Respekt, die Achtung von ihresgleichen suchen und brauchen. Er zeugt davon, dass wirklicher Friede mehr ist als die durch Machtapparate erzeugte Abwesenheit von Krieg, von äußerer und innerer Bedrohung. Friede beruht auf Respekt, auf Anerkennung. Menschen dürfen nicht unterdrückt, diskriminiert, gefoltert und verfolgt werden, um ihrer selbst willen nicht.
Ist dieser Gedanke eine späte Errungenschaft der Geschichte, ein abstraktes ideologisches Postulat, in mühsamen Machtkämpfen einer ganz anders strukturierten Realität abgerungen? Geht der Traum von Anarchie, von herrschaftsfreien Räumen, an der Natur des Menschen vorbei? Nein, behauptet der Soziologieprofessor Christian Sigrist. Im Menschenrechtsgedanken verdichten sich Grundtendenzen menschlicher Vergesellschaftung: Grundtendenzen, die sich nachweisen lassen in anderen Völkern und Kulturen. Wer sie kennt, sieht die dominanten Herrschaftssysteme, die die moderne Welt prägen, in einem anderen Licht, bezweifelt ihren Absolutheitsanspruch, ist in der Lage, sie zu entideologisieren.
Segmentäre Gesellschaften - Gemeinschaft ohne Zentralinstanz
Christian Sigrist hat in seinem Buch "Regulierte Anarchie" segmentäre Gesellschaften in Afrika untersucht. Der Begriff "segmentäre Gesellschaft" geht auf den Soziologen Emile Durkheim und sein 1893 erschienenes Buch "Über die Teilung der sozialen Arbeit" (De la division du travail social) zurück und bezeichnet in Clans organisierte Gesellschaften ohne zentralisierte Herrschaftsinstanz – akephale, "kopflose" Gesellschaften also, deren politische Organisation durch politisch gleichrangig und gleichartig unterteilte, mehr- oder vielstufige Gruppen vermittelt ist.
Sigrist sieht in ihnen die Behauptung bestätigt, "dass das Zusammenhandeln von Menschen auch ohne herrschaftliche Organisation möglich ist, dass öffentliche Ordnung auch ohne Unterordnung unter öffentliche Gewalten gehalten werden kann". Sigrist bezweifelt nicht, dass es auch in segmentären Gesellschaften Instanzen gibt, die Macht und Kontrolle ausüben: der Ältestenrat beispielsweise, der in generationenübergreifenden Zusammenkünften das große Wort führt, Regenhäuptlinge, Jagdhäuptlinge, die in bestimmten Situationen Weisungsgewalt besitzen. Was aber fehlt, ist eine "außerhäuslich geordnete Dauergewalt" (Max Weber), eine zentrale Instanz, bestehend aus einer Person oder einer Gruppe von Personen, die ihre dauerhaft übergeordnete soziale Rolle aus einem spezifischen Recht oder einer spezifischen Pflicht, das Verhalten anderer Gruppenmitglieder zu kontrollieren und zu reglementieren, ableitet und ihren Anspruch gegebenenfalls mit Zwangsmitteln (Polizei, Armee, Gerichte, Sanktionen) durchsetzt.
In akephalen Gesellschaften gibt es Häuptlinge und Älteste, die über Autorität verfügen, aber die ist an Funktionen gebunden. Ein Jagdhäuptling verliert außerhalb der Jagd seine Autorität und wird zu einem ganz normalen Stammesmitglied. Die Häuptlinge haben keine Polizei, die die Durchführung ihrer Anordnung erzwingt, sie sind angewiesen auf Anerkennung und Respekt.
Die Tallensi
Die Tallensi, ein Stammesvolk im nördlichen Ghana, umfasst ungefähr 150.000 Menschen, die in einem Gebiet leben, das etwa so groß ist wie der Großraum von Hamburg. Der Ethnologe Volker Riehl hat drei Jahre mit ihnen gelebt und ihre Lebensweise in seinem Buch "Natur und Gemeinschaft" untersucht.
Die Tallensi sind ein friedliches Volk mit einer deutlich ablehnenden Haltung gegenüber Krieg, Tötung und Blutvergießen, die in Erdkulten und Respekt vor den Ahnen wurzelt. Sie leben von Landwirtschaft und Viehzucht, Jagd und Fischfang spielen eine untergeordnete Rolle. Die Tallensi sprechen mehrere Dialekte, die sozialen Beziehungen sind sehr vielschichtig, es gibt keinen zentralen Staat, keine Vereinigung aller.
Das soziale Leben wird von Verwandtschaftsstrukturen bestimmt, welche in patrilokalen, patrilinearen Clans ihre Ausprägung findet – der Fokus liegt auf der Vater-Sohn-Beziehung. Die Clans haben Oberhäupter, die Status und Respekt beanspruchen und über große moralische und rituelle Autorität verfügen. Konflikte werden über Mediatoren geschlichtet, und die Clanmitglieder sind in ritueller, netzwerkartiger Zusammenarbeit eng aufeinander bezogen. Die Gruppe trifft ihre Entscheidungen gemeinsam, unter Einbeziehung des Oberhauptes. Das Oberhaupt trägt auch Verantwortung für den Schrein der Ahnen, verdient besonderen Respekt, hat fast priesterlichen Status.
Als Ghana noch Kolonie war, fügte die britische Administration dem sozialen Gleichgewicht der Tallensi schweren Schaden zu, weil sie die Chiefs für Verwaltungsaufgaben heranzog und sie zur Arbeit verpflichtete.
Konfliktlösung und Rechtsprechung
Auch segmentäre Gesellschaften verfügen über Regeln und Normen und müssen das Problem bewältigen, dass Einzelne immer wieder versuchen, die Spielregeln zu brechen. Aber ein schriftlich fixiertes Recht oder das Prinzip, dass ein Einzelner sich vor Gericht zu verantworten hat, gibt es nicht. Der Einzelne ist in seinen Clan eingebunden, im Falle einer Regelverletzung ist der gesamte Clan dazu verpflichtet, das unerwünschte Verhalten zu reglementieren, Sühne zu leisten, den sozialen Frieden und den Ausgleich mit der transzendenten Welt der Götter und Ahnen wiederherzustellen. Das geschieht durch rituelle Praktiken, vorzüglich Opferrituale. Der Bezug zu religiösen Vorstellungen ist sehr wichtig. Schlichter spielen eine herausragende Rolle. In den vorstaatlichen Phasen der Menschheitsgeschichte soll dies – in unterschiedlichen Varianten - die verbreitetste Form der Rechtsprechung gewesen sein.
Schriftlich fixiertes Recht ist ein Kennzeichen von Staaten, es bildet sich zuerst in Mesopotamien, dann in Ägypten und China, ungefähr ab 2000 vor Christus heraus. Gesetzeskodexe entstehen, Gerichte, die ihre Einhaltung überwachen, Zwangsmittel, Sanktionen. Die Formen des Rechts, die sich in Babylonien, im alten Rom, im antiken Griechenland herausbilden, sind unterschiedlich und spiegeln die Macht- und Eigentumsrechte der jeweiligen Gesellschaft wieder. Im mittelalterlichen Mitteleuropa gewannen Rechtsbücher wie der Sachsenspiegel an Bedeutung, die bereits den Gleichheitsgedanken thematisieren.
Gleichheit
Gleichheitsnormen, und damit Gleichheitsbewusstsein, gibt es auch in zentralisierten Gesellschaften und in allen menschlichen Gesellschaften überhaupt, schreibt Christian Sigrist in seinem Buch "Regulierte Anarchie".
Das liegt in der Natur der Sache: Wenn generelle Normen etabliert werden, heißt das implizit, das von allen Individuen ein gleiches Verhalten in einer bestimmten Situation erwartet wird. Welche Herausforderung die Erfahrung von Gleichheit für das Zusammenleben der Menschen darstellt, zeigt die wechselvolle Geschichte des Menschenrechtsgedankens: Als die amerikanische Verfassung 1776 die Menschenrechte propagierte, bezog man sie nicht auf Frauen und Sklaven. Als die Franzosen sich im Zuge der Revolution die Menschenrechte auf die Fahnen schrieben, wurden die Frauen wieder vergessen. Menschenrechtserklärungen blieben lange Zeit unverbindlich, bis in die Zeit der Weimarer Republik. Wirksam wurden sie im Grundgesetz von 1949, dessen Einhaltung seit 1951 vom Bundesverfassungsgericht überwacht wird.
In parlamentarischen Demokratien – in den westlichen Gesellschaften also – haben sie sich inzwischen etabliert, zumindest als Anspruch. In der Praxis sind sie nirgendwo selbstverständlich. Menschliches Zusammenleben vollzieht sich in der Spannung zwischen dem Wunsch nach Solidarität und Gemeinsamkeit auf Augenhöhe und dem Streben nach Dominanz und Herrschaft. Wer die Vielfalt menschlicher Sozialisationsformen kennt und berücksichtigt, wer die evolutionären Zusammenhänge durchschaut, denen der Staat seine Entstehung verdankt, ist in der Lage, Herrschaftsbedingungen historisch einzuordnen und Dominanz und Herrschaft nicht absolut zu setzen.
Menschen brauchen Freiheit, Menschen brauchen herrschaftsfreie Räume, Menschen entfalten sich in Beziehungen der Solidarität – sie leben besser ohne Repression, ohne Zwangsmittel, ohne Dominanz, Terror und Gewalt. Diese Erfahrung ist und bleibt eine grundlegende Herausforderung an jede Gesellschaft, bis heute.