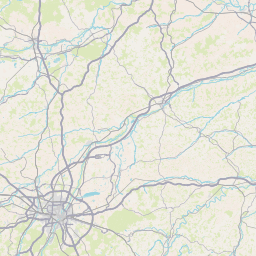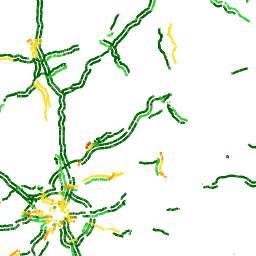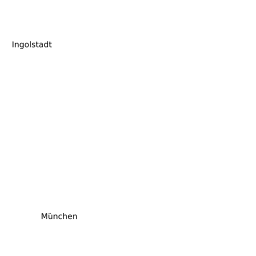Das Corona-Tagebuch Die alptraumhafte Vorstellung, sich dem Chaos einer überlasteten britischen Notaufnahme zu stellen
Heute gibt der in England lebende Österreicher Robert Rotifer einen Einblick in seinen Corona-Alltag. Wie gehen die Menschen in UK mit dem Corona-Virus um? Und was macht das mit der Gesellschaft?

Morgen wird’s eine Woche her sein, dass sie die Flüge eingestellt haben zwischen England und Wien, wo ich herkam. Vor Jahrzehnten mittlerweile, die meisten meiner Freundinnen und Freunde sind also längst von hier, meine engste Familie auch. Das ist der Ort, wo wir wohnen, all die Dinge, die man um sich haben will, die Platten, die Bücher, die Gitarren sind hier. Und trotzdem fragten mich per sozialen Medien einige Menschen aus Wien ernsthaft, ob ich denn nicht "zurückkommen" wollte. Und ja doch, es fühlte sich schon auch wie eine Entscheidung an, den Termin verstreichen zu lassen. Ein Risiko, das wir Eingewanderte samt hier geborenem Nachwuchs auf uns nehmen.
Nervosität schon beim Aufwachen
Das ist wohl auch der Grund für die Nervosität und das Aufwachen um drei oder vier in der Früh. Weil mir bewusst ist, was da auf uns zukommt. Ihr habt alle gehört und gelesen von der so offensichtlich verantwortungslosen Linie der britischen Regierung unter Boris Johnson. Vom Spekulieren auf den Aufbau einer Herdenimmunität durch Masseninfektion. Ohne ernsthafte Maßnahmen zum Schutz von Risikogruppen und vor dem Hintergrund eines fahrlässig kaputtgesparten staatlichen Gesundheitssystems, das auch im Normalfall schon an Mangel an Intensivbetten leidet, und langsam wird diese Sorge auch persönlich.
In Großbritannien: mehr Opfer durch Corona als im 2. Weltkrieg?
Der Nachbar gegenüber zum Beispiel ist pensionierter Neurologe. Er hat sich zwei Wochen selbstisoliert, nachdem ein alter Freund, den er getroffen hatte, krank geworden war. Seine Tochter arbeitet als Virologin am Imperial College London, jener Uni also, deren alarmierende Prognosen letzte Woche die Regierung zum Umdenken gebracht hatten. In den Medien hieß es, dass laut dieser Studie beim Beibehalten der bisherigen britischen Strategie des sanften Einbremsens ohne ernsthafte Einschränkung des öffentlichen Lebens allein in diesem Land 250.000 Menschen sterben würden. Mein Nachbar hat die ganze dicke Studie von seiner Tochter weitergeleitet bekommen und hatte in seiner Isolation Zeit sie zu lesen. Er spricht von einer halben Million Toten. Das wären mehr Opfer, als Großbritannien insgesamt im Zweiten Weltkrieg erlitten hat.
"Stiff upper lip" erweist sich als gefährlich
A propos Zweiter Weltkrieg: Diese ganzen Nachkriegsmythen des unbesiegbaren Britannien, die von der Rhetorik des Brexit, aber auch als Reaktion auf Terror-Anschläge genährt wurden, jenes Steife-Oberlippe-Ethos unter dem Motto "Keep calm and carry on", also die Heroisierung des Ruhigbleibens und Weitermachens, die äußern sich nun in einer gefährlichen Irrationalität. Die einen Virus mit dem Feind von außen verwechselt, dem man unerschrocken die Stirn bieten muss.
"Wenn wir zuhause bleiben, gewinnt es"
Da interviewte etwa ein Kamerateam von Channel Four die Leute auf der Straße, und eine Frau sagte glatt: "Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen, denn wenn wir jetzt zuhause bleiben, gewinnt es." Das sagte sie wirklich: "It wins." Das Virus also will uns einschüchtern, es ist ein Terrorist, es ist der deutsche Blitzkrieg gegen England. Und wer ein unbeugsamer Patriot ist, der stellt sich. "Mich wird das Virus nicht erwischen", hörte ich erst vorige Woche einen Mann bei meinem letzten, im Nachhinein mit Gewissensbissen beladenen Besuch eines vermeintlich beruhigend schütter besuchten Pubs draußen in der Countryside sagen. "Mich auch nicht", sagte ein anderer Mann in seiner Runde. Und sein Hund bellte Zustimmung. Die BBC und Sky News interviewten seither den Inhaber der Pub-Kette Wetherspoons, der offen dazu aufrief, erst recht einen trinken zu gehen. Kriminell, sowas zu sagen, aber was ist mit der Entscheidung, sowas zu senden?
Freund zögert, trotz Symptomen
Ich hatte ja gesagt, die Sache wird zusehends persönlich. Heute etwa unterhielt ich mich per Messenger mit einem Musikerfreund in London, der seit ein paar Tagen an Symptomen leidet, die sich zu seinen üblichen Schwindelanfällen gesellt haben. Natürlich sollte er zum Arzt gehen, aber getestet werden hierzulande nur bereits aufgenommene Krankenhaus-Patienten, und der offizielle Ratschlag lautet, das System nicht zu belasten und nur im Ernstfall medizinische Hilfe zu suchen. Am besten nur telefonisch oder online. Mein Freund zögert also. Wohl auch wegen der alptraumhaften Vorstellung, sich dem Chaos einer überlasteten britischen Notaufnahme zu stellen. Wie viele denken wie er und werden zu lange warten?
Robert Rotifer ist freier Autor bei Bayern 2 und lebt in London.