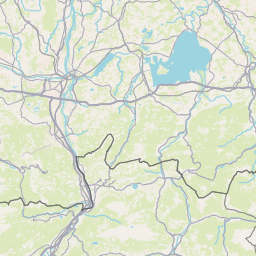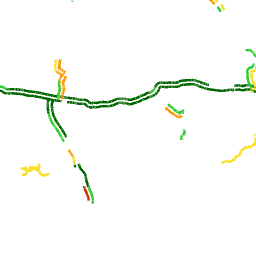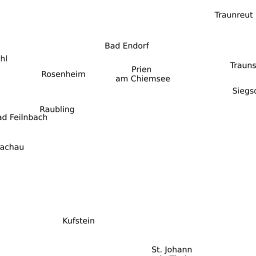Bye Bye Warum stirbt die Popkritik?
Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war die Popkritik ein lebhafter Teil der journalistischen Landschaft. Inzwischen gibt es kaum mehr gedruckte Musikmagazine, selbst die Blog-Kultur ist geschrumpft. Braucht es die Pop-Kritik überhaupt noch?

Popkritiker sein, das war einmal ein Traumberuf. Musik gut oder schlecht finden für Geld. Selbstzufrieden im Backstagebereich herumhängen, dabei der Band das Bier wegtrinken, immer auf der Gästeliste stehen, Interviewreisen nach London, New York und Los Angeles. Mit dem Niedergang der traditionellen Medien ist dieser Lebensentwurf fast ausgestorben. Aber vielleicht ist das ja gar nicht schlimm? Musikkritiker, wie Verena Bogner oder Ralf Niemczyk sagten dazu, das sie nicht glauben, dass junge Leute diese Pseudo Deutungshoheit der Pop Kritiker nicht mehr interessiere und natürlich kennen sich die Kulturredakteur*innen besser mit Musik aus, aber im Endeffekt, who cares, ob sie jetzt dem einen Hansel getaugt hat oder nicht.
Den glamourösen Rockjournalisten gibt es nicht mehr
Eine ganze Branche des Journalismus hat in den vergangenen Jahren einen tiefen Fall aus den Höhen der Arroganz erlebt. Noch im Jahr 2000 zementierte Cameron Crowe, selbst in den Seventies Schreiber beim amerikanischen Rockmagazin Rolling Stone, in seinem Retro-Film „Almost Famous“ das glamouröse Bild des Rockjournalisten als mitreisender Zaungast des Rock'n'Roll-Babylon/ -Zirkus auf Tournee. Der Brite Jon Savage, der selbst in den Siebzigerjahren seine Laufbahn als Popkritiker begann, erinnert sich allerdings ganz anders an seine damalige Berufswelt:
"Die Bezahlung war erbärmlich. Die meisten Autoren waren auf Drogen, so wie alle in der Musikindustrie. Sie wurden verheizt, weggeworfen und minimal entlohnt. Alle sagen, es sei so wunderbar gewesen, aber das war es nicht."
Jon Savage
Also ganz so fett waren sie in Wahrheit also nicht, die goldenen Jahre des Musikjournalismus, aber definitionsmächtig war die professionelle Popkritik allemal. Synchron zur Entwertung der Musik, ist seither auch die Musikpresse zu einem Schatten ihrer selbst geschrumpft.
Alte Bands gefallen alten Leuten
Der Londoner Pete Paphides war seit den frühen Neunzigern Popkritiker bei britischen Zeitschriften wie dem Melody Maker, Time Out und der Zeitung Times. In seinen Mittfünfzigern tanzt er sich nun als Freelancer durchs Leben.
"Die Musikmagazine, für die ich hauptsächlich schreibe, haben seit über 20 Jahren ihre Honorarsätze nicht erhöht. Sie wissen, dass wir so oder so liefern, auch wenn sie uns nicht viel dafür bezahlen. Das gilt für Musiker*innen genauso."
Pete Paphides
Tatsächlich zählt ein bezahlter Autor wie Pete Paphides heute zu den letzten Privilegierten seiner Branche. Für nachkommende Generationen ist ein Kritikerleben wie seines bloß noch Utopie. Das Altersproblem des Musikjournalismus reflektiert sich aber auch in seinem Publikum und dessen Erwartungen. Nicht von ungefähr schrieb Paphides seine letzten beiden Coverstories über die Pet Shop Boys und David Gilmour, Künstler in ihren Sechzigern und Siebzigern. Er sagt, dass alte Bands alten Leuten gefallen, und nur die gäben noch Geld für Printmedien aus. Deshalb titeln Magazine wie Uncut oder Mojo immer mit Paul Weller, wenn er eine neue Platte herausbringt. Wenn einmal Paul Weller oder die restlichen zwei Beatles gestorben seien, würden auch diese Magazine wohl nicht mehr existieren. Traurigerweise.
"Und wenn schon“, sagten die Leute doch bereits in den Nullerjahren, „Der Printsektor stirbt sowieso, dann machen wir eben online weiter.“ Aber die Online-Welt entwickelt ihre eigenen Regeln. Ist in der Welt der parasozialen Beziehungen zwischen Star und Publikum überhaupt noch Platz für Popkritik?
Warum braucht es Pop-Kritik?
Eine Rückblende ins Köln der 1980er und 90er, damals Heimatstadt der Spex, des Zentralorgans des deutschsprachigen Pop-Diskurses.
"Die ganze Theoretisiererei, die fand dann, es war damals auch so Flasche Bier und das dauerte, sagen wir mal, eine Stunde. Und dann ging man ins Sixpack oder in andere Kneipen."
Ralf Niemczyk
Ralf Niemczyk war damals einer der jungen Spex-Schreiber. Er erzählt, dass der Diskurs am Tresen stattfand in kleineren Ausschüssen. Wenn zum Beispiel, eine Band in kleinen Clubs gespielt hat, war die oft dann in der gleichen Kneipe, wo dann auch die Schreiber waren. Und dann stand man dann mit Jochen Distelmeyer am Tresen. Und nach dem dritten, vierten Bier, sagt auch einer, 'Was du damals geschrieben hast, das fand ich aber doof' und so.“ Bei der Spex schrieben damals auch meinungsstarke Frauen wie Clara Drechsler oder Kerstin und Sandra Grether, aber der eben beschriebene Popdiskurs am Tresen war in seinem Ton doch sehr männlich geprägt. Das, erinnert sich Pete Paphides, war auch in der britischen Musikpresse nicht anders. Er sei nur zwei Jahre lang beim Magazin Melody Maker gewesen und rückblickend sähe er, dass das für Frauen eine einschüchternde Umgebung war. Es gab eine gewisse Orthodoxie bei dieser Zeitschrift. Wenn man sich eine Platte anhörte, hatte man auf Basis dieser vorgegebenen Ästhetik zu entscheiden, ob man sie hasste oder mochte. Diese Art von Musikjournalismus fühlte sich wie ein Jungensverein an. Er könne sich an keine Kritikerinnen erinnern, die so geschrieben hätten.
Dieser Kulturkampf ist auch ein Geschlechterkampf
Im Diskurs der vergangenen etwa 20Jahre sieht sich dieser elitäre Nischen-Snobismus der Popkritik zusehends durch den „Poptimism“, die optimistische Bejahung des Mainstream-Pop verdrängt. Verena Bogner, eine junge Wiener Pop-Journalistin, schreibt schon eine Weile für diverse Medien Pop-positive Beiträge. Für sie ist dieser Kulturkampf zwischen altem Pop-Snobismus und neuem Poptimismus auch ein Geschlechterkampf.
Musikkritikerin Verena Bogner, sagt das sei ein alter Geschlechterkampf. Sie glaube, die Musikkritik ist sehr männlich dominiert, und gerade Pop ist ja als Genre weiblich dominiert, vor allem sind ja die Fans überwiegend weiblich und/oder queer. Und das spiele alles rein, in diese akzeptierte Abwertung, also dass man immer sage, die Herzschmerz-Popmusik für die kleinen Girlies käme eh aus der Konserve. Dabei ist Verena Bogner als Journalistin selbst an jenen Kipppunkt des Poptimismus gelangt, wo schon die Kritik an sich von der Fangemeinde als Affront betrachtet wird. Mit den Fans von Taylor Swift, den Swifties, ist nicht zu spaßen. Bogner hat einst eine Rewiew geschrieben, die nicht so positiv war und musste sich mit erzürnten und enttäuschten Swifties auseinandersetzen:
"Von dir hätte ich mir mehr erwartet, du bist ja selber Swiftie, wie kannst du nur sowas sagen?"
Swifties
Der Pop-Diskurs in sozialen Medien hat sich von der traditionellen Popkritik längst abgekoppelt. Doch das Ende der Gatekeepers bedeutet nicht das Ende der manipulativen Machtspiele im Pop. Ganz im Gegenteil. Laut Verena Bogner lässt sich diese Entwicklung echt beobachten bei vielen großen Stars, dass die Fans immer mehr entitled sind. Dass man sage, 'Okay, Taylor, ich zahle dir 1000 Dollar für ein Konzertticket und deswegen will ich auch was dafür.' Und damit meine man dann auch das Recht zum Beispiel, sich zu beschweren, wenn Taylor Swift einen Boyfriend hat, der ihnen nicht taugt. Bogner beobachte, dass viele Fans immer mehr glauben, sie hätten immer mehr recht, sich auch ins private Leben einzumischen.
Ohne Kritik darf Kunst nie wirklich Kunst sein
Hier kommt die parasoziale Beziehung zwischen Star und Publikum in Konflikt mit der kreativen Selbstbestimmung. Wie sich herausstellt, gilt für Pop dasselbe Paradoxon wie für jede andere Kunstform: Ohne Kritik darf Kunst nie wirklich Kunst sein, sondern nur Genussmittel. Könnte sein, dass der Pop sie am Ende doch braucht: die ungeliebte Popkritik.