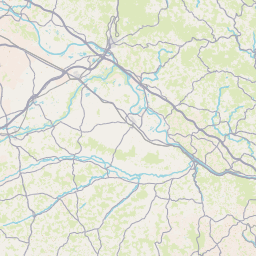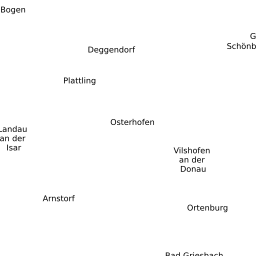Zwischenstand "Leider keine guten Aussichten"
Wie viel Beifall, wie viel Jubel braucht ein amtierender Papst? Wolfgang Küpper, Leiter der BR-Kirchenredaktion, analysierte 2011 die Position von Benedikt XVI. nach den ersten fünf Jahren seines Pontifikats. Ein Rückblick.

Wie viel Beifall, wie viel Jubel braucht ein amtierender Papst? Überhaupt keinen, sagen und schreiben jene, die Benedikt XVI. in einer augenblicklich für die katholische Kirche sehr misslichen Situation zur Seite stehen, die ihn gegen Kritik und Angriffe von außen verteidigen, die ihm den Rücken stärken wollen. Der Papst, so ihre Rede, braucht keinen Beifall. Schließlich ist er das Oberhaupt dieser Kirche, der Stellvertreter Christi auf Erden und als solcher der Verkünder der Wahrheit. Von der Zustimmung anderer ist er nicht abhängig.
Euphorie in den ersten beiden Jahren
Ist das wirklich so? Ist es unerheblich, wie ein Papst in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Kann man vernachlässigen, wie seine Worte, seine Botschaften, seine Gesten von den Zuhörern aufgenommen, verstanden und auch bewertet werden? Wohl nicht. Deswegen erinnern sich nicht nur die, die dem Papst besonders nahe stehen, gerne an die ersten beiden Jahre seines Pontifikats: an die Begeisterungschöre beim Weltjugendtag in Köln 2005, an die überwiegend freudige Stimmung beim Besuch in Bayern ein Jahr später.
Sie erlebten Benedikt als einen Papst, der vor allem den jungen Menschen zeigen wollte, "dass es schön ist, ein Christ zu sein", dass das Christentum kein Regelwerk aus einschränkenden Geboten und Verboten ist, sondern "dass es den Menschen frei machen will". Unter anderem dafür spendeten Zehntausende Beifall, und Benedikt XVI. nahm ihn dankbar lächelnd entgegen.
Hartnäckige Kritiker überrascht
Warum sollte der Papst auch seine Gefühle verbergen, nicht zeigen, dass er Zuspruch zu schätzen weiß? Das hat ihn zu Beginn seines Pontifikats sehr sympathisch erscheinen lassen und wohl auch den einen oder anderen hartnäckigen Kritiker überrascht. Dazu passte das Treffen mit seinem alten, vom Lehramt suspendierten Kontrahenten Hans Küng im Herbst 2005, das zwar ohne konkretes, bahnbrechendes Ergebnis blieb, aber als wohlwollende Geste interpretiert wurde. Hier zeigte sich der offene, gesprächsbereite, nach Weite strebende Papst. Die erste Kontaktaufnahme mit den schismatischen Piusbrüdern stimmte dagegen schon wieder skeptisch, löste aber anfangs nur wenige negative Reaktionen aus.
Williamson als Wendepunkt
Das änderte sich schlagartig, als sich der Traditionalisten-Bischof Richard Williamson Anfang 2009 als Holocaust-Leugner outete und Benedikt zeitgleich die Aufhebung der Exkommunikation gegen eben diesen Williamson und drei weitere Pius-Brüder im Bischofsamt verkündete. Seit diesem Zeitpunkt prasseln die Negativ-Schlagzeilen auf den Papst hernieder. Selbst wohl gesonnenen Katholiken fehlt für dieses Vorgehen des Papstes, die Aufhebung einer Exkommunikation ohne erkennbare Gegenleistung der Betroffenen, jegliches Verständnis.
Großes Problem aufgeladen
Manche Vatikan-Kenner behaupten deshalb, die angestrebte Versöhnung mit den abtrünnigen Pius-Brüdern sei theologisch-dogmatisch das größte Problem, das sich Papst Benedikt während seines jetzt fünfjährigen Pontifikats aufgeladen habe. Und zudem ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Die Verhandlungen mit den Pius-Brüdern finden hinter verschlossenen Türen statt. Dass die schismatische Gruppe von ihrer absurden Forderung, die katholische Kirche müsse sich ändern und nicht sie - die Abtrünnigen -, in irgendeiner Form ablässt, ist nicht zu erkennen.
Misstrauen vergrößert
Was aber können dann die Auseinandersetzungen mit den Pius-Brüdern bringen? Hat sich der Papst an diesem Punkt verrannt? Bei all seiner Vorliebe für Kontinuität und Tradition - die Wiedereinführung des Tridentinischen Messritus als außerordentliche Form der Liturgie ist dafür ein markantes Beispiel - eines kann man Benedikt wohl nicht unterstellen: dass er gänzlich hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurück will. Aber seine Absicht, Gräben zu überwinden, zerstrittene Christen zu einen, die ist nicht verwirklicht. Im Gegenteil. Das bedingungslose Wohlwollen, das der Papst den Piusbrüdern entgegenbringt, hat viele verstört und das Misstrauen in seine Amtsführung vergrößert.
Eingeholt von dunklen Zeiten
Und jetzt die unendliche Auseinandersetzung um Missbrauchsfälle, die zu einer der größten Krisen in der katholischen Kirche seit langem geführt hat. Unstrittig ist, dass Benedikt einen klaren Standpunkt vertritt und Missbrauch als abscheuliches Verbrechen bezeichnet, das bestraft werden muss. Zu schaffen macht ihm die Vergangenheit. Es holen ihn die Zeiten ein, in denen die Kirche zu dieser Problematik lieber schwieg, von Transparenz und Offenheit nichts wissen wollte. Und das alles verbunden mit der Frage, wie sich Joseph Ratzinger als Erzbischof von München und Freising und späterer Präfekt der Glaubenskongregation damals verhalten hat.
Widerspruch zu eigenen Forderungen
Benedikt nimmt dazu nicht Stellung. Das mag der üblichen, entrückten vatikanischen Sprachregelung entsprechen, ist aber in der Konsequenz ein Widerspruch zu den eigenen Forderungen, eben nichts mehr zu verschweigen. Die Folge: Die Verärgerung im Kirchenvolk wächst, noch mehr Vertrauen geht verloren. Das sind leider keine guten Aussichten nach fünf Jahren im Amt.
Auch wenn der Papst angeblich keinen Beifall von Dritten beim Regieren braucht, kann es ihn kalt lassen, wenn sich zur Zeit Menschen in Deutschland ernsthaft Sorgen um die Zukunft der Kirche machen?