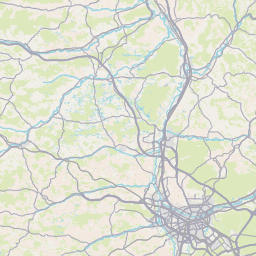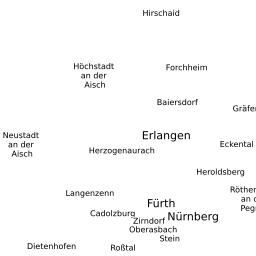Monsoon Baby Regisseur Andreas Kleinert

Wie kam es zu Ihrer Regiearbeit bei „Monsoon Baby“?
Vor vielen Jahren habe ich selber ein psychologisches Drama geschrieben, in der eine polnische Leihmutter eine wichtige Rolle spielte. Die Redakteurin Cornelia Ackers vom Bayerischen Rundfunk kam dann Jahre später auf mich zu und fragte, ob mich ein Drehbuch über eine Leihmutterschaft in Indien interessieren würde. Ein rein thematischer Film über eine sogenannte Problematik interessiert mich generell nicht. Doch hier im vorgeschlagenen Drehbuch bestand die Chance, die Liebesgeschichte des Paares in den Vordergrund zu rücken. Denn dadurch ließen sich die Dimension und Universalität erweitern, man konnte zeigen, wie sich das Geschehen und die Reise nach Indien auf die Beziehung der beiden Protagonisten auswirkt und auch auf ihr persönliches, westlich geprägtes Wertesystem.
Haben Sie selbst einen persönlichen Bezug zum Thema "Leihmutter"?
Nein, das nicht. Für mich wäre das auch nie eine Entscheidung. Aber das soll jedes Paar individuell für sich durchdenken. Die Möglichkeit der legalen Leihmutterschaft ist mittlerweile ein soziales Phänomen in unserer Welt geworden und damit eine sehr diskussionswürdige Fragestellung, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Es gibt keine „richtige“ oder „falsche“ Entscheidung, es ist viel komplexer. Genau das soll unser Film zeigen und dazu beitragen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir uns im Leben oft moralisch entscheiden müssen und damit Verantwortung tragen. Soll man tatsächlich die Möglichkeit, alles haben zu können, in Anspruch nehmen? Wo beginnt die Ausbeutung, nutzt man eine Abhängigkeit aus? Einer der Schlüsselsätze im Film lautet „Vielleicht kann man auch glücklich sein, wenn man nicht alles bekommt, was man sich wünscht“. Unser Film-Paar beginnt ja zu zweifeln, ob seine Entscheidung und sein generelles moralisches Selbstverständnis richtig sind.
Die indische Ärztin Kamalika sagt einmal im Film „In Indien ist alles extrem“. Haben Sie das auch so während der Dreharbeiten in Kalkutta empfunden?
Dieser Satz trifft sicher einen Kerngedanken über Indien. Auf der einen Seite herrscht ein extremes soziales Gefälle, und andererseits ist es erstaunlich, wie die meisten Menschen mit ihrer schwierigen Lebenssituation umgehen: Viele besitzen eine bewundernswerte positive Energie, strahlen großen Lebensmut und Lebenskraft aus. An Feiertagen schmücken sie dann ihre Viertel, möchten, dass es um sie herum schön festlich aussieht, sind fröhlich und tanzen auf den Straßen. Das betrifft auch die Slums, die trotz extremer Armut oft auch gepflegt sind. Ich denke, wir haben im reichen Westeuropa teilweise ein sehr eingeengtes, medial klischiertes Indien-Bild.
Wie meinen Sie das?
Zum Beispiel jetzt, wo das Land wegen der Vergewaltigungen immer wieder in die Schlagzeilen gerät, wäre es verkehrt, Indien nun pauschal als Land der Vergewaltiger zu sehen, in dem Frauen nur unterdrückt und sexuell ausgebeutet werden. Denn andererseits gibt es dort ein sehr differenziertes Frauenbild in allen sozialen Klassen. Viele starke, sehr dominante Frauen lernt man dort kennen. Auch in der jungen Generation gibt es da positive Veränderungen. Andererseits gibt es auch Rückfälle in die Steinzeit. Kurz nach unserer Abreise aus Indien wurde Homosexualität wieder strafbar.
Was war Ihr allererster Eindruck von Indien?
Für die Drehbucharbeit und die Drehortsuche bin ich zum ersten Mal nach Indien geflogen. Das Erste, was mir auffiel, waren Menschen, die auf dem Mittelstreifen der Autobahn leben. Unsere erste Reise war während einer großen Hitzeperiode, und auf den Straßen lagen Massen von Menschen, die einfach draußen schliefen. Es waren so viele gegensätzliche Eindrücke, extreme Erfahrungen, aber tief beeindruckende Erlebnisse. Ich stamme aus der DDR und habe so manches Mal gedacht, wie verwöhnt ich aufgewachsen bin. Indien ist ein wunderbares Land, jeder Tag war für mich ein Geschenk, und ich habe es sehr genossen, dort zu arbeiten. Wenn man mir anbieten würde, wieder einen Film in Indien zu drehen, ich würde sofort wieder hinfliegen. Es fiel mir sehr schwer, dort wegzufahren.
Gab es dennoch eine extreme Erfahrung für Sie?
Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, es sei unangenehm oder bedrohlich, durch die Straßen zu gehen. Ich habe dort auch immer alles Mögliche gegessen, ohne zimperlich zu sein. Aber als wir dann einige Tage im Dschungel Motive gesucht haben, hatte ich wohl etwas Falsches erwischt, und mir ging es 24 Stunden lang sterbenselend, so dass ich schon existentielle Ängste bekam. Aber das ist jetzt Vergangenheit und beeinträchtigt natürlich nicht mein Bild von Indien.
Vieles an Ihrem Film wirkt nicht einstudiert, sondern eher dokumentarisch, vor allem die Straßenszenen. War es schwer, dort zu drehen, brauchten Sie Genehmigungen dafür?
Wir haben tatsächlich relativ wenig gestellt, bis auf ein paar Komparsen um die Schauspieler herum, die wir für manche Szenen benötigten. Probleme beim Drehen gab’s nicht, man braucht zwar wie in Deutschland sehr viele Genehmigungen, aber das hat unsere indische Produktion hervorragend vorbereitet. Wir bekamen große Unterstützung.Teilweise haben wir in sehr gewagter Umgebung, zum Beispiel im Rotlichtviertel, gedreht, aber auch dafür bekamen wir Hilfe durch sehr viele Mitarbeiter. Eine indische Crew ist sehr viel größer als ein deutsches Drehteam. Das Drehen ist natürlich anstrengend. Es ist sehr heiß und sehr laut und immer reich an vielen Schaulustigen, manchmal Hunderte von Kindern, die auf den Dächern saßen und neugierig unsere Arbeit beobachteten! Indien ist ein Filmland, das spürt man. Wir sind überall mit offenen Armen empfangen worden. Die Inder lieben den Film, der „Bollywood“-Mythos lebt.
Dann war alles echte Location oder teilweise auch Filmkulisse?
Alles ist echt, nur die Klinik wurde ein wenig modernisiert. Es war eine echte Geburtsklinik, aber nicht für Leihmütter. Die wirkliche Klinik für Leihmütter gehörte zu einem hässlichen modernen Bürokomplex, da haben wir uns lieber für diese sehr atmosphärische Klinik entschieden.
Wie haben Sie die indische Mentalität empfunden, vor allem bei der Zusammenarbeit mit der dortigen Crew?
Es war eine herzliche Atmosphäre und ein sehr professionelles Arbeiten – aber das Erstaunlichste: die ansteckende Fröhlichkeit der indischen Kollegen. Zum Beispiel bei dem sogenannten Bergfest nach der Hälfte der Dreharbeiten. Normalerweise sind die meisten Crewmitglieder dann eher müde und haben keine große Lust zu feiern. Aber diesmal war es anders. Die indische Crew feierte gern, tanzte den ganzen Abend und steckte alle anderen mit ihrer Begeisterung an. Zuletzt gab es niemanden mehr, der sich nicht mitreißen ließ. Sogar der größte Tanzmuffel machte schließlich mit und tanzte wild zur Musik.
Wie wurden Sie auf die indischen Darsteller aufmerksam?
Dabei hat uns unser indischer Co-Produzent, die Serviceproduktion On the Road Production, sehr unterstützt, und mit ihrer Hilfe haben wir schon bald die indischen Darsteller gefunden. Es gab ein ausführliches Casting, bei dem ich mich ziemlich schnell für Tillotama als Leihmutter Shanti entschieden habe. Sie spielt sehr präzise und differenziert, hat auch schon europäische Filme gedreht und kennt sich entsprechend mit dem europäischen Schauspielstil aus – und sie ist ein großer Brecht-Fan. Auch bei Swaroopa Gosh war ich mir schnell sicher, dass sie für die Rolle der indischen Ärztin Kamalika eine großartige Wahl ist. Sie wirkt sehr kraftvoll und bodenständig, vor allem mit ihrem Sprachmix aus Englisch, Bengali und dem für sie fremden Deutsch, das sie sich für den Film extra angeeignet hat. Das wird weder synchronisiert noch mit Untertiteln unterlegt, um die Authentizität zu bewahren. Auch die Szene, in der sich Shanti und ihr Mann streiten, bleibt im Original. Man versteht zwar nicht die Worte, aber alles ist erkennbar. Auf Reisen ins Ausland müssen wir auch interpretieren und deuten, was wir beobachten. Da gibt’s ja auch keine Untertitel!