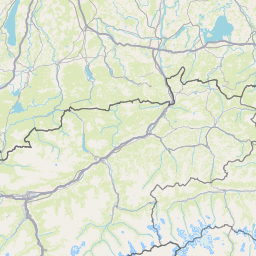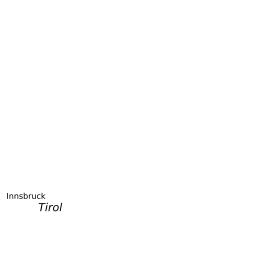3. Februar 1985 Michael Endes „Goggolori“
Einen Pakt mit dem Kobold Goggolori schließt der Bauer Irwing zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Eine uralte bayerische Legende mit keltischen Wurzeln? Eine Erfindung aus dem Jahr 1935? Eine Oper von Michael Ende und Wilfried Hiller aus dem Jahr 1985. Oder doch ein hochprozentiger Schnaps? Autor: Frank Halbach
03. Februar
Montag, 03. Februar 2025
Autor(in): Frank Halbach
Sprecher(in): Christian Baumann
Redaktion: Susi Weichselbaumer
Der Goggolori macht gerne Kokolores. Klar, er ist ja auch ein Kobold. Aber nicht wie der Pumuckl in der Großstadt München daheim, sondern am Ammersee. Und er ist viel, viel älter als Meister Eders Mitbewohner. Selbst die alten Kelten erzählten schon von ihm – behauptet der deutsche Hochschullehrer und Schriftsteller Otto Reuther in seinem 1935 erschienen Buch „Der Goggolore“. Und Otto Reuther muss es wissen. Denn er hat den Goggolori erfunden – also die uralte Legende.
Eine Frage des Charakters
Damit wäre der Goggolori nur etwa ein Vierteljahrhundert älter als der Pumuckl. Kein Zeitraum für unsterbliche Kobolde. Die entscheidenden Unterschiede zwischen Goggolori und Pumuckl müssen woanders liegen.
Die sind vielleicht in erster Linie doch eine Frage des Charakters. Meister Eders Pumuckl ist zwar frech und ein rechter Lauser, aber bleibt doch irgendwie immer liebenswert.
Liebenswert am Goggolri erscheint zwar, dass er dem Bauern Irwing mit magischen Kräften zu reicher Ernte verhilft, aber dass dem Goggolori dafür die Seele von Irwings Tochter Zeipoth gehören soll? Unerhört! Koboldgesetz, pardon, Koboldsvertrag hin oder her. Passend dazu spielt sich die ganze Geschichte um den Goggolori in der düstern Zeit des Dreißigjährigen Kriegs ab. Als der Goggolori Zeipoths Seele an ihrem 14. Geburtstag einfordert, bittet Irwings Frau die Ullerin um Hilfe. Die steht mit arkanen Mächten im Bunde, und ein zerstörerischer Kampf zwischen magischen Kräften entbrennt. Doch selbst mit der Entfesselung der Pest vermag die Hexe dem Goggolori nicht beizukommen, so dass die junge Zeipoth dem Goggolori ihren eignen Tod schenken muss, um das Chaos zu befrieden.
Ein Opernheld
Eine Geschichte, die sich jetzt weniger für ein Kinderhörspiel oder eine familiengerechte Zeichentrickserie zu eignen scheint. Und deswegen gehört der Goggolori auf die Bühne. Der Goggolori ist große Oper! Ein Meisterwerk des Komponisten Wilfried Hiller und des Bestsellerautors Michael Ende. Die "bairische Mär mit Musik in acht Bildern und einem Epilog" hatte am 3. Februar 1985 am Staatstheater am Gärtnerplatz Premiere und wurde damals zum Publikumsmagneten und über 120-mal gespielt. Seinen ersten Bühnenauftritt hatte der bairische Kobold Goggolori freilich schon 30 Jahre zuvor, in „Astutuli“, einer Komödie von Carl Orff.
Der Sohn von Otto Reuther, dem Autor des Goggolore-Buches von 1935, fand nicht unbedingt, dass der Goggolori nicht auf die Opernbühne gehöre, allerdings, dass er nicht Michael Ende und Wilfried Hiller gehöre – und klagte. Ein zerstörerischer Kampf juristischer Kräfte entbrannte, den der Bundesgerichtshof befriedete. Er wies die Klage ab, mit der Begründung Otto Reuthers altbayerische Dorfgeschichte tarne sich als Wiedergabe traditionellen Erzählguts.
In den neuen uralten Legenden heißt es übrigens auch, der Goggolori habe in Notzeiten saure Holzbirnen in Köstlichkeiten verwandelt. Ganz im Geiste des Kobolds folgte man dem Beispiel solcher Wandlung ohne die große Bühne mit dem Weilheimer Goggolori - ein Williams-Christ-Birnenbrand.
Ein Glaserl von dem Birnenbrand
Drücken wir dem Goggolori in die Hand.
Und für den andern Kobold hier,
den Pumuckl, ein Stamperl Bier!
Das reimt sich. Und was sich reimt ist gut. Koboldgesetz. Prost!