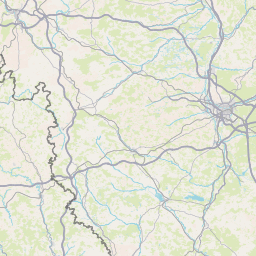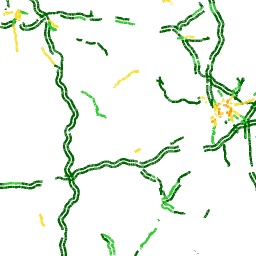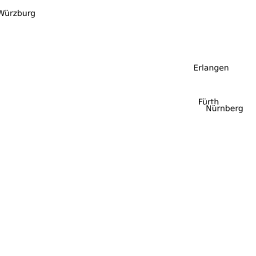4. Februar 1859 Lobegott von Tischendorf klaut älteste Handschrift des Neuen Testaments
Er war Handschriftenforscher und trug entscheidend zu einem wissenschaftlich gesicherten Bibeltext bei: Lobegott Friedrich Constantin von Tischendorf. Seine größte Entdeckung: der Codex Sinaiticus aus dem Katharinenkloster, eine der bedeutendsten spätantiken Bibelhandschriften. Hatte er sie etwa gestohlen? Autor: Simon Demmelhuber
04. Februar
Dienstag, 04. Februar 2025
Autor(in): Simon Demmelhuber
Sprecher(in): Christian Baumann
Redaktion: Frank Halbach
Überall Kritik, überall Zweifel, überall Angriff: Das 19. Jahrhundert stellt alles in Frage. Das Fürstenregiment, die Ständeordnung, den Glauben und jetzt auch noch die Bibel! „Kann man dem Neuen Testament trauen?“, stänkern gelehrte Ketzer. „Was taugt die Überlieferung, was ist echt, was verfälscht, was dazugepfuscht?“ Ach was, dummes Geschwätz!“ grollt Lobegott Friedrich Konstantin Tischendorf und macht den Nachweis texttreuer Zuverlässigkeit zu seiner Lebensaufgabe.
Die Kostbarkeit im Abfall
Er gräbt sich durch europäische Bibliotheken und Manuskriptsammlungen, entziffert als unlesbar geltende Fragmente, trägt Textzeugnisse zusammen, mehrt seinen Ruhm und kann sich 1844 einen Forschertraum erfüllen: die Reise zum Katharinenkloster am Fuß des Berges Sinai. Hier, wo Mose die Zehn Gebote empfing und Gott aus dem brennenden Dornbusch sprach, hofft er unentdeckte Handschriftenschätze zu heben.
Beduinen geleiten Tischendorf von Kairo zum Mosesberg. Zwei Wochen Sand, Hitze, Durst und Kamelgeschaukel, dann ist er am Ziel. Von den Mönchen freundlich aufgenommen, stößt er zwischen Spinnweben, Papiermehl und Mäusedreck auf einen wuchernden Überfluss staubalter Schriften und inmitten des wilden Segens auf einen Korb mit Pergamentresten für Buchbindearbeiten. Tischendorf sichtet den Abfall und birgt eine Kostbarkeit: 129 Blätter einer griechischen Evangelienkopie, die er auf etwa 350 nach Christus datiert. 43 Seiten darf er nach Leipzig mitnehmen, wo sich seine erste Vermutung bestätigt. Er hat tatsächlich Fragmente der ältesten Abschrift des Neuen Testaments entdeckt und von nun an nur noch einen Gedanken: Den Rest der Blätter aufzuspüren und auszuwerten!
Alles nur geklaut?
Neun Jahre vergehen, bis er das Kloster erneut besucht. Die Reise ist ein Debakel. Niemand weiß, wovon der Besucher spricht, niemand kann sich an irgendetwas erinnern, das Manuskript ist unauffindbar, Tischendorf zieht enttäuscht mit leeren Händen ab. Sechs Jahre später wagt er einen dritten Anlauf, diesmal finanziert vom russischen Zaren. Wieder nur Schulterzucken, Kopfschütteln, Abwiegeln. Die Handschrift bleibt verschollen!
Aus, vorbei, ein Lebenstraum geplatzt! Tischendorf gibt auf. Dann, am 4. Februar 1859, dem Vorabend seiner Abreise, bittet ihn der Wirtschafter des Klosters auf ein Glas in seine Zelle, legt ihm stumm einen rot eingeschlagenen Pergamentpacken vor. Tischendorf öffnet das Tuch und hält die älteste vollständige Abschrift des Neuen Testaments in Händen.
Die Krönung eines Forscherlebens. Triumph und Happy End. Nicht ganz. Denn jetzt wird die Sache verzwickt. Verkaufen wollen die Mönche den Codex nämlich nicht. Allenfalls nach Petersburg entleihen, sofern Tischendorf verspricht, ihn auf Anforderung sofort zurückzubringen. Doch dazu kommt es nicht. Die Handschrift bleibt in Petersburg und Tischendorf gilt fortan als ein gemeiner Dieb, der arglose Mönche bestahl. Er beteuert ein Leben lang, das Kloster habe dem Zaren den Codex geschenkt, doch erst in den frühen 2000er Jahren bestätigen Archivfunde seine Behauptung. Damit ist der wackere Bibelritter aus Sachsen für alle Zeit endlich vom Haken.