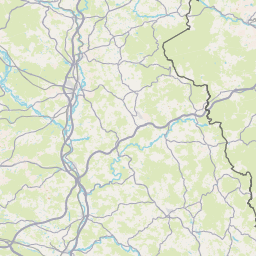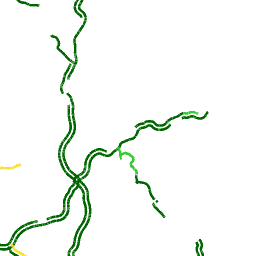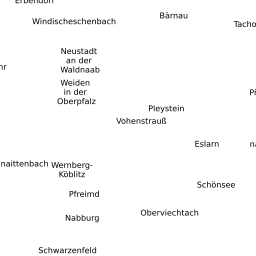50 Jahre Sehen statt Hören Gehörlose können alles, außer hören
"Sehen statt Hören" ging am 5. April 1975 als "Wochenmagazin für Menschen mit Hörschädigung" im damaligen Bayerischen Fernsehen auf Sendung. Bis heute ist es das einzige Fernsehangebot, weiterentwickelt zu "Fernsehen in Deutscher Gebärdensprache". Das Jubiläum ist auch Anlass, dass der BR erneut ungewohntes Terrain erobert: Denn "Sehen statt Hören" feiert nicht allein in seiner Special Interest-Nische Geburtstag, sondern auf allen Kanälen, die mitmachen wollen.

Der BR macht dieses Jahr mehr als je zuvor Gehörlose sichtbar. In ihren Kompetenzen. Wie? – Sehen statt Hören "hackt" die Regelprogramme und bietet dem Publikum damit Überraschung im Gewohnten: Die BR Redaktionen Kinder und Sehen statt Hören haben mit "Jason & die Haustiere" bereits erfolgreich bewiesen, dass so ein "Hack" ganz wunderbar funktioniert. Und sogar nachhaltig ist; gerade laufen die Drehvorbereitungen für die mittlerweile 3. Staffel.
Das Publikum wird heuer auch in einem Querbeet Spezial auf gehörlose Hobbygärtner treffen. Mit unserem preisgekrönten Moderator Jason Giuranna wird es einen Cameo-Auftritt in 2 Folgen von Dahoam is Dahoam geben. Und junge Erwachsene können Pascal aus dem Allgäu bei der Frage begleiten, Lohnt sich das - als Systemelektroniker. Die Antwort: selbstverständlich in Gebärdensprache!
Der BR bietet gehörlosen Menschen damit eine ganz natürliche Repräsentanz.
"Sehen statt Hören ist der Leuchtturm für die Gebärdensprachgemeinschaft. Der anhaltende Erfolg der Sendung und die hohe Anerkennung in der Community ist der hohen Authentizität, dem außergewöhnlichen Engagement der Redaktion und dem je hälftigen Team aus gehörlosen und hörenden Mitarbeitenden, die mit- und voneinander lernen, zu danken. Seit inzwischen fünf Jahrzehnten kontinuierlich in Entwicklung, beweist Sehen statt Hören heute, dass mediale Inklusion mehr ist als ein zuschaltbarer Extrakasten für Gebärdenspracheinblendungen."
Werner Reuß, Programmbereichsleiter Wissen und Bildung beim BR
Zurück ins Jahr 1975
Vor 50 Jahren sah die Welt noch ganz anders aus: Damals war gebärden als "Affensprache" verpönt! Gehörlosen Kindern war es streng verboten, "ihre" Sprache auf dem Schulhof zu benutzen. Im Unterricht wurde auf die "orale Methode" gesetzt, alle mussten sich an die Lautsprache anpassen. Unterrichtsinhalte verstehen und dadurch Bildung erlangen? Nebensache! Gut sprechen können war das Ziel. Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und gleiche Chancen für Alle waren noch in weiter Ferne.
Aber schon damals hat der BR Zuschauerzuschriften ernst genommen: Otto Weinzheimer, Vater eines gehörlosen Sohnes, hat damals ein Angebot für Gehörlose gefordert.
In diese Zeit hinein hat der BR also eine Sendung konzipiert, die dieser "ungehörten" Personengruppe einen eigenen, wertvollen Raum gab – sichtbar in aller Öffentlichkeit: im BR und als Wiederholung in allen anderen ARD-Programmen, ARD alpha und 3sat.
Pionier in der Medienlandschaft
Die erste Moderatorin: Elke Grassl, eine hörende Gehörlosenlehrerin, die mit lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) durch die neue Sendung führte.
Anfangs führte noch eine hörende Gehörlosenlehrerin, Elke Grassl, mit lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) durch die neue Sendung. Die Gehörlosen merkten aber rasch, dass eine Hörende mit LBG ihre sprachlichen Bedürfnisse nicht erfüllte. Als aus den USA in den 1980er Jahren erste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sign Languages nach Deutschland schwappten, entstand eine Aufbruchstimmung. 1986 wurde auch im Deutschen Fernsehen zum ersten Mal Gebärdensprache verwendet – natürlich bei Sehen statt Hören. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Jürgen Stachlewitz, der erste gehörlose Moderator im BR. Für rund 30 Jahre sollte er durch seine gebärdensprachlichen Moderationen zum Sprachvorbild vieler Gehörloser werden.
65.000 digitalisierte Programmminuten
Sehen statt Hören verfügt über mehr als 65.000 digitalisierte Programmminuten. Nicht zuletzt damit hat der BR eine einzigartige Dokumentation, dass und wie sich Gebärdensprache in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. Ein Meilenstein in diesem Prozess: 2002 wurde die Deutsche Gebärdensprache (DGS) offiziell als eigene Sprache neben Deutsch anerkannt.
Selbst Teil der Geschichte: das einzige Angebot in Deutscher Gebärdensprache
Sehen statt Hören stärkte mit seinem Angebot seit inzwischen fünf Jahrzehnten die Gehörlosengemeinschaft nicht nur als Sprach-, sondern auch als Kulturgemeinschaft. Auch als Sendung ist sie in vielerlei Hinsicht zum Gegenstand in der wissenschaftlichen Forschung geworden, wird in Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen eingesetzt. Die Studiengänge „Gebärdensprachdolmetschen“ setzen inhaltlich und sprachlich auf Sehen statt Hören. Gehörlosenverbände stützen ihre politischen Forderungen auch auf Beiträge. Zahlreiche Bachelor- oder Masterarbeiten fragen nach Material.
Sehen statt Hören ist längst Teil von Deaf History. Und gleichzeitig weiter das einzige journalistische, unabhängige Content-Angebot in Deutscher Gebärdensprache.
Ein inklusives Angebot
Immer im Mittelpunkt: gehörlose Menschen und ihre emotionalen (Lebens-)Geschichten: Rona, die mit 16 Jahren plötzlich Vollwaise und auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Tom Eller, der seinen sportlichen Traum vom 6. Stern lebt. Familien, die sich hautnah während der Geburten ihrer Kinder begleiten lassen. Oder eine Frau, deren erste Fahrt im ICE ausgerechnet nach Eschede führte: Sehen statt Hören bietet Anknüpfungs- und Identifikationspunkte jenseits von Behinderung und ist damit ein originär inklusives Angebot.
Public Value – der BR und die ARD profitieren
Wer jetzt denkt, „das ist doch nur was für Gebärdensprachnutzende“: Eine aktuelle IZI-Studie zu Jason & die Haustiere belegt: Mit einem gut gemachten inklusiven Angebot profitieren Alle – mit und ohne Hörbehinderung.
Und wenn in Kommentaren auf Youtube zu lesen ist, "Was für eine wertvolle Reportage! Für so etwas zahle ich gerne Rundfunkgebühren" zahlt ein Special Interest-Angebot auf den ganzen BR ein. Public Value im besten Sinne.
Gehörlose können nicht Hören lernen …
… aber Hörende können Gebärdensprache lernen! Oder sich Gehörlosen zugewandt zeigen für eine lebendige Kommunikation mit Händen und Füßen. Kinder, die sich von Jason begeistern lassen, machen es uns vor: sie wollen sofort ein paar Gebärdenworte lernen. Diesem Wunsch kommen die MacherInnen von Jason und die Haustiere seit der 2. Staffel nach: Zunächst waren es Zusatzangebote rund um die Bewerbung der neuen Sendung, ab der 3. Staffel wird es in jeder Folge eine kleine Gebärdensprachschule geben.
Die Moderatorinnen und Moderatoren der Sendung:
Wie beim Reisen – nicht in ein anderes Land, sondern in eine andere Welt
Als sympathische Touris gucken wir schon vor der Reise, dass wir ein paar Brocken der Landessprache draufhaben. Et voilá: Schon ist unser Gegenüber positiv überrascht und wir sind in Interaktion. Warum nicht auch in Gebärdensprache.
Die hörende Welt ist gefragt: Wir können erstaunlich einfach Kommunikationsbarrieren zu Gehörlosen abbauen. Wer sich nicht gleich an Gesten traut, kann auch fix das Smartphone zücken und dort Sprache verschriftlichen – oder old school mit Zettel und Stift hantieren.
Gehörlose können alles – außer hören
Die Mehrheitsgesellschaft weiß immer noch zu wenig über Gehörlose und ihre Sprache. Da bietet der BR mit Sehen statt Hören eine unverzichtbare Plattform für Perspektivwechsel, Information und Sensibilisierung.
In ihrem Selbstverständnis sind Gehörlose nicht behindert, sondern eine kulturelle und sprachliche Minderheit. In diesem Selbstverständnis sollten Gehörlose also auch nicht nur in ihrem Nischenprogramm stattfinden, sondern auf allen Kanälen. Denn, um es frei nach Raúl Krauthausen zu sagen: Auch nicht-behinderte Menschen haben ein Recht darauf, auf behinderte Menschen zu treffen.
Untertitel sind kein Ersatz
Mal angenommen, Sie möchten die Nachrichten oder den Tatort verfolgen, aber es stünden Ihnen nur französische Untertitel zur Verfügung - genau so ist ein deutscher Text auch für Gehörlose: eine Fremdsprache. Gebärdensprache hat eine eigene Struktur und Grammatik. Verschriftungen sind für Gehörlose kein ausreichendes Angebot. Gehörlose Kinder beispielsweise können (wie auch hörende Kinder) mit Untertitelungen gar nichts anfangen.
Neuerungen zum Geburtstag
Freilich gibt’s zum 50. auch ein Geschenk. In diesem Fall: eine neue "Verpackung". Sehen statt Hören bekommt im zweiten Quartal einen neuen Opener geschenkt.
Außerdem neu: Ab der Jubiläumssendung verzichtet Sehen statt Hören auf die fest eingebrannten "offenen" Untertitel, "zuschaltbare VTUT" werden selbstverständlich weiter angeboten. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung umgekehrte Inklusion, denn die Kernzielgruppe gehörloser Menschen hat bereits auf ihren Geräten Untertitelungen voreingestellt. Somit werden doppelte Untertitel vermieden und ein "Störfaktor" beseitigt. Für das taubblinde Publikum ist diese Neuerung sogar wichtig, denn sie können nun die personalisierte Anpassung von Untertiteln über HbbTV komfortabel nutzen. Und für hörendes Publikum wird das Sehen statt Hören-Angebot attraktiver und "normaler".