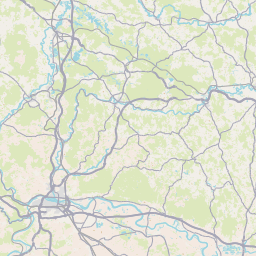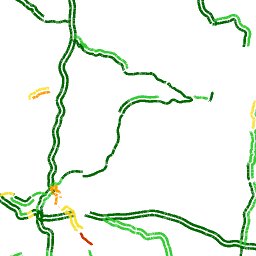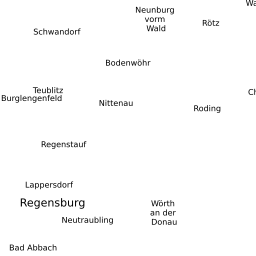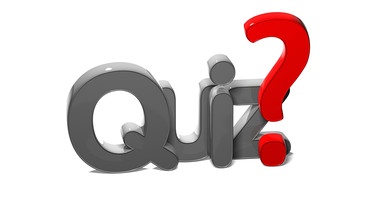Göttlich "gut"?

| Ethik und Philosophie | RS, Gy |
|---|
Essen nährt nicht nur den Leib. Die Seele isst mit. Speisegesetze bürgen dafür, dass sie durch Mund und Magen keinen Schaden nimmt. Nahrungsgebote öffnen den Zugang zum Heiligen, spiegeln und wahren die Ordnung des Schöpfungswerks.
Mit dem Essen ist das so eine Sache. Wir brauchen Nahrung, sonst verhungern wir. Das ist die eine Seite: Der Zwang, zu essen und auszuscheiden, macht uns mit den Tieren gemein. Damit gibt sich die Religion nicht zufrieden: Wir sind mehr als Essen, Kot und Verwesung. Wir sind Menschen, wir sind Geist. Wir sind Geschöpfe Gottes, geschaffen als sein Ebenbild und zur Ewigkeit berufen! Das ist die andere Seite.
An der Schnittstelle von Materie und Geist
Aber wie bringen wir Leib und Seele zusammen, wie versöhnen wir Materie und Geist? Das religiöse Denken hat einen Weg gefunden: Es heiligt die Notdurft des Körpers und holt das Essen von der nur leibhaften auf die spirituelle Seite. Für diese Verwandlung sorgen Nahrungsgebote und Nahrungstabus. Sie versöhnen unsere körperlichen mit den geistigen Bedürfnissen, vermitteln zwischen Himmel und Erde und bringen das Profane auf Augenhöhe mit dem Heiligen.
Im Kosmos der Speisegesetze
Nahezu alle Religionen und Kulturen kennen solche Speisegesetze, die den Verkehr des Göttlichen mit dem Menschlichen regeln. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten. Kein Gebot oder Verbot gilt überall. Was eine Religion verfemt, lässt eine andere gelten. So ist etwa der Verzehr von Schweinefleisch oder Blut für Juden und Muslime strikt verboten, während Christen ihr Seelenheil durch ein Schweinskotelett oder ein deftiges Blutwurstgericht keineswegs gefährden. Das Judentum wiederum verbietet den Genuss von Kamelfleisch, das Christen unbekümmert essen dürfen und vielen Muslimen als ausgesprochener Leckerbissen gilt.
Viele Deutungsversuche, keine Universalformel
Die Vielfalt religiöser Speisegebote und Nahrungstabus ist verwirrend. Die unterschiedlichsten Fachrichtungen, vor allem Ethnologie, Soziologie und Religionswissenschaft, bemühen sich um eine Erklärung der verwickelten Verhältnisse und legen eine breite Palette medizinischer, hygienischer, ökonomischer, ökologischer oder symbolischer Interpretationen vor. Eine allgemeine, widerspruchsfreie Deutung kann jedoch keine Disziplin alleine liefern.
Auf gemeinsamem Grund
Trotzdem sind Wirkungsmomente und religiös-symbolische Konzepte hinter den Erscheinungen erkennbar, die als gemeinsame Schnittmenge gelten können: Speisegesetze sind, abgesehen von der Meidung verdorbener oder giftiger Nahrungsmittel, nicht durch den Instinkt oder die Vernunft bedingt. Sie markieren die prekäre Schnittstelle von Geist und Materie; sie repräsentieren die Ordnung einer Schöpfung, die zwischen heilig und profan und rein und unrein unterscheidet; sie schaffen eine hochwirksame, tagtäglich erneut bestärkte Gruppenidentität in Abgrenzung zu allem, was außerhalb steht, und zuletzt demonstrieren sie die unbegrenzte Verfügungsgewalt eines Schöpfergottes über seine Geschöpfe.